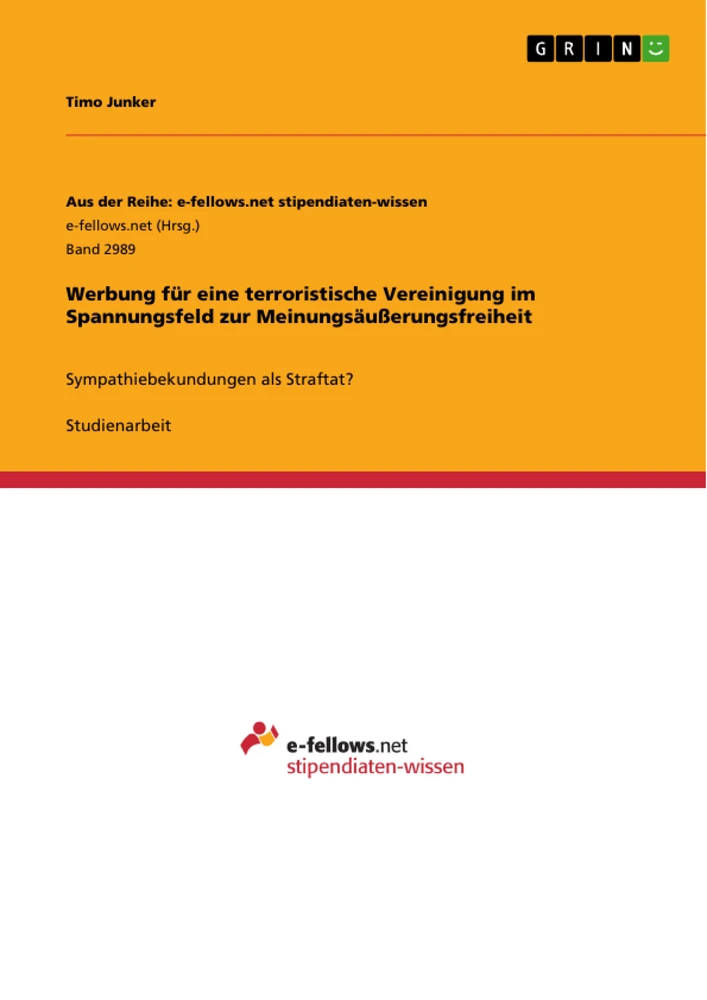Die entscheidende Frage lautet, ob überzeugende Gründe bestehen, die Sympathie-Werbung für eine terroristische Vereinigung als nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern als strafwürdig anzusehen.
Im Jahr 2002 hob der Gesetzgeber die Strafbarkeit der Sympathie-Werbung auf. Der Weg, den Rechtsprechung, Literatur und der Gesetzgeber bis zu dieser Entscheidung gegangen sind, wird im Rahmen dieser Arbeit nachgezeichnet und kritisch hinterfragt. Es soll dabei auch geklärt werden, inwieweit die Pönalisierung von Sympathie-Werbung geeignet, erforderlich und nicht zuletzt angemessen war, um der linksterroristischen Bedrohung zu begegnen. Den Schwerpunkt der Bearbeitung bildet der Zeitraum von der Einführung des §129a StGB 1976 bis 1989, während die neuere Entwicklung des Paragraphen nur zur Kontrastierung aufgegriffen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Das Problem der "Sympathiebekundungen"
- Die Abgrenzung zwischen Meinungsäußerungsfreiheit und Strafbarkeit
- Die Strafverfahren gegen die Rote Armee Fraktion
- Die Anfänge der RAF und die ersten Verfahren
- Die Jahre des "Terrorismus" und die Entwicklung des Strafrechts
- Die Auseinandersetzung mit den "Sympathiebekundungen" im Kontext der RAF
- Die Bedeutung des § 129a StGB
- Die Entstehung des § 129a StGB im Spannungsfeld zwischen Terrorismusbekämpfung und Grundrechten
- Die Anwendung des § 129a StGB in der Praxis
- Die Diskussion um die Verhältnismäßigkeit des § 129a StGB
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem komplexen Thema der Strafbarkeit von Sympathiebekundungen für terroristische Vereinigungen im Spannungsfeld zur Meinungsäußerungsfreiheit. Sie analysiert die Strafverfahren gegen die Rote Armee Fraktion (RAF) im Spiegel der strafjuristischen Zeitgeschichte und untersucht die Entwicklung des deutschen Strafrechts in Bezug auf die Bekämpfung von Terrorismus. Dabei werden die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit und die Möglichkeiten des Staates zur Bekämpfung von Terrorismus im Vordergrund stehen.
- Die Abgrenzung zwischen Meinungsäußerungsfreiheit und Strafbarkeit
- Die strafrechtliche Bekämpfung von Terrorismus
- Die Rolle des § 129a StGB in der deutschen Strafrechtsgeschichte
- Die Bedeutung der Strafverfahren gegen die RAF für die Entwicklung des Strafrechts
- Die Herausforderungen der Strafverfolgung im Kontext von Terrorismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet eine kurze Einführung in das Thema und stellt die Relevanz des Themas in den Kontext der aktuellen Debatten um Terrorismus und Meinungsfreiheit. Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" behandelt die Definition von Sympathiebekundungen und die Abgrenzung zwischen Meinungsäußerungsfreiheit und Strafbarkeit.
Das Kapitel "Die Strafverfahren gegen die Rote Armee Fraktion" analysiert die Strafverfahren gegen die RAF im Spiegel der strafjuristischen Zeitgeschichte und untersucht die Entwicklung des deutschen Strafrechts in Bezug auf die Bekämpfung von Terrorismus.
Das Kapitel "Die Bedeutung des § 129a StGB" befasst sich mit der Entstehung und Anwendung des § 129a StGB im deutschen Strafrecht und diskutiert die Verhältnismäßigkeit dieser Strafnorm.
Schlüsselwörter
Sympathiebekundungen, Terrorismus, Meinungsäußerungsfreiheit, Strafrecht, Strafverfahren, Rote Armee Fraktion (RAF), § 129a StGB, Strafrechtsgeschichte, Zeitgeschichte, Terrorismusbekämpfung, Grundrechte, Verhältnismäßigkeit, Strafverfolgung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Tatbestand der Sympathiewerbung für terroristische Vereinigungen?
Es handelte sich um eine frühere Strafnorm, die das öffentliche Werben um Sympathie für terroristische Gruppen unter Strafe stellte, ohne dass eine konkrete Tat unterstützt wurde.
Was regelt der Paragraph 129a StGB?
§ 129a StGB regelt die Bildung, Mitgliedschaft und Unterstützung terroristischer Vereinigungen sowie die Werbung für deren Ziele.
Wann wurde die Strafbarkeit der Sympathiewerbung aufgehoben?
Der Gesetzgeber hob die Strafbarkeit der reinen Sympathiewerbung im Jahr 2002 auf, um das Spannungsfeld zur Meinungsfreiheit zu entschärfen.
Warum war die RAF-Zeit entscheidend für das Strafrecht?
Die Bedrohung durch die Rote Armee Fraktion (RAF) führte in den 1970er Jahren zu massiven Verschärfungen im Strafrecht und in der Strafprozessordnung.
Wo liegen die Grenzen zwischen Meinungsfreiheit und Terrorismuswerbung?
Die Grenze ist dort erreicht, wo Äußerungen nicht mehr nur eine Meinung kundtun, sondern gezielt dazu dienen, die Organisation personell oder materiell zu stärken.
- Quote paper
- Timo Junker (Author), 2013, Werbung für eine terroristische Vereinigung im Spannungsfeld zur Meinungsäußerungsfreiheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448547