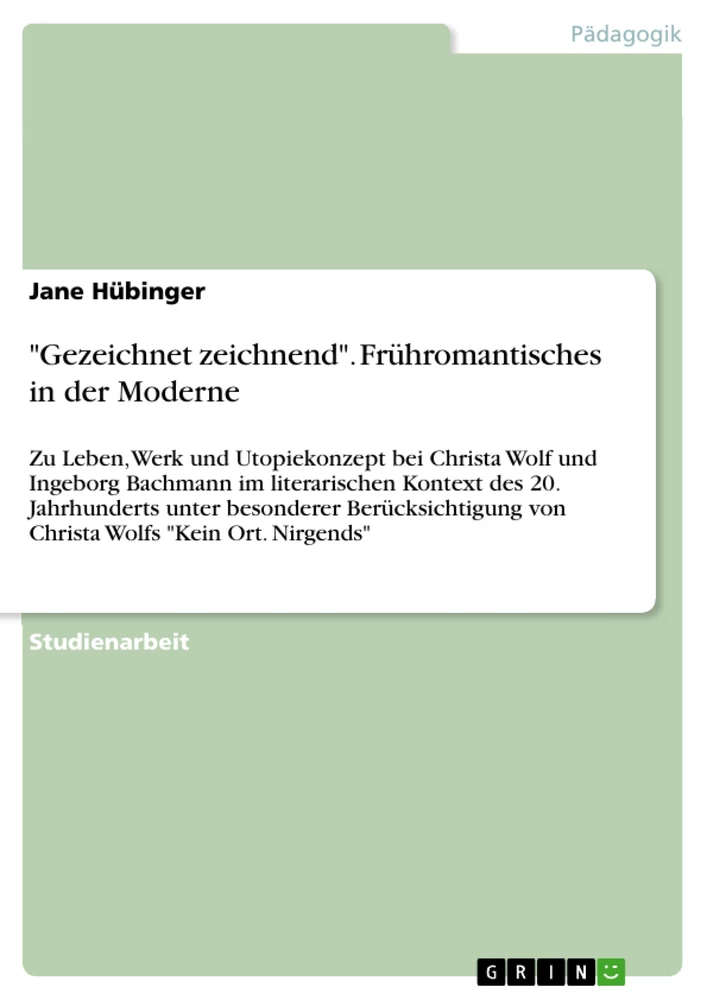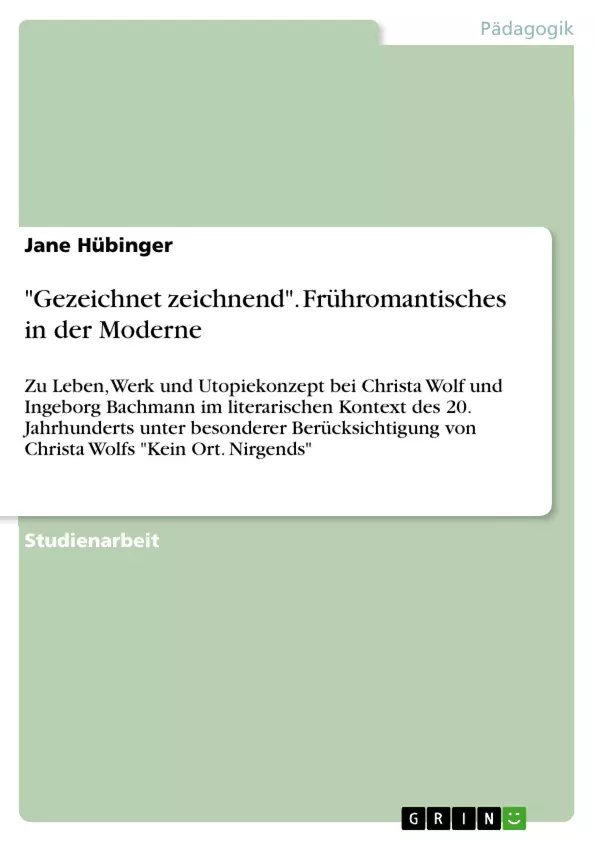Dieser Untersuchung geht es primär darum, anhand verschiedener Texte Wolfs und Bachmanns deren poetologische Ansätze zu erschließen und dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Wie sich dabei zeigen wird, verläuft die literarische Beziehung beider Autorinnen zueinander einseitig: Während die DDR-Schriftstellerin mehrfach Äußerungen über die österreichische Autorin verlautbart, lässt sich umgekehrt keine Positionierung Bachmanns zu Wolf finden. Im Zuge ihrer Bachmann-Rezeption glaubt Wolf nicht nur, „[d]ie Bachmann ist aber jene namenlose Frau aus Malina, sie ist jene Franza aus dem Romanfragment“, indem sie in „ihrer vierten Vorlesung den Charakter der Unmittelbarkeit weiblichen Schreibens mit Bachmanns Werk [belegt],“ sondern entwirft auch aus dieser historischen Person eine ‚Figur‘, wie sich zeigen wird. Deswegen erscheint es sinnvoll, der Betrachtung des Werks und Lebens Wolfs unter Berücksichtigung ihrer Bachmann-Rezeption hier mehr Gewicht zukommen zu lassen. KON bietet sich in vielerlei Hinsicht zu einer eingehenderen Analyse an, so z.B. auch, inwieweit Wolf eine Nachfolge ihrer Kollegin antritt. So gilt es, Wolfs Gestaltungsprinzip vornehmlich an diesem Werk zu analysieren, um zuvörderst aufzuzeigen, wo und wie der Utopiebegriff bei Wolf konträr zu Bachmann Verwendung findet.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1.1 Hinführung
- 1.2 Zielsetzung
- PRÄLIMINARIEN: ZUR GESCHICHTE DER UTOPIE
- 2.1 Begriff und Bestimmung
- 2.2 Zu Christa Wolfs Utopiekonzept: Auf den Spuren Ernst Blochs
- CHRISTA WOLFS Kein Ort. Nirgends
- 3.1 Biografisch-sozialhistorischer Kontext
- 3.2 „Gesprächs- und Projektionsraum Romantik“
- 3.3 Zu Christa Wolfs Gestaltungsprinzip in Kein Ort. Nirgends
- 3.3.1 Zum Schreibverfahren in KON
- 3.3.2 Utopie in KON
- ZUSAMMENFASSUNG
- 4.1 Zur Wahlverwandtschaft Christa Wolfs zu Ingeborg Bachmann
- 4.2 Zu Christa Wolfs Bachmann-Rezeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Leben und Werk von Christa Wolf und Ingeborg Bachmann im Kontext der Literaturentwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dabei soll nicht nur der Einfluss des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit auf das Schaffen der beiden Autorinnen beleuchtet, sondern auch ihre individuellen poetologischen Ansätze und ihre Beziehung zueinander untersucht werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse von Christa Wolfs Roman „Kein Ort. Nirgends“, insbesondere im Hinblick auf ihre Rezeption von Ingeborg Bachmanns Werk und der Frage, wie sich Wolfs Utopiekonzept von Bachmanns Ansätzen unterscheidet.
- Das Leben und Werk von Christa Wolf und Ingeborg Bachmann im Kontext der Literaturentwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- Der Einfluss des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit auf das Schaffen der beiden Autorinnen
- Die poetologischen Ansätze von Christa Wolf und Ingeborg Bachmann
- Die Beziehung zwischen den beiden Autorinnen, insbesondere Wolfs Rezeption von Bachmanns Werk
- Die Analyse von Christa Wolfs Roman „Kein Ort. Nirgends“ im Hinblick auf ihr Utopiekonzept im Vergleich zu Bachmanns Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
- EINLEITUNG: Die Einleitung stellt Christa Wolf und Ingeborg Bachmann als bedeutende Autorinnen der Nachkriegsliteratur vor, die sich mit den Themen Gewalt, Faschismus, Widerstand und Bedrohung auseinandersetzen. Die Einleitung stellt zudem den Zusammenhang zwischen utopischem Denken und poetischem Gestalten her und führt die beiden zentralen Themen der Arbeit ein: das Utopiekonzept und die Beziehung zwischen den beiden Autorinnen.
- PRÄLIMINARIEN: ZUR GESCHICHTE DER UTOPIE: Dieser Abschnitt liefert eine kurze Einführung in den Begriff der Utopie und stellt verschiedene Definitionen und Ansätze vor. Dabei wird insbesondere auf Ernst Blochs Utopiekonzeption Bezug genommen, die für Christa Wolfs Werk von Bedeutung ist.
- CHRISTA WOLFS Kein Ort. Nirgends: In diesem Abschnitt wird der Roman „Kein Ort. Nirgends“ von Christa Wolf aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Zuerst wird der biografisch-sozialhistorische Kontext des Werks dargestellt, dann der Einfluss der Romantik auf Wolfs Schreibweise und schließlich Wolfs Gestaltungsprinzip im Detail analysiert. Dabei werden die Schreibtechniken des Romans und die Rolle des Utopiebegriffs in „Kein Ort. Nirgends“ im Fokus stehen.
- ZUSAMMENFASSUNG: Die Zusammenfassung befasst sich mit der Wahlverwandtschaft zwischen Christa Wolf und Ingeborg Bachmann und beleuchtet, wie Wolf Bachmanns Werk rezipiert hat. Der Abschnitt stellt heraus, inwieweit Wolfs Arbeit von Bachmanns Ideen beeinflusst wurde und wo sich ihre Konzepte unterscheiden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Christa Wolf, Ingeborg Bachmann, Utopie, Nachkriegsliteratur, Romantik, Poetik, Schreibverfahren, „Kein Ort. Nirgends“, Gestaltungsprinzip, Vergleichende Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche Beziehung besteht zwischen Christa Wolf und Ingeborg Bachmann?
Die Beziehung ist literarisch einseitig: Wolf rezipierte Bachmann intensiv und sah in ihr eine Wahlverwandte, während von Bachmann keine Stellungnahme zu Wolf bekannt ist.
Worum geht es in Christa Wolfs Werk „Kein Ort. Nirgends“?
Die Erzählung beschreibt eine fiktive Begegnung zwischen Karoline von Günderrode und Heinrich von Kleist und thematisiert das Scheitern utopischer Hoffnungen in einer restriktiven Gesellschaft.
Wie unterscheidet sich der Utopiebegriff bei Wolf und Bachmann?
Die Arbeit analysiert, wo Wolfs Utopiekonzept (beeinflusst durch Ernst Bloch) konträr zu Bachmanns Ansätzen der Unmittelbarkeit weiblichen Schreibens steht.
Welchen Einfluss hatte der Nationalsozialismus auf beide Autorinnen?
Beide setzen sich in ihren Werken mit den Themen Gewalt, Faschismus und dem Fortwirken dieser Strukturen in der Nachkriegsgesellschaft auseinander.
Was meint Wolf mit der Bezeichnung Bachmanns als „namenlose Frau aus Malina“?
Wolf identifizierte die historische Person Bachmann stark mit ihren literarischen Figuren und nutzte dies als Beleg für die Unmittelbarkeit weiblicher Erfahrung in der Literatur.
Was bedeutet der Titel „Gezeichnet zeichnend“?
Er spielt auf die Doppelrolle der Autorinnen an, die einerseits von ihrer Geschichte geprägt (gezeichnet) sind und andererseits diese Welt durch ihr Schreiben aktiv gestalten (zeichnend).
- Quote paper
- Jane Hübinger (Author), 2014, "Gezeichnet zeichnend". Frühromantisches in der Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448562