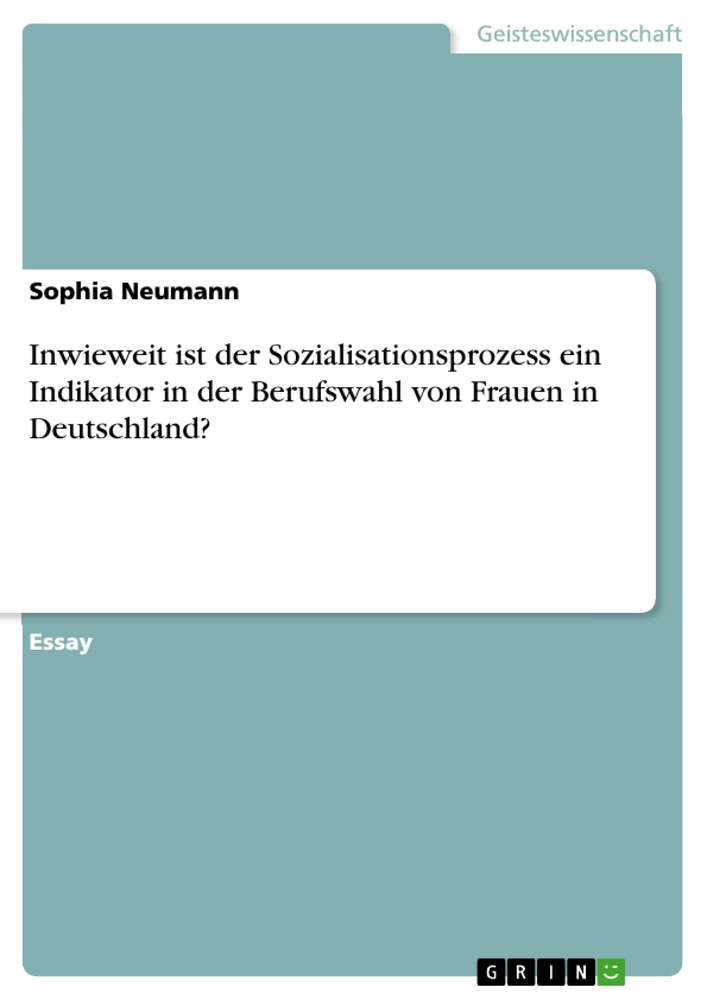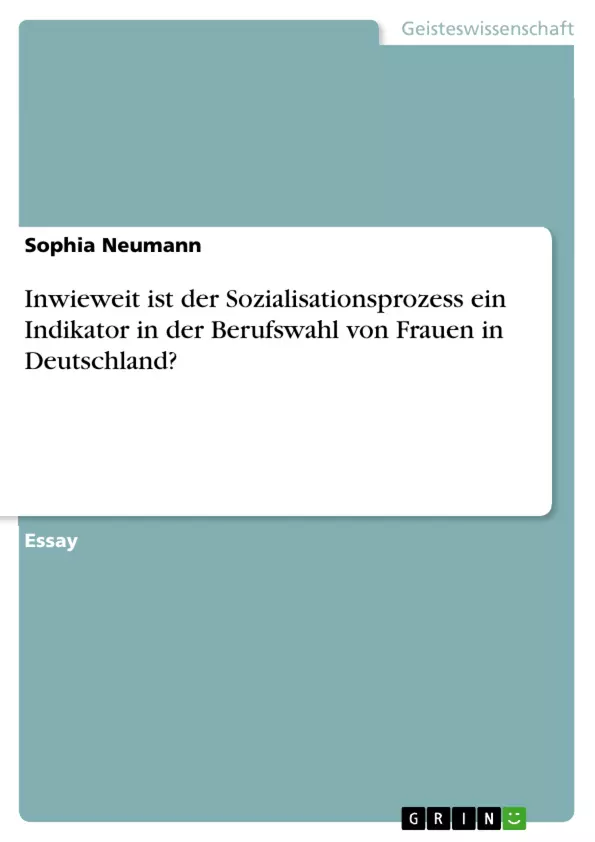Wer sich allein dieses Semester 17/18 in der Soziologievorlesung umsieht, erkennt sehr schnell, dass überwiegend Frauen die Audimax Ränge besetzen und nur vereinzelt ein paar Männer in den Reihen auftauchen. Schaut man hingegen in eine Maschinenbauvorlesung überwiegt die Anzahl männlicher Studenten.
In den letzten Jahrzehnten hat der Anteil der Frauen an den höheren Bildungsabschlüssen in allen Fachbereichen zugenommen. Trotzdem findet man sie nur in bestimmten fachlichen Richtungen wieder. Demnach stellt sich die Frage, warum wählen Männer und Frauen die Fachrichtungen und Berufe, die sie wählen.
Inwieweit die Sozialisation von Mädchen ein Indikator bei der Berufswahl ist, soll in dieser Arbeit näher erläutert werden. Dabei wird die aktuelle Situation sowohl des gesellschaftlichen und arbeitsmarktstrukturellen Umfelds, als auch der Stand der Forschung dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die weibliche Ausbildung und Berufswahl in Deutschland
- Schulische Qualifikation
- Berufswahl der Frauen und Segregation
- Sozialisationsprozess
- Geschlechtsspezifische Sozialisation von Mädchen
- Primäre Sozialisation
- Sekundäre Sozialisation
- Sozialisation als Ursache der Berufswahl
- Geschlechtsspezifische Sozialisation von Mädchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Frauen und Männer unterschiedliche Fachrichtungen und Berufe wählen. Dabei wird insbesondere der Einfluss der Sozialisation von Mädchen auf ihre Berufswahl untersucht. Die Arbeit analysiert die aktuelle Situation des gesellschaftlichen und arbeitsmarktstrukturellen Umfelds sowie den Stand der Forschung zum Thema.
- Schulische Qualifikation von Frauen und Männern
- Arbeitsmarktsegregation und geschlechtsspezifische Berufswahl
- Primäre und sekundäre Sozialisation von Mädchen
- Der Einfluss von Geschlechterrollen auf die Berufswahl
- Die Rolle von Institutionen wie Schule und Familie in der Sozialisation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Thematik. Sie verweist auf die geschlechterbezogene Verteilung von Studenten und die Notwendigkeit, die Ursachen für die geschlechtsspezifische Berufswahl zu untersuchen.
- Die weibliche Ausbildung und Berufswahl in Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die aktuellen Trends in der schulischen Qualifikation von Frauen und Männern in Deutschland. Es beleuchtet die Unterschiede in der Bildungserreichung und die daraus resultierenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zudem wird die Arbeitsmarktsegregation und die geschlechtsspezifische Berufswahl der Frauen beleuchtet.
- Sozialisationsprozess: In diesem Kapitel wird der Begriff der Sozialisation nach Durkheim und Hurrelmann erläutert und die Bedeutung der Primär- und Sekundärsozialisation für die Entwicklung von Interessen und Neigungen herausgearbeitet.
- Geschlechtsspezifische Sozialisation von Mädchen: Dieses Kapitel untersucht die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Sozialisation von Mädchen in der Familie (Primäre Sozialisation) und im Bildungssystem (Sekundäre Sozialisation). Es beleuchtet die Rolle von Eltern und Lehrkräften sowie die Darstellung von Frauen in Schulbüchern und deren Einfluss auf die Bildung von Geschlechterrollen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Sozialisation, Geschlechterrollen, Berufswahl, Arbeitsmarktsegregation, Bildung, Schulische Qualifikation und die aktuelle Situation der weiblichen Ausbildung in Deutschland. Weitere wichtige Begriffe sind: Familie, Schule, Institutionen, Geschlechterstereotypen, PISA-Studie und die Studien von Durkheim, Hurrelmann und Kohn.
Häufig gestellte Fragen
Warum wählen Frauen und Männer unterschiedliche Berufe?
Die Arbeit untersucht, inwieweit der Sozialisationsprozess und Geschlechterrollen die Berufswahl beeinflussen, trotz steigender Bildungsabschlüsse bei Frauen.
Was ist der Unterschied zwischen primärer und sekundärer Sozialisation?
Primäre Sozialisation findet in der Familie statt, während sekundäre Sozialisation durch Institutionen wie Schulen, Peers und Medien erfolgt.
Wie beeinflusst die Schule die geschlechtsspezifische Berufswahl?
Lehrkräfte, Schulbücher und die Interaktion im Unterricht können Geschlechterstereotypen festigen und somit das Interesse an bestimmten Fachrichtungen lenken.
Was bedeutet Arbeitsmarktsegregation?
Es beschreibt die Konzentration von Frauen und Männern in unterschiedlichen Berufsfeldern (horizontale Segregation) oder auf unterschiedlichen Hierarchieebenen (vertikale Segregation).
Welche Rolle spielen Eltern bei der Berufswahl ihrer Töchter?
Eltern vermitteln oft unbewusst traditionelle Rollenbilder und Erwartungen, die die Interessenentwicklung und das Vertrauen in eigene Fähigkeiten in "untypischen" Berufen prägen.
- Quote paper
- Sophia Neumann (Author), 2018, Inwieweit ist der Sozialisationsprozess ein Indikator in der Berufswahl von Frauen in Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/448984