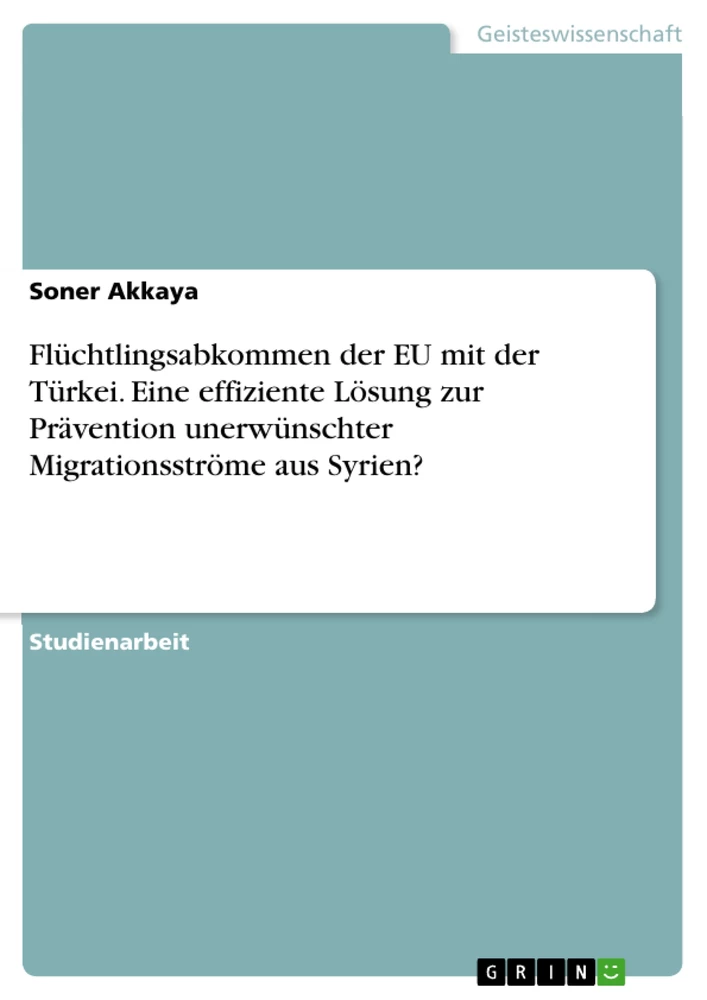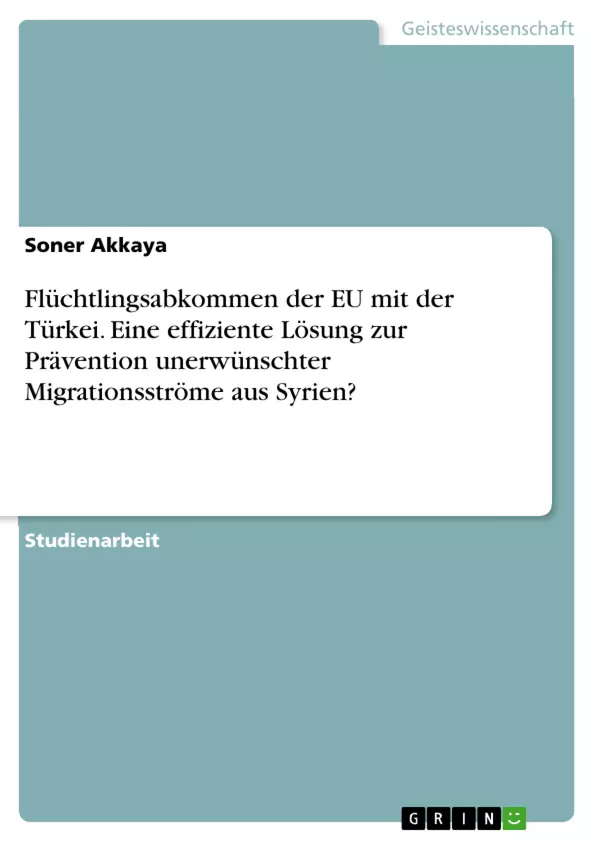Ziel dieser empirischen Proseminararbeit ist es gestützt auf die Sekundärliteratur und bestehende Daten von Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen UNHCR, ob das Flüchtlingsabkommen sein Ziel erfüllt und unerwünschte Migrationsströme aus Syrien in die EU verhindert. Dafür wird die Zahl der Asylanträge syrischer Staatsbürger/-innen vor und nach der Implementierung des Flüchtlingsabkommens in verschiedenen Staaten der Europäischen Union verglichen und graphisch dargestellt. Zusätzlich wird mithilfe der Befunde in der Literatur erläutert, ob es zu sogenannten Substitutionseffekten kam. Die eingegrenzte Fragestellung lautet wie folgt:
„Wie wirkungsorientiert ist das Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei zur Prävention unerwünschter Migrationsströme aus Syrien nach Europa?‘‘
Diese Fragestellung ist von wissenschaftlicher, sozialpolitischer und gesellschaftlicher Relevanz. Da das Thema zurzeit sehr aktuell und wenig erforscht ist, gibt es dazu nur beschränkte wissenschaftliche Literatur. Des Weiteren zeigt das Thema auf, wie die EU ihre Grenzen auf Drittstaaten ausweitet, um unerwünschte Flüchtlingsströme zu unterbinden, und dass Migration nicht nur im regionalem, sondern auch stärker im globalem Kontext abläuft.
Inhaltsverzeichnis
-
- Einleitung
- Ausgangs- und Problemlage
- Zielsetzung und Fragestellung
- Theoretische Grundlage
- Effektivität der Immigrationspolitik
- Externalisierung der Grenzen der EU
- EU-Türkei-Abkommen und ihre Wirkungen
- Inhalt der EU-Türkei-Abkommen
- Implementierung des Abkommens
- Wirkungen des Abkommens
- Zahl der Flüchtlingsströme aus Syrien in die EU
- Räumlicher Substitutionseffekt
- Schlissung der Balkanroute
- Schlussfolgerung
- Schlussfolgerung mit weiterführenden Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese empirische Proseminararbeit untersucht, ob das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei sein Ziel erreicht hat, unerwünschte Migrationsströme aus Syrien in die EU zu verhindern. Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Asylanträge syrischer Staatsbürger/-innen vor und nach der Implementierung des Abkommens in verschiedenen EU-Staaten. Zudem wird untersucht, ob es zu Substitutionseffekten kam, d. h. ob die Migration lediglich auf andere Routen verschoben wurde.
- Die Effektivität des EU-Türkei-Abkommens zur Prävention von Flüchtlingsströmen aus Syrien
- Die Auswirkungen des Abkommens auf die Zahl der Asylanträge in der EU
- Die Rolle der Türkei als Transitland für Flüchtlinge
- Die Externalisierung der EU-Grenzen
- Die Problematik von Substitutionseffekten im Zusammenhang mit Migrationspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Ausgangslage und die Zielsetzung der Proseminararbeit dar. Es beschreibt die Flüchtlingsströme aus Syrien in die EU und die damit verbundenen Herausforderungen. Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind. Es werden die Effektivität der Migrationspolitik und die Externalisierungspolitik der EU erörtert. Das dritte Kapitel analysiert das EU-Türkei-Abkommen und seine Auswirkungen. Es werden die Inhalte des Abkommens, seine Implementierung sowie die Auswirkungen auf die Zahl der Flüchtlingsströme und die Nutzung anderer Migrationsrouten betrachtet.
Schlüsselwörter
Flüchtlingsabkommen, EU, Türkei, Syrien, Migrationsströme, Asylanträge, Externalisierung, Substitutionseffekt, Effektivität, Migrationspolitik, Vergleichende Migrationspolitik in Europa
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens?
Das Ziel ist die Prävention unerwünschter Migrationsströme aus Syrien nach Europa durch die Kooperation mit der Türkei als Transitland.
Was bedeutet "Externalisierung der Grenzen"?
Es beschreibt die Strategie der EU, Grenzkontrollen und Flüchtlingsmanagement auf Drittstaaten außerhalb der Union zu übertragen.
Was ist ein "Substitutionseffekt" bei der Migration?
Ein Substitutionseffekt tritt auf, wenn durch die Schließung einer Route (z. B. Balkanroute) Flüchtlinge auf andere, oft gefährlichere Wege ausweichen.
Wie wirkungsvoll ist das Abkommen laut der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Asylantragszahlen vor und nach der Implementierung, um die tatsächliche Reduktion der Flüchtlingsströme zu bewerten.
Welche Rolle spielt die Türkei in diesem Abkommen?
Die Türkei fungiert als Pufferstaat, der Flüchtlinge aufnimmt und im Gegenzug finanzielle Unterstützung sowie politische Zugeständnisse von der EU erhält.
- Citation du texte
- Soner Akkaya (Auteur), 2017, Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei. Eine effiziente Lösung zur Prävention unerwünschter Migrationsströme aus Syrien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449080