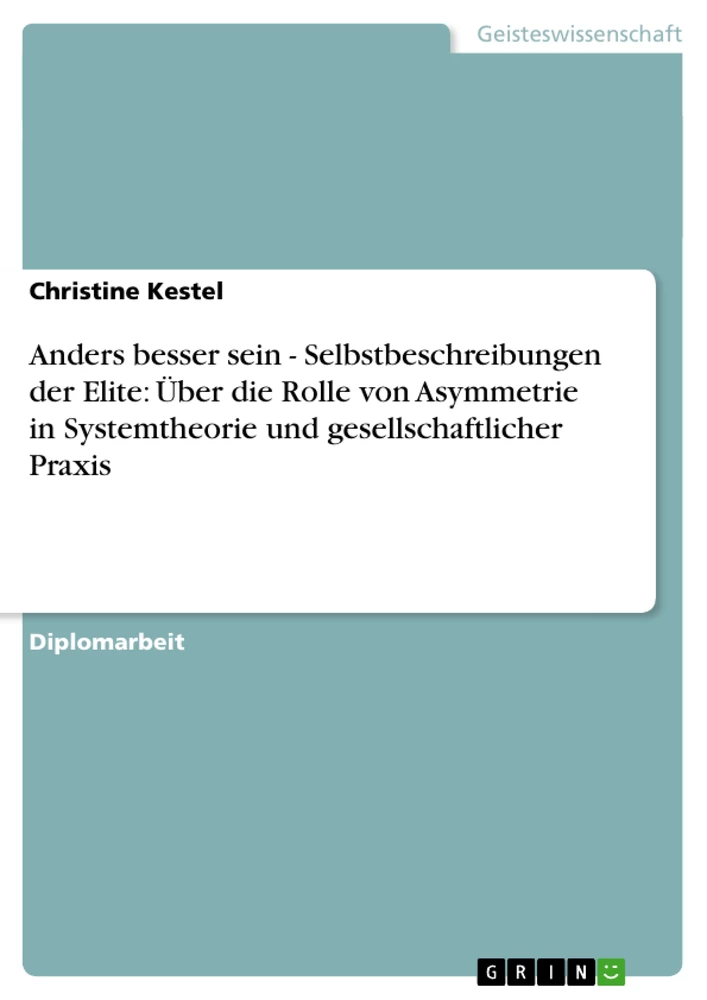Mit der Forderung und dem Programmtitel „Elite für alle“ betritt der Kabarettist Frank Lüdecke in diesem Herbst die Bühne, um Stellung zu einem gesellschaftlichen Phänomen zu nehmen:
„Sie wissen, in Deutschland haben wir ja keine Elite mehr. Leider. Es gibt da zwei Theorien: Die einen sagen, unsere Elite musste ´33 nach Amerika emigrieren. Die anderen sagen, sie musste nach ´45 in Deutschland untertauchen...“ Dieses Kabarett greift eine Tendenz auf. Der Elitebegriff kommt in den letzten Jahren in Deutschland zunehmend häufig vor - in Medien, öffentlichen und privaten Diskussionen und wissenschaftlichen Texten. Das ist spannend, denn:„Es ist keineswegs zufällig, wann bestimmte Themen und Begriffe der Soziologie aktuell werden, wann sie in die Sprache des Alltags eindringen oder aus ihr wieder verschwinden, um erneut eine scheinbar bloß wissenschaftliche Angelegenheit zu werden.“ (Lenk 1982, 29)
Woher kommt diese Prominenz des Themas Elite? Es scheint doch für die Sichtbarkeit der Elite immer noch zu gelten, was Theodor Adornos berühmter Ausspruch, „Elite mag man in Gottes Namen sein, niemals darf man sich als solche fühlen“, beschreibt und was Roswita Königswieser für die Gegenwart formuliert:„Wer wirklich Elite ist, spricht nicht davon. Und fühlt sich auch nicht so. Wirkliche Elite sind Leute, die’s einfach sind. Die entsprechende Werte haben und sie leben. Das liegt daran, dass diese Menschen eine Kombination von Gestaltungs-, Macht- und Wertvorstellungen haben. Sie haben eine bestimmte Art von Bescheidenheit und Demut, weil sie wissen, es gibt noch andere, die gut sind, und es gibt vieles, das sie nicht können oder wissen.“
Unter Umständen tauchen die Forderungen nach Elite als Folge der Diagnose eines Werteverfalls auf. Diese wird in Feuilletons und an Stammtischen gleichermaßen getroffen und über Elite wird als Stopp-Option des Werteverfalls verhandelt.
„Wir haben also kein Wertevakuum, sondern ein Vakuum an Institutionen, die Werte vertreten.“ Ist den Menschen in der Multioptionsgesellschaft die Orientierung abhanden gekommen? Fehlt es an Leitbildern, die als Vorbilder Entscheidungen vorstrukturieren und damit erleichtern?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Die Elite gibt es nicht.
- 1.2. Elite gibt es.
- 1.3. Fragen, Ziele und Aufbau dieser Arbeit.
- 2. Diagnose: Funktional differenzierte Gesellschaft – Theoretische Grundlagen
- 2.1. Differenzierung - Diagnose eines Problems
- 2.1.1. Emile Durkheim: Arbeitsteilung und Solidarität.
- 2.1.2. Talcott Parsons: Integration als Funktion des AGIL-Schemas.
- 2.2. Differenzierung – Diagnose eines Zustands.
- 2.2.1. Was meint funktionale Differenzierung?
- 2.2.2. Die Frage nach dem Ganzen - Integration der Gesellschaft.
- 2.2.3. Die Frage nach dem Menschen - Inklusion statt Integration.
- 2.2.4. Sollte es nicht doch eine Integrationsinstanz geben?
- 2.3. Asymmetrien und ihre Folgen - Stichwort Elite.
- 3. „Ein weites Feld“ - Der Elitebegriff
- 3.1. Begriffsbestimmungen
- 3.1.1. Definitionsvielfalt in der Geschichte des Begriffs.
- 3.1.2. Bindestriche als Lösung.
- 3.1.3. Ein kleinster gemeinsamer Nenner.
- 3.2. Elite und Demokratie - eine Gegenüberstellung
- 3.2.1. Widerspruch.
- 3.2.2. Gleichklang, beinahe.
- 3.2.3. Sonderfall Deutschland.
- 3.3. Elite als flexible Übersetzer
- 3.3.1. Übersetzungskompetenz durch Erfahrung in mehreren Systemen.
- 3.3.2. Übersetzen im Horizont souveräner Kommunikation.
- 4. Selbstbeschreibungen der Elite - Das Untersuchungskonzept
- 4.1. Was wird untersucht? Gegenstand und Fragen.
- 4.2. Wie wird untersucht? Theoretische und methodische Grundlagen
- 4.2.1. Biographien im Blick der Systemtheorie.
- 4.2.2. Die Deutungsmusteranalyse.
- 4.2.3. Bourdieu und die Illusio.
- 4.3. Wie wurde untersucht? - Der Untersuchungsablauf
- 4.3.1. Auswahl und Rekrutierung der Interviewpartner.
- 4.3.2. Art des Interviews und Entwicklung der Interviewleitfäden.
- 4.3.3. Durchführung der Interviews.
- 4.3.4. Methode der Auswertung.
- 5. Auswertung
- 5.1. „Man muss es halt einfach machen.“ – Selbstbeschreibungen über Leistung und Eigeninitiative
- 5.1.1. Leistungsbereitschaft beweisen - Die Illusio der Erzählungen.
- 5.1.2. Die anderen müssen sich nur auch bemühen – die systemtheoretische Perspektive.
- 5.2. „Eine wunderbare Chance, die man hat.“– Schicksal und Glück als Muster der Selbstbeschreibung
- 5.2.1. Selbstfindung als geglückter Prozess - die Illusio der Erzählungen.
- 5.2.2. Wir sind alle Individuen, frei und gleich – die systemtheoretische Perspektive.
- 5.3. „Trotzdem hast du auch ne Gaußsche Normalverteilung bei der Intelligenz.“ – Naturalisierung über Intelligenz und Begabung.
- 5.3.1. Begabung als Schlüssel – die Illusio der Erzählungen.
- 5.3.2. Ansprüche an sich selbst und auch an andere stellen - die systemtheoretische Perspektive.
- 5.4. Zwanzig Jahre später- Analyse der Interviews mit Berufstätigen
- 5.4.1. Visionen verwirklichen - die Illusio der Erzählungen.
- 5.4.2. Entwickelt mehr Visionen! – die systemtheoretische Perspektive.
- 6. Zusammenfassung der Ergebnisse
- 6.1. Begründungen der Asymmetrie.
- 6.2. Über den Umgang mit der Asymmetrie.
- 6.3. Welche Wege führen nach oben? Entscheidend ist, mit leichtem Gepäck zu reisen.
- 6.4. Welches Bild von Elite steckt in den Interviews?
- 6.5. Ist der Zweifel eine weibliche Kategorie?
- 7. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Elitebegriff in der funktional differenzierten Gesellschaft und analysiert Selbstbeschreibungen von Angehörigen der Elite. Ziel ist es, die Rolle von Asymmetrien in der gesellschaftlichen Praxis zu beleuchten und verschiedene Perspektiven auf den Elitebegriff zu vergleichen.
- Der Elitebegriff in der soziologischen Theorie
- Selbstbeschreibungen von Elitemitgliedern
- Asymmetrien und ihre Bedeutung für die gesellschaftliche Ordnung
- Leistung, Glück und Begabung als Faktoren des Erfolgs
- Die Rolle von Individuen in der funktional differenzierten Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die aktuelle Relevanz des Elitebegriffs in Deutschland diskutiert und die Forschungsfrage formuliert. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf Elite, von der Leugnung ihres Bestehens bis hin zur Notwendigkeit von Eliten als Träger von Werten in einer multioptionalen Gesellschaft. Die Einleitung verknüpft die populäre Diskussion um den Elitebegriff mit den soziologischen Fragestellungen, welche die Arbeit zu beantworten sucht.
2. Diagnose: Funktional differenzierte Gesellschaft – Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen der Arbeit. Es diskutiert die funktional differenzierte Gesellschaft nach Luhmann, analysiert die Konzepte von Durkheim (Arbeitsteilung und Solidarität) und Parsons (Integration als Funktion des AGIL-Schemas) und untersucht den Zusammenhang zwischen Differenzierung, Integration und Asymmetrien, die letztendlich die Existenz einer Elite begründen. Die zentrale Frage nach der Integration und der Rolle von Inklusion wird im Kontext der Systemtheorie verhandelt.
3. „Ein weites Feld“ - Der Elitebegriff: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit verschiedenen Definitionen des Elitebegriffs, von historischen Perspektiven bis hin zu einer aktuellen, pragmatischen Definition. Es analysiert den Elitebegriff im Kontext von Demokratie und beschreibt die Herausforderungen, die sich aus der Vielfalt an Definitionen ergeben. Insbesondere wird die Metapher der Elite als "flexible Übersetzer" eingeführt und erläutert. Die verschiedenen Definitionen werden kritisch gewürdigt und miteinander in Beziehung gesetzt.
4. Selbstbeschreibungen der Elite - Das Untersuchungskonzept: Das Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung. Es erläutert das verwendete qualitative Forschungsdesign, die Auswahl und Rekrutierung der Interviewpartner sowie die Durchführung und Auswertung der Interviews. Die theoretischen Grundlagen der verwendeten Methoden, wie die Biographien im Blick der Systemtheorie, die Deutungsmusteranalyse und Bourdieus Konzept der Illusio, werden detailliert dargestellt. Der methodische Ansatz wird begründet und seine Eignung für die Forschungsfrage dargelegt.
5. Auswertung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Auswertung der Interviews. Es analysiert die Selbstbeschreibungen der Interviewpartner in Bezug auf Leistung, Glück, Begabung und die Entwicklung ihrer Karriere. Die Ergebnisse werden systemtheoretisch interpretiert. Dabei werden die Muster der Erzählungen ("Illusionen") und die systemischen Perspektiven auf die beschriebenen Phänomene detailliert dargestellt und miteinander verknüpft.
6. Zusammenfassung der Ergebnisse: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Bedeutung der gefundenen Zusammenhänge. Es werden die Begründungen für Asymmetrien in der Gesellschaft analysiert und deren Auswirkungen auf den Umgang mit der Elite beleuchtet. Die Analyse des in den Interviews erkennbaren Bildes von Elite und die Frage nach der Rolle von Zweifel werden diskutiert. Dieser Abschnitt bereitet die Schlussfolgerungen der Arbeit vor.
Schlüsselwörter
Elite, Funktional Differenzierte Gesellschaft, Systemtheorie, Asymmetrie, Selbstbeschreibung, Interview, Qualitative Forschung, Leistung, Glück, Begabung, Illusio, Integration, Inklusion, Soziale Ungleichheit, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Elite in der funktional differenzierten Gesellschaft"
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Elitebegriff in der funktional differenzierten Gesellschaft und analysiert, wie Angehörige der Elite sich selbst beschreiben. Im Fokus steht die Rolle von Asymmetrien in der Gesellschaft und der Vergleich verschiedener Perspektiven auf den Elitebegriff.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Systemtheorie Luhmanns, integriert Konzepte von Durkheim (Arbeitsteilung und Solidarität) und Parsons (AGIL-Schema) und untersucht den Zusammenhang zwischen Differenzierung, Integration und Asymmetrien. Die Frage nach Integration und Inklusion wird im systemtheoretischen Kontext diskutiert.
Wie ist der Elitebegriff definiert?
Die Arbeit analysiert die vielfältigen Definitionen des Elitebegriffs, von historischen Perspektiven bis zu einer pragmatischen, aktuellen Definition. Der Elitebegriff wird im Kontext von Demokratie betrachtet, und die Metapher der Elite als "flexible Übersetzer" wird eingeführt und erläutert.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde ein qualitatives Forschungsdesign mit Interviews verwendet. Die Arbeit beschreibt detailliert die Auswahl der Interviewpartner, die Durchführung und Auswertung der Interviews. Die theoretischen Grundlagen der verwendeten Methoden (Biographien im Blick der Systemtheorie, Deutungsmusteranalyse und Bourdieus Konzept der Illusio) werden erläutert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Auswertung der Interviews analysiert Selbstbeschreibungen der Interviewpartner bezüglich Leistung, Glück, Begabung und Karriereentwicklung. Die Ergebnisse werden systemtheoretisch interpretiert, wobei die Muster der Erzählungen ("Illusionen") und die systemischen Perspektiven dargestellt und verknüpft werden.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen, analysiert die Begründungen für Asymmetrien und deren Auswirkungen auf den Umgang mit der Elite. Das in den Interviews erkennbare Bild von Elite wird analysiert, ebenso die Rolle von Zweifel. Die Schlussfolgerungen beleuchten die Begründungen der Asymmetrie und den Umgang damit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Elite, Funktional Differenzierte Gesellschaft, Systemtheorie, Asymmetrie, Selbstbeschreibung, Interview, Qualitative Forschung, Leistung, Glück, Begabung, Illusio, Integration, Inklusion, Soziale Ungleichheit, Deutschland.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen (funktionale Differenzierung), Der Elitebegriff, Untersuchungskonzept und Methodik, Auswertung der Interviews, Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlusswort.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und die verschiedenen Perspektiven auf den Elitebegriff darstellt. Es folgt ein Kapitel mit den theoretischen Grundlagen, dann die Auseinandersetzung mit dem Elitebegriff selbst, die Beschreibung der Methodik, die Auswertung der Interviews, die Zusammenfassung der Ergebnisse und schließlich ein Schlusswort.
- Quote paper
- Christine Kestel (Author), 2004, Anders besser sein - Selbstbeschreibungen der Elite: Über die Rolle von Asymmetrie in Systemtheorie und gesellschaftlicher Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44957