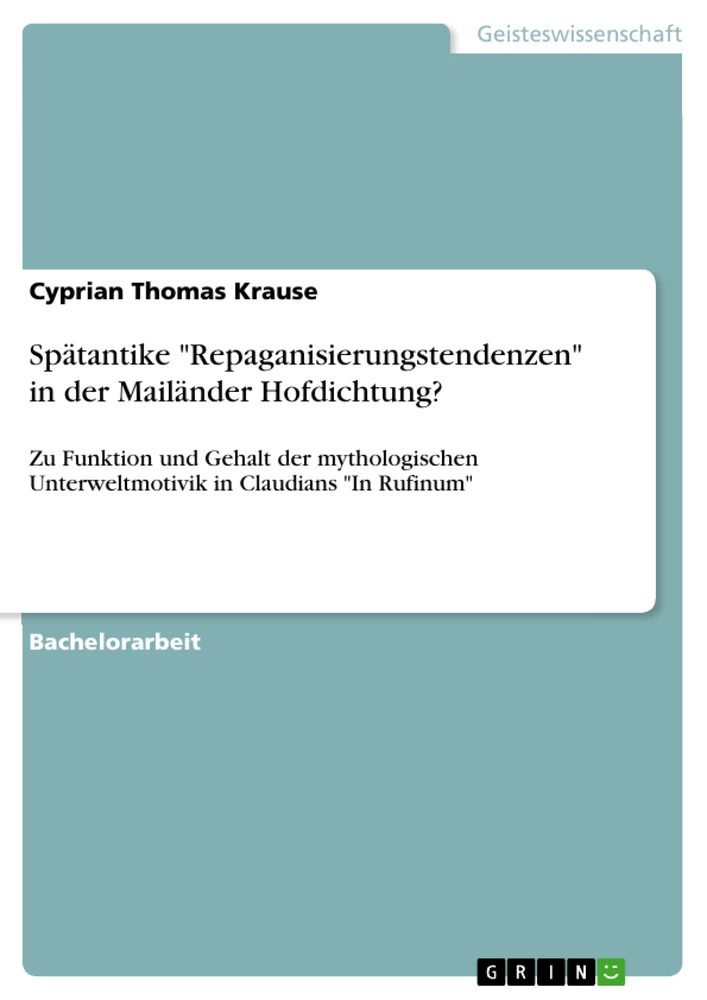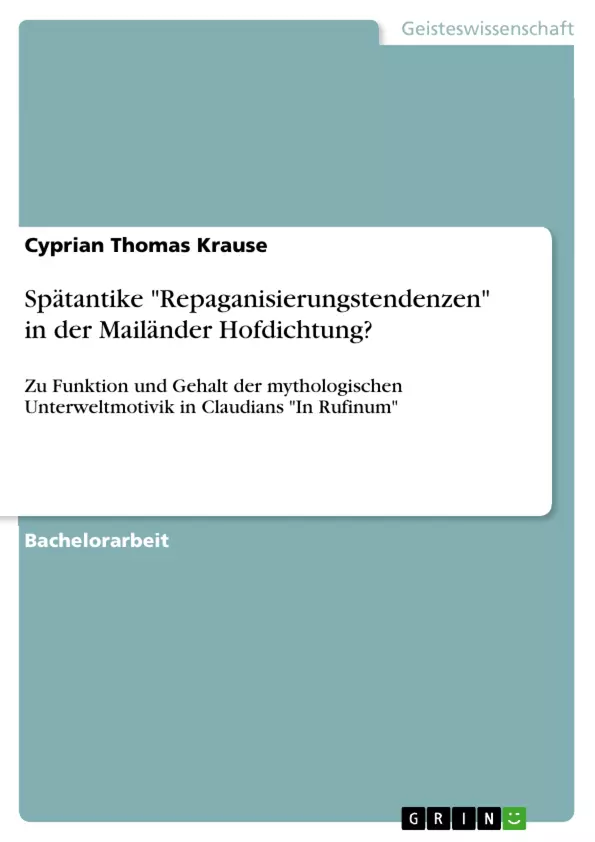Claudius Claudianus gilt als der berühmteste spätlateinische Dichter an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert. Er wirkte am Mailänder Kaiserhof unter Theodosius und Honorius und erfreute sich der besonderen Protektion des "magister utriusque militiae" Flavius Stilicho. Die beiden zeitgeschichtlich-politischen Invektiven gegen den 395 n. Chr. in Konstantinopel ermordeten Rufinus, der unter Kaiser Arkadios die Geschicke von Ostrom bestimmte, bedienen sich einer opulenten mythologischen Unterweltmotivik, die aus der gesamten lateinischen und griechischen Tradition schöpft und intertextuelle Anspielungen auf Vergils Aeneis, Senecas Apocolocyntosis sowie die Thebais von Statius enthält. Rufin wird vom Dichter u.a. als eine "Ausgeburt der Hölle" sowie als Ziehsohn der Erinnyen dargestellt, die ihn nach Konstantinopel senden, um den Frieden im Römischen Reich zu untergraben. Am Ende des zweiten Buches wird Rufin von empörten Soldaten ermordet und dem Totengericht von Minos, Rhadamanthys und Aiacus überantwortet.
Die vorliegende Studie widmet sich einer genauen poetologischen Untersuchung der narrativen Funktion der mythologischen Unterweltmotivik bei der Darstellung zeitgenössischer Personen. Kritisch diskutiert wird dabei u. a. die verbreitete These, Claudian habe durch die literarische Wiederbelebung der paganen Mythologie eine Repaganisierungspolitik gegen ein mehrheitlich christliches Umfeld vertreten. Demgegenüber kann jedoch gezeigt werden, daß für Claudian das intertextuelle Spiel mit klassisch-paganen Mythologemen vielmehr eine rhetorisch wirksame Hintergrundfolie bietet, vor der sich die Zeitgeschichte um so wirkungsvoller abhebt. Dabei kommt v.a. das rhetorische Schema der Überbietung zum Zuge: Rufin erscheint als historische Person schlimmer als alle Bösewichter der klassischen Mythologie zusammen, sein Gegenspieler Stilicho (der Mäzen des Künstlers) erscheint umgekehrt als Inbegriff der Tugenden, der die antiken Helden wie Herakles, Perseus etc. noch übertrifft. Claudian erreicht durch die reizvollen Durchblicke zwischen Mythos und Politik eine rhetorische effektvolle Inszenierung - abgesehen davon, daß es für den gebildeten Leser ein Genuß war, die claudianische Verfremdung seiner literarisch-mythologischen Vorbilder zu dechiffrieren. Die vorliegende Arbeit diskutiert zur argumentativen Untermauerung die wichtigsten und neuesten Studien aus der Sekundärliteratur zu Claudian.
Inhaltsverzeichnis
- Prolegomena
- a) Fragestellung: Dient die mythologische Motivik in Claudians Dichtung dem Anliegen einer kulturellen Repaganisierung?
- b) Motivgeschichtlicher Gehalt, intertextuelle Bezüge und erzähltechnisch-poetische Funktion der Unterweltmotivik - in den beiden Büchern In Rufinum – Divergenz oder Konvergenz?
- c) Zur Methode und zum Aufbau dieser Untersuchung
- Kapitel 1: (Un-)Einheitlichkeit, Gattung und Stil von Ruf. 1 und 2.
- a) Argumente für die (Un-)Einheitlichkeit der beiden Rufinbücher.
- b) Zur Gattung
- c) Zum Stil und zur Erzähltechnik.
- Kapitel 2: Die Unterweltmotivik in Ruf. 1
- a) Rufin als neuer Python (pr.Ruf. 1).
- b) Das concilium deforme der Furien (Ruf. 1,25–122).
- c) Megaera als Instigatrix ihres Ziehsohnes Rufin (Ruf. 1,123–175).
- d) Megaera als Gegenspielerin zu Iustitia (Ruf. 1,354–387).
- Kapitel 3: Die Unterweltmotivik in Ruf. 2
- a) Das Fehlen jeglicher Unterweltmotivik in Ruf. 2,1–455 sowie der prognostische Traum Rufins (Ruf. 2,327-335).
- b) Die Katabasis Rufins in die Unterwelt (Ruf. 2,454–465).
- c) Das Totengericht (Ruf. 2,466–Schluß)
- d) Rufins Ausweisung aus der Unterwelt (Ruf. 2,520–527)
- Kapitel 4: Die Verzahnung der Rufin-Gestalt des liber alter mit den Furien des liber prior.
- a) Zur Möglichkeit eines metaphorical twist zwischen den Furien und den epischen Akteuren...
- b) Inhaltliche Übereinstimmungen zwischen den Furiae in Buch I und Rufin in Buch II
- c) Strukturelle Bezüge zwischen den Furiae im liber prior und Rufin im liber alter..
- Kapitel 5: Sinngehalte und Funktionen der Unterweltmotivik in den Rufinbüchern......
- a) Kein theologisch-metaphysischer Gehalt der Unterweltmotivik.
- b) Keine vorrangig apologetische Funktion der Unterweltmotivik
- c) Die allegorische und narratologische Funktion der Unterweltmotivik..
- d) Die Geschichte übertrifft den Mythos (Ruf. 1,283: taceat superata vetustas)· und macht die Furien überflüssig (vgl. Theb. 11,537: nec iam opus est furiis)........
- e) Die produktionsästhetische und metapoetische Funktion der Unterweltmotivik …....
- f) Rezeptionsästhetische Dimensionen der Unterweltmotivik bei Claudian.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Untersuchung befasst sich mit der Frage, ob die mythologische Motivik in Claudians Dichtung dem Anliegen einer kulturellen Repaganisierung dient. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Unterweltmotivik in Claudians Invektiven gegen Rufin, um herauszufinden, welche Funktionen und Dynamiken sich hinter der Verwendung dieser mythologischen Elemente verbergen.
- Analyse der Funktion der Unterweltmotivik in Claudians Invektiven gegen Rufin
- Untersuchung der intertextuellen Bezüge der Unterweltmotivik
- Bewertung des motivgeschichtlichen Gehaltes der Unterweltmotivik
- Beurteilung der Repaganisierungstendenzen in Claudians Dichtung
- Deutung der narratologischen, rhetorischen und politisch-propagandistischen Funktionen der Unterweltmotivik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage formuliert, den methodischen Ansatz erläutert und einen Überblick über den Aufbau der Untersuchung gibt. Anschließend widmet sich Kapitel 1 der Analyse der Einheitlichkeit, Gattung und des Stils der beiden Invektiven gegen Rufin. Im zweiten Kapitel werden die Unterweltmotive im ersten Buch gegen Rufin untersucht, während Kapitel 3 die Unterweltmotivik im zweiten Buch beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der Verzahnung der Figur Rufin im zweiten Buch mit den Furien im ersten Buch. Schließlich analysiert Kapitel 5 die Sinngehalte und Funktionen der Unterweltmotivik in den beiden Invektiven, wobei die Frage nach einer möglichen Repaganisierungstendenz im Zentrum steht.
Schlüsselwörter
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Unterweltmotivik in Claudians Invektiven gegen Rufin und befasst sich mit den Themen Repaganisierung, mythologische Motivik, intertextuelle Bezüge, narratologische Funktion, politisch-propagandistische Funktion, Gattungszuordnung und Stilanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Claudius Claudianus?
Claudian war der bedeutendste spätlateinische Dichter am Mailänder Hof um 400 n. Chr., der unter dem Schutz des Heermeisters Stilicho stand.
Verfolgte Claudian eine "Repaganisierungspolitik"?
Die Studie diskutiert diese These kritisch und kommt zu dem Schluss, dass die pagane Mythologie bei ihm eher als rhetorische Folie diente, um Zeitgeschichte effektvoll zu inszenieren.
Wie wird die Figur des Rufinus in der Dichtung dargestellt?
Rufin wird als "Ausgeburt der Hölle" und Ziehsohn der Furien gezeichnet, der am Ende dem Totengericht der Unterwelt überantwortet wird.
Was ist die Funktion der Unterweltmotivik in seinen Invektiven?
Die Motive dienen der allegorischen Übersteigerung: Rufin erscheint schlimmer als mythische Bösewichter, während sein Gegner Stilicho antike Helden an Tugend übertrifft.
Welche intertextuellen Bezüge nutzt Claudian?
Seine Dichtung schöpft aus der Tradition von Vergils Aeneis, Senecas Apocolocyntosis und der Thebais von Statius, um beim gebildeten Leser Dechiffrierfreude zu wecken.
- Citation du texte
- Cyprian Thomas Krause (Auteur), 2017, Spätantike "Repaganisierungstendenzen" in der Mailänder Hofdichtung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449816