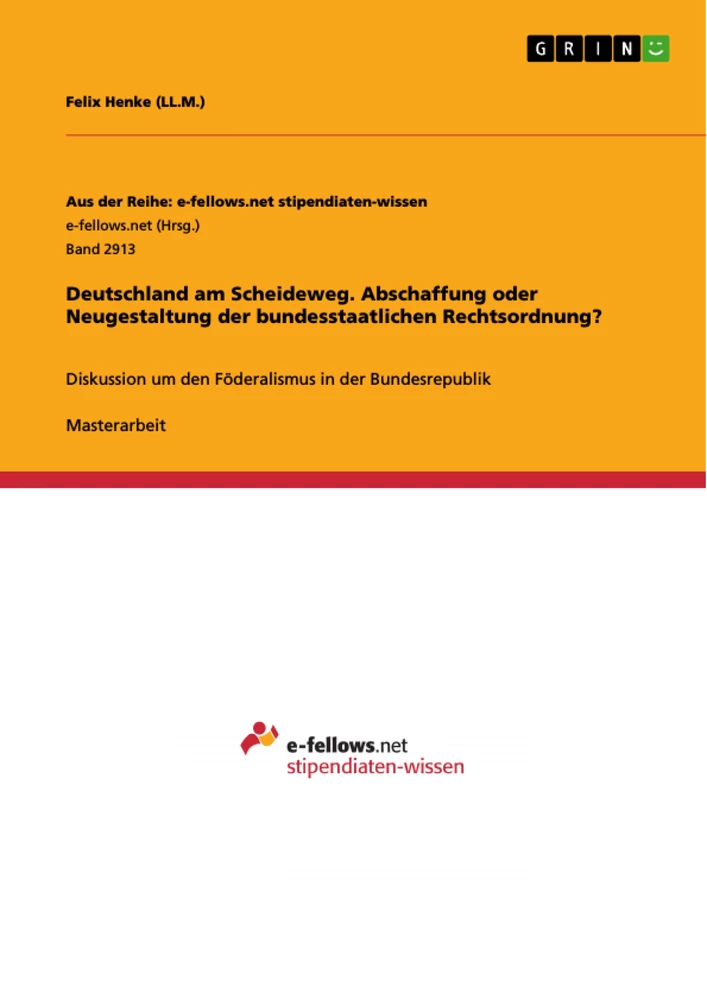Viele deutsche Bundesbürger sind auf emotionale und räumliche Art mit ihrer Heimat verbunden. Die Niedersachsen kennen ihre Landeshauptstadt Hannover. Bei Bundesligaheimspielen der Hertha sorgt die Landespolizei von Berlin für Recht und Ordnung. Die Hamburger sehen auf mancher Zwei-Euro-Sonderprägung ihren Michel. Im Nachrichtenprogramm der Dritten gibt es lokale Berichte aus Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen. Auf Landesgrenzen überschreitenden Bundesautobahnen heißen Schilder Autofahrer „Herzlich Willkommen“. In den 16 Ländern werden in unterschiedlichem Ausmaß eigene Geschichten, Identitäten, Kulturen, Leibspeisen sowie sogar Sprachen und Dialekte gepflegt. Dadurch fühlt sich ein Großteil der Deutschen weitaus mehr zu seiner regionalen Lebenswelt hingezogen, als wenn es diese Besonderheiten nicht gäbe. Doch was steckt juristisch und politisch hinter diesem Phänomen?
Methodisch wird dabei größtenteils auf die Literatur- und Dokumentenanalyse zurückgegriffen. Im Übrigen erfolgt ebenso eine quantitative Methodik, indem Antworten von drei Bundestagsabgeordneten verschiedenster politischer Einstellungen aus einem selbst erstellten Fragenkatalog verwendet werden.
Beginnend mit der historischen Entwicklung, in der die wichtigsten, thematisch relevanten Ereignisse der jüngeren Zeitgeschichte aufgezeigt werden, ist die weitere Vorgehensweise chronologischer Natur. Im Zentrum der Darstellung stehen die drei Föderalismusreformen aus dem Jahre 2006, von 2009 und aus dem Sommer des letzten Jahres. Um eine Vergleichbarkeit der Regelungsgehalte und Veränderungsausmaße zu schaffen, werden jeweils die Gründe und Ziele, Inhalte, Kritiken sowie die Auswirkungen analog zueinander beleuchtet.
In einem etwas separat zu betrachtenden Kapitel soll der Blick über die Landesgrenzen hinaus sowohl auf unsere unmittelbaren europäischen Nachbarn als auch auf weitere Staaten dieser Welt gehen, damit anhand einzelner Problempunkte deutlich wird, wie andere mit diesen umgehen und wie Deutschland davon lernen kann. Nachdem zuvor eine Gesamtwürdigung stattgefunden hat und die Forschungsfrage beantwortet wurde, wird nicht nur ein Blick in die Zukunft gewagt, sondern werden auch gezielte Handlungsempfehlungen vorgeschlagen. Zur besseren Nachverfolgung sämtlicher in der Masterarbeit erläuterter Umgestaltungen und noch einiger mehr dient die im Anhang befindliche Synopse der Reformen zum einen der Arbeitserleichterung und bildet zum anderen ein abrundendes Element aus.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Historie
- C. Föderalismusreform I (2006)
- I. Gründe und Ziele
- II. Inhalte / Veränderungen
- 1. Korrektur der Zustimmungsrechte
- 2. Neuverteilung der Gesetzgebungskompetenzen
- 3. Bundesstaatliche Lastenverteilung
- 4. Mischfinanzierung
- 5. Hauptstadtfrage und Europatauglichkeit
- 6. Weitere Aspekte
- III. Kritik
- IV. Auswirkungen
- D. Föderalismusreform II (2009)
- I. Gründe und Ziele
- II. Inhalte / Veränderungen
- 1. Schuldenbremse und Konsolidierungshilfen
- 2. Ausnahmefälle: Naturkatastrophen und Notlagen
- 3. Stabilitätsrat
- 4. Zusammenwirken in der Informationstechnologie
- III. Kritik
- IV. Auswirkungen
- E. Föderalismusreform III (2017)
- I. Gründe und Ziele
- II. Inhalte / Veränderungen
- 1. Bund-Länder-Finanzbeziehungen
- 2. Finanzhilfen für die kommunale Bildungsinfrastruktur
- 3. Digitalisierung der Verwaltung
- 4. Infrastrukturgesellschaft für die Bundesautobahnen
- 5. Weitere Aspekte
- III. Kritik
- IV. Zukunftsperspektiven
- IIF. Lösungsansätze aus anderen Staaten
- G. Schlussbetrachtung
- I. Gesamtwürdigung mit Beantwortung der Forschungsfrage
- II. Ausblick / Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Entwicklung und den Herausforderungen des deutschen Föderalismus im Kontext von Reformbemühungen.
- Analyse der Historie und Entwicklung des deutschen Föderalismus
- Bewertung der drei großen Föderalismusreformen von 2006, 2009 und 2017
- Untersuchung der Auswirkungen der Reformen auf die Kompetenzverteilung, Finanzbeziehungen und Funktionsfähigkeit des Bundesstaates
- Diskussion von Kritikpunkten und Lösungsansätzen aus anderen Staaten
- Beantwortung der Forschungsfrage nach der Zukunft des deutschen Föderalismus.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Zukunft des deutschen Föderalismus und die Relevanz der Thematik im Kontext der aktuellen politischen Debatten dar. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Historie: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklung des deutschen Föderalismus und die wichtigsten Stationen seiner Ausgestaltung.
- Föderalismusreform I (2006): Dieser Abschnitt analysiert die erste große Föderalismusreform aus dem Jahr 2006. Er betrachtet die Gründe und Ziele der Reform sowie die wichtigsten Inhalte und Veränderungen. Die Kritik an der Reform sowie deren Auswirkungen auf die Kompetenzverteilung, Finanzbeziehungen und die Funktionsfähigkeit des Bundesstaates werden ebenfalls beleuchtet.
- Föderalismusreform II (2009): Das Kapitel behandelt die zweite große Föderalismusreform von 2009. Es analysiert die Gründe und Ziele der Reform, ihre Inhalte, die Kritikpunkte und deren Auswirkungen.
- Föderalismusreform III (2017): Dieses Kapitel untersucht die dritte große Föderalismusreform aus dem Jahr 2017. Es beleuchtet die Gründe und Ziele der Reform, ihre Inhalte, die Kritikpunkte und die Zukunftsperspektiven.
- Lösungsansätze aus anderen Staaten: Das Kapitel stellt verschiedene Modelle des Föderalismus aus anderen Staaten vor und diskutiert deren Übertragbarkeit auf das deutsche System.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit befasst sich mit den zentralen Aspekten des deutschen Föderalismus. Im Fokus stehen die Kompetenzverteilung, die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, die Funktionsfähigkeit des Bundesstaates und die Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen Einheit und Vielfalt ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Ziele der Föderalismusreform I (2006)?
Ziele waren die Entflechtung der Gesetzgebungskompetenzen von Bund und Ländern sowie die Reduzierung der zustimmungsbedürftigen Gesetze im Bundesrat.
Was beinhaltet die Schuldenbremse der Reform von 2009?
Die Schuldenbremse begrenzt die Neuverschuldung von Bund und Ländern, um die langfristige Stabilität der öffentlichen Finanzen zu sichern.
Welche Neuerungen brachte die Föderalismusreform III (2017)?
Wichtige Punkte waren die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, Finanzhilfen für kommunale Bildung und die Gründung der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen.
Warum identifizieren sich Deutsche so stark mit ihren Bundesländern?
Die Identität wird durch regionale Kulturen, Dialekte, eigene Identitäten und die lokale politische Gestaltungsmacht in den 16 Ländern geprägt.
Wie wirkt sich die Digitalisierung auf den Föderalismus aus?
Die Reformen zielen auf ein besseres Zusammenwirken in der Informationstechnologie ab, um die Verwaltung länderübergreifend zu modernisieren.
Kann Deutschland von föderalen Modellen anderer Staaten lernen?
Die Arbeit analysiert Lösungsansätze aus dem Ausland, um die Funktionsfähigkeit des deutschen Bundesstaates in Krisenzeiten oder bei Finanzfragen zu verbessern.
- Citar trabajo
- Felix Henke (LL.M.) (Autor), 2018, Deutschland am Scheideweg. Abschaffung oder Neugestaltung der bundesstaatlichen Rechtsordnung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/449905