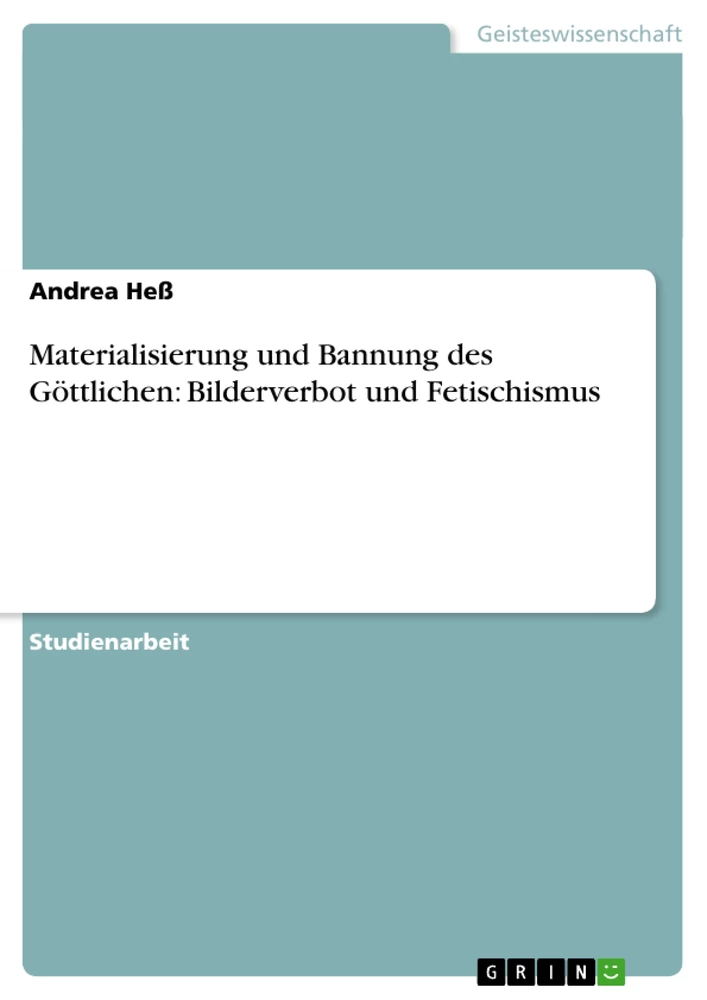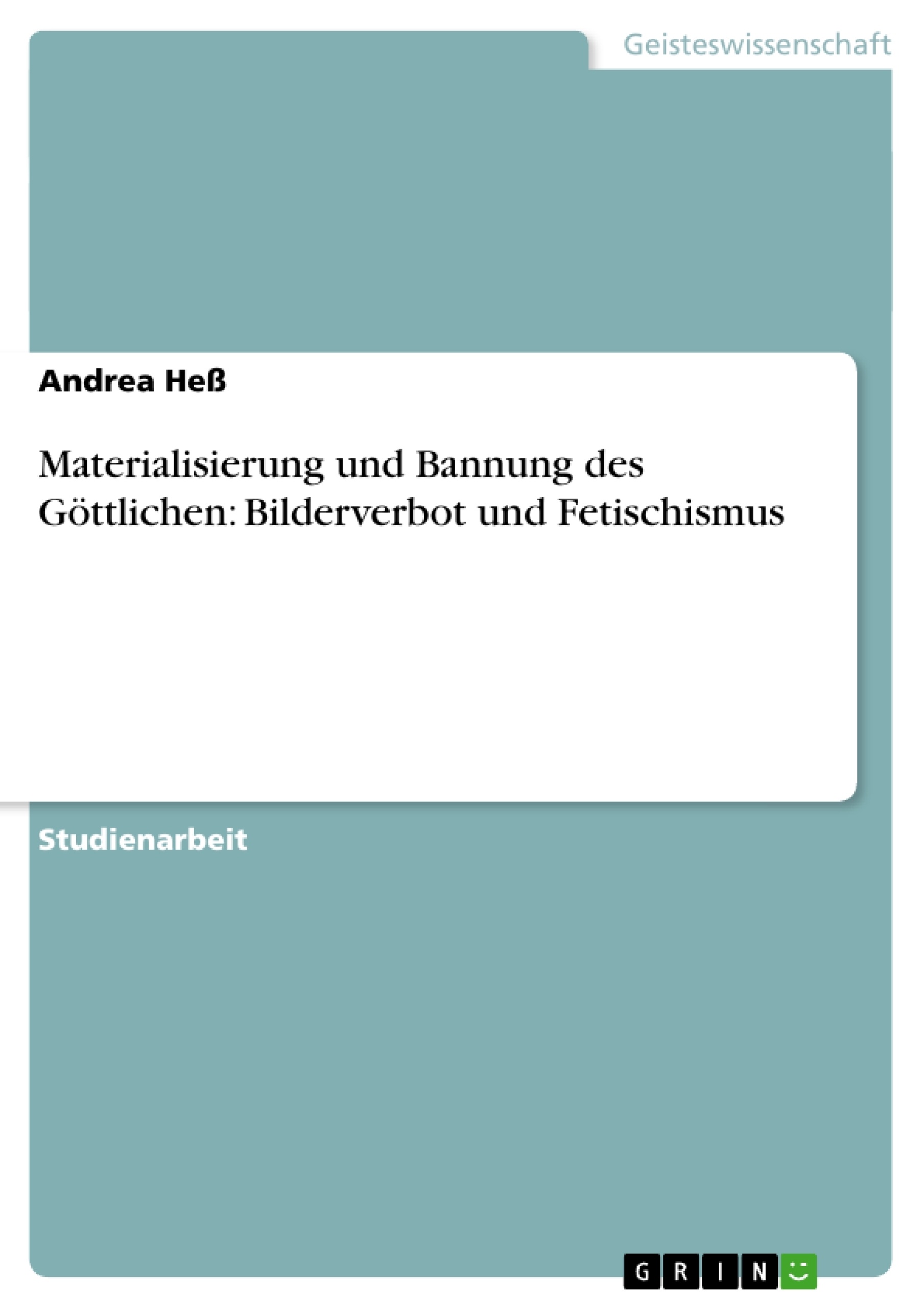Im Kontext der Erscheinungsformen des Fetischismus möchte ich in dieser Arbeit die Hintergründe und Auswirkungen des Bilderverbots JHWHs im Alten Testament beleuchten. Inwiefern es gegeben wurde, um davor zu bewahren, durch Materialisierung Gott in ein Objekt zu bannen und seine Kraft somit auf einen Fetisch zu reduzieren, und wie weitreichend die Folgen des Gebots waren. Hier werde ich auf die Besonderheit der Gottesoffenbarung eingehen, die eine Textreligion mit fetischähnlichem Textkult hervorbrachte. Weiter werde ich über die Inkarnation Gottes in Jesus zu Ikonen und ihrer Verehrung kommen und die Auswirkung des Bilderverbots in dieser Hinsicht bis hinein in die moderne gegenstandslose Kunst aufzeigen.
Meine These ist, dass das Bilderverbot nicht dazu dienen soll, dem Menschen jede Vorstellung oder Aneignung Gottes in jedwelchem Medium zu untersagen, was ihn letztlich zum Verstummen verurteilte, sondern es Ausdruck der Besonderheit der Beziehung Gottes mit seinem Volk darstellt. Aufgrund der dynamischen, nicht determinierbaren Interaktion, die das Gottesverhältnis prägen soll, warnt das Verbot vor Statik und vermeintlicher Verfügung, was die Charakteristika von Fetischen ausmacht. Fetische und die Gefahr der Fetischisierung sind in vielerlei Hinsicht beobachtbar, wo Transzendenz, Göttliches und Religion sich manifestieren. Ich werde versuchen darzulegen, inwieweit JHWH im AT bis hin zu Christus stets zu Unrecht, aber dem Bedürfnis des Menschen gemäß, gebannt und reduziert wurden, wobei ich in meiner Argumentation eine deutliche Trennung ziehe zwischen Glaubensbeziehung und Religionssystemen.
Inhaltsverzeichnis
- Materialisierung des Göttlichen als Fetischismus
- Bilderverbot und Fetischisierung
- Fetischismus
- Alttestamentarische Gottesoffenbarung und Fetischisierung
- Zusammenfassung
- Bilderverbot und Wortoffenbarung als kultische Novität
- Exklusivität der Offenbarung
- Textkult und Fetischismus
- Ausdehnung des Bilderverbots auf das Wort und Überwindung des Textkultes in Jesus
- Zusammenfassung
- Bilderverbot als abstrakte Unzumutbarkeit?
- Bilderpolemik und Bilderverteidigung
- Bild und Fetischisierung im christlichen Abendland: Ikonen
- Alteritätsmarkierung oder Annäherung an Transzendenz durch Negation
- Zusammenfassung
- Bilderverbot als Ausdruck einer dynamischen Gottesbeziehung
- Zugriffsverweigerung als Beziehungsgrundlage
- JHWH versus religiöses Repräsentationssystem
- Zusammenfassung
- Von der Unmöglichkeit die Bilderversuchung zu überwinden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Hintergründe und Auswirkungen des Bilderverbots JHWHs im Alten Testament. Sie untersucht, inwieweit das Verbot dazu dienen sollte, Gott durch Materialisierung nicht in ein Objekt zu bannen und seine Kraft auf einen Fetisch zu reduzieren. Dabei werden die Besonderheiten der Gottesoffenbarung beleuchtet, die eine Textreligion mit fetischähnlichem Textkult hervorbrachte. Weiterhin wird die Auswirkung des Bilderverbots auf die Inkarnation Gottes in Jesus, die Entstehung von Ikonen und deren Verehrung sowie deren Bedeutung für die moderne gegenstandslose Kunst untersucht.
- Das Bilderverbot im Alten Testament
- Fetischismus und die Gefahr der Fetischisierung
- Die Gottesoffenbarung im Alten Testament
- Die Entwicklung des Bilderverbots
- Die Beziehung zwischen Gott und Mensch
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Dieses Kapitel stellt die These vor, dass das Bilderverbot im Alten Testament nicht dazu dient, jegliche Vorstellung oder Aneignung Gottes zu untersagen, sondern Ausdruck der Besonderheit der Beziehung Gottes mit seinem Volk darstellt. Es werden die Auswirkungen des Bilderverbots auf die Gottesbeziehung beleuchtet und der Begriff des Fetischismus im Kontext der Gottesdarstellung erläutert.
Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert den Begriff des Fetischismus und seine Relevanz für die alttestamentarische Gottesoffenbarung. Es untersucht, wie die Verdinglichung des Göttlichen zur Fetischisierung führen kann und welche Auswirkungen dies auf die Gottesbeziehung hat. Das Dekalog-Gebot „Du sollst dir kein Götterbild machen" wird als Ausdruck des Versuchs interpretiert, den Menschen vor der Fetischisierung des Göttlichen zu bewahren.
Kapitel 3: In diesem Kapitel wird die Besonderheit der alttestamentarischen Gottesoffenbarung im Vergleich zu anderen Religionen hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Exklusivität der Offenbarung, der Ablehnung von Bildern und dem Einfluss dieser auf die Entwicklung des Textkults. Es wird untersucht, wie sich die Ablehnung von Bildern auf die Inkarnation Gottes in Jesus und die Entwicklung von Ikonen ausgewirkt hat.
Kapitel 4: In diesem Kapitel wird das Bilderverbot als Ausdruck einer dynamischen Gottesbeziehung analysiert. Es wird untersucht, wie die Zugriffsverweigerung auf Gott die Grundlage für eine einzigartige Beziehung darstellt.
Schlüsselwörter
Das Bilderverbot, Fetischismus, Gottesoffenbarung, Altes Testament, JHWH, Textreligion, Inkarnation, Ikonen, Monolatrie, Gottesbeziehung, dynamische Beziehung, Transzendenz, Religionssystems, Religion.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es das Bilderverbot im Alten Testament?
Das Verbot soll davor bewahren, Gott durch Materialisierung in ein Objekt zu bannen (Fetischisierung) und die Dynamik der Gottesbeziehung einschränken.
Was versteht die Arbeit unter Fetischismus?
Fetischismus bezeichnet hier die Reduzierung des Göttlichen auf ein statisches, verfügbares Objekt oder Bild.
Wie entstand aus dem Bilderverbot eine Textreligion?
Da Bilder untersagt waren, verlagerte sich die Gottesoffenbarung auf das Wort, was einen spezifischen Textkult im Judentum hervorbrachte.
Welchen Einfluss hatte das Verbot auf das Christentum?
Die Arbeit untersucht die Spannung zwischen dem alttestamentarischen Verbot und der Inkarnation Gottes in Jesus sowie der späteren Ikonenverehrung.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bilderverbot und moderner Kunst?
Ja, die Arbeit zieht Linien vom religiösen Bilderverbot bis hin zur Entstehung der modernen, gegenstandslosen Kunst.
- Citar trabajo
- Andrea Heß (Autor), 2004, Materialisierung und Bannung des Göttlichen: Bilderverbot und Fetischismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45009