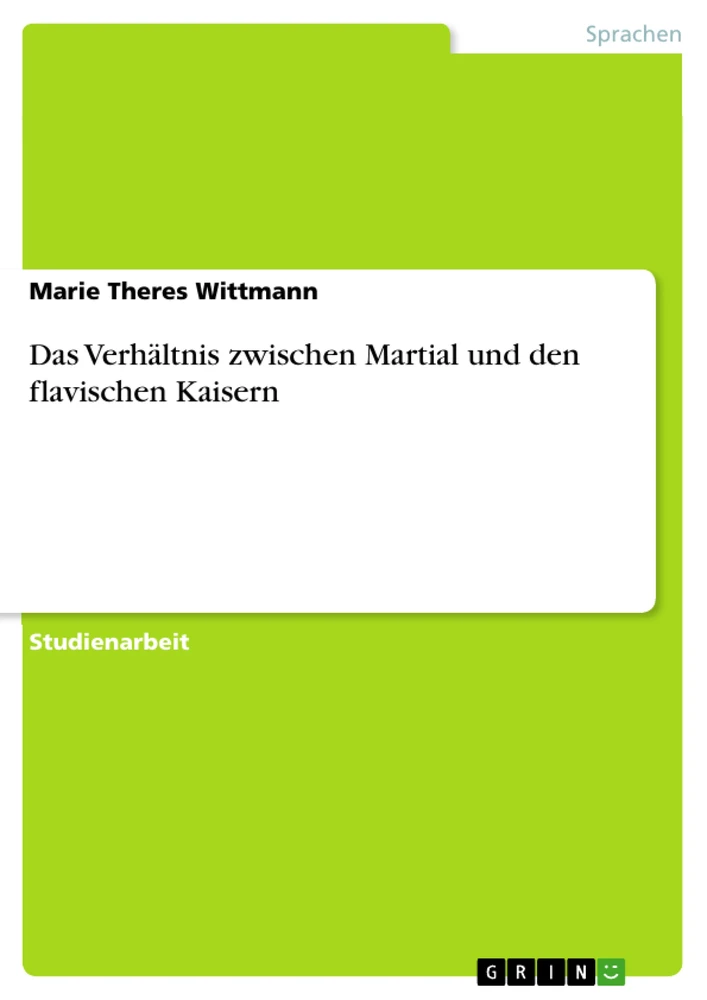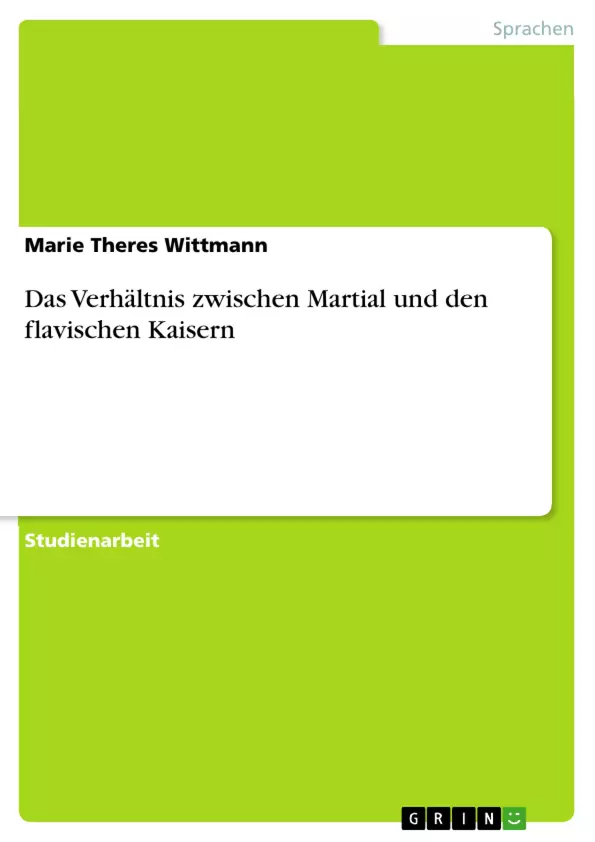Martial gilt als einer der bedeutendsten Epigrammatiker seiner Zeit, wenn nicht sogar als der Vertreter dieses Genres. Vielerorts hat man sich mit seinen ioci und ludi, wie er sie selbst nannte, beschäftigt, geben sie doch nicht zuletzt ein äußerst lebendiges Bild des damaligen Rom, seiner Gesellschaft, seiner Sitten und – auf keinen Fall zu vergessen – des Kaisers wider. Aber ist es ein realitätsnahes Bild, welches Martial in seinen Epigrammen zeichnet? Oder waren seine Gedichte, vor allem die panegyrischen unter ihnen, allein zum Selbstzweck gedacht?
Die meisten Epigramme sind in der Regierungszeit Domitians entstanden und der in diesen Werken enthaltene Servilismus hat Martial in frühen Interpretationen schnell zum sogenannten ‚Speichellecker‘ werden lassen. In jüngster Zeit wurden die entdeckten Anspielungen und Zweideutigkeiten dann immer mehr als Kritik am Kaiser identifiziert. Doch konnte ein Dichter aus dem Stande Martials wirklich so unverfroren über seine Poesie Kritik am gottgesandten Herrscher und seinen Amtshandlungen üben? Wie war die Beziehung zwischen Martial, dem schmeichelnden Dichter und Domitian, dem Tyrannenherrscher? Welche Absichten hegte Martial mit seinen panegyrischen Epigrammen? Und inwieweit hilft eine eingehende Untersuchung der Epigramme diese Fragen zu beantworten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung und textnahe Interpretation von spec. 2
- Übersetzung und textnahe Interpretation von ep. VI, 4
- Übersetzung und textnahe Interpretation von ep. IX, 91
- Das Verhältnis zwischen Martial und den flavischen Kaisern
- Kaiserhuldigung
- Kaiserkritik
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert drei Epigramme des römischen Epigrammatikers Martial, die sich auf die flavischen Kaiser beziehen, um das Verhältnis zwischen Martial und den Herrschern zu beleuchten. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, ob Martials Epigramme lediglich zum Selbstzweck gedichtet wurden oder ob sie realitätsnahe Einblicke in die damalige Zeit und die Beziehung zwischen Dichter und Kaiser bieten.
- Analyse von Martials Epigrammen im Kontext der Regierungszeit Domitians
- Untersuchung des Verhältnisses zwischen Martial und den flavischen Kaisern, insbesondere Domitian
- Die Frage, ob Martials panegyrische Epigramme als Kritik oder Huldigung zu verstehen sind
- Die Rolle von Zweideutigkeiten und Anspielungen in Martials Epigrammen
- Der Einfluss von Martials Werk auf das Verständnis der flavischen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Kontext der Analyse dar und skizziert die Schlüsselfragen des Textes. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen von Martials Epigrammen im Laufe der Zeit.
- Kapitel 2 bietet eine Übersetzung und Interpretation des zweiten Epigramms aus Martials liber spectaculorum. Der Fokus liegt auf dem Vergleich des Zustands Roms unter Nero und der flavischen Kaiser, insbesondere Titus. Die Analyse untersucht die sprachlichen Mittel, die Martial verwendet, um diese Gegenüberstellung zu gestalten, und die Bedeutung der domus aurea in diesem Kontext.
- Kapitel 3 analysiert das sechste Epigramm des vierten Buches. Dieses Epigramm bietet Einblicke in Martials eigene Lebensumstände und die Schwierigkeiten, die er in der flavischen Zeit erlebte.
- Kapitel 4 widmet sich der Analyse des 91. Epigramms des neunten Buches. Hier geht es um die Frage, ob und wie Martial seine Kritik am Kaiser in seinen Epigrammen formulieren konnte.
- Kapitel 5 untersucht das Verhältnis zwischen Martial und den flavischen Kaisern anhand der in den Epigrammen beschriebenen Formen der Kaiserhuldigung und -kritik.
Schlüsselwörter
Martial, flavische Kaiser, Epigrammatiker, Domitian, Titus, domus aurea, Kaiserhuldigung, Kaiserkritik, panegyrische Epigramme, Zweideutigkeit, Anspielung, literarische Quellen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Martial und warum ist er bedeutend?
Martial war der bedeutendste römische Epigrammatiker, dessen kurze Gedichte ein lebendiges Bild der römischen Gesellschaft und der Kaiserzeit vermitteln.
War Martial ein „Speichellecker“ des Kaisers Domitian?
Frühe Interpretationen sahen ihn so, doch moderne Analysen erkennen in seinen schmeichelnden (panegyrischen) Gedichten oft versteckte Kritik und Zweideutigkeiten.
Was ist das „liber spectaculorum“?
Es ist eine Sammlung von Epigrammen Martials zur Eröffnung des Kolosseums, in der er die Pracht Roms unter den flavischen Kaisern preist.
Was symbolisiert die „domus aurea“ in Martials Werk?
Sie steht für die Tyrannei Neros. Martial nutzt den Rückbau dieses Palastes durch die Flavier, um deren Volksnähe und Großzügigkeit hervorzuheben.
Konnte ein Dichter damals den Kaiser offen kritisieren?
Offene Kritik an einem Herrscher wie Domitian war lebensgefährlich. Kritik wurde daher meist subtil durch Anspielungen und literarische Codes verpackt.
- Quote paper
- Marie Theres Wittmann (Author), 2017, Das Verhältnis zwischen Martial und den flavischen Kaisern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450249