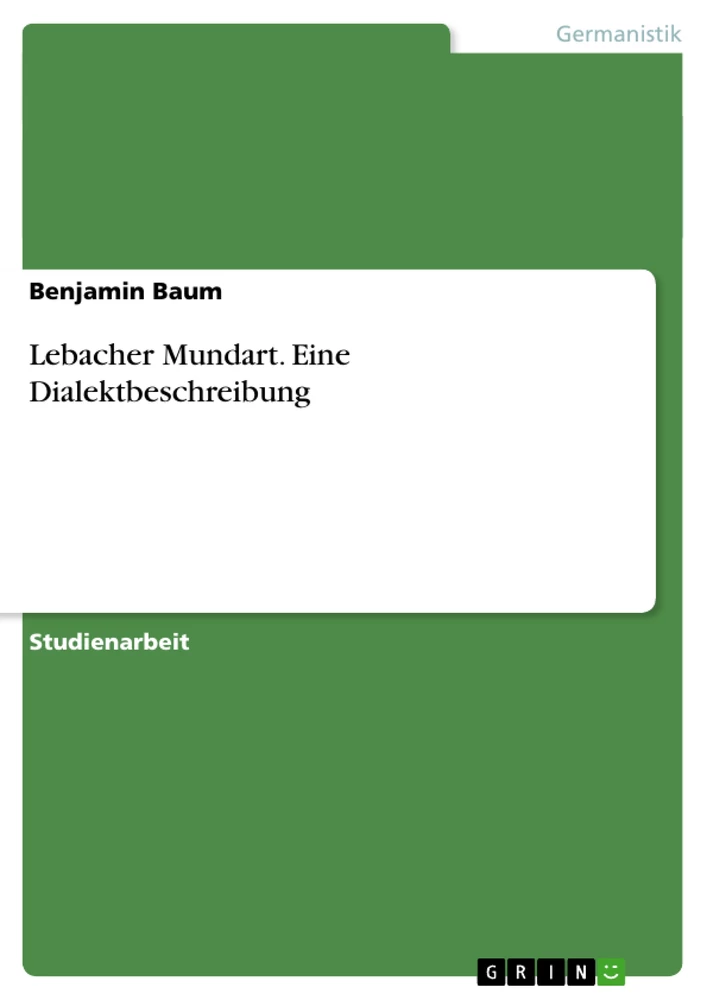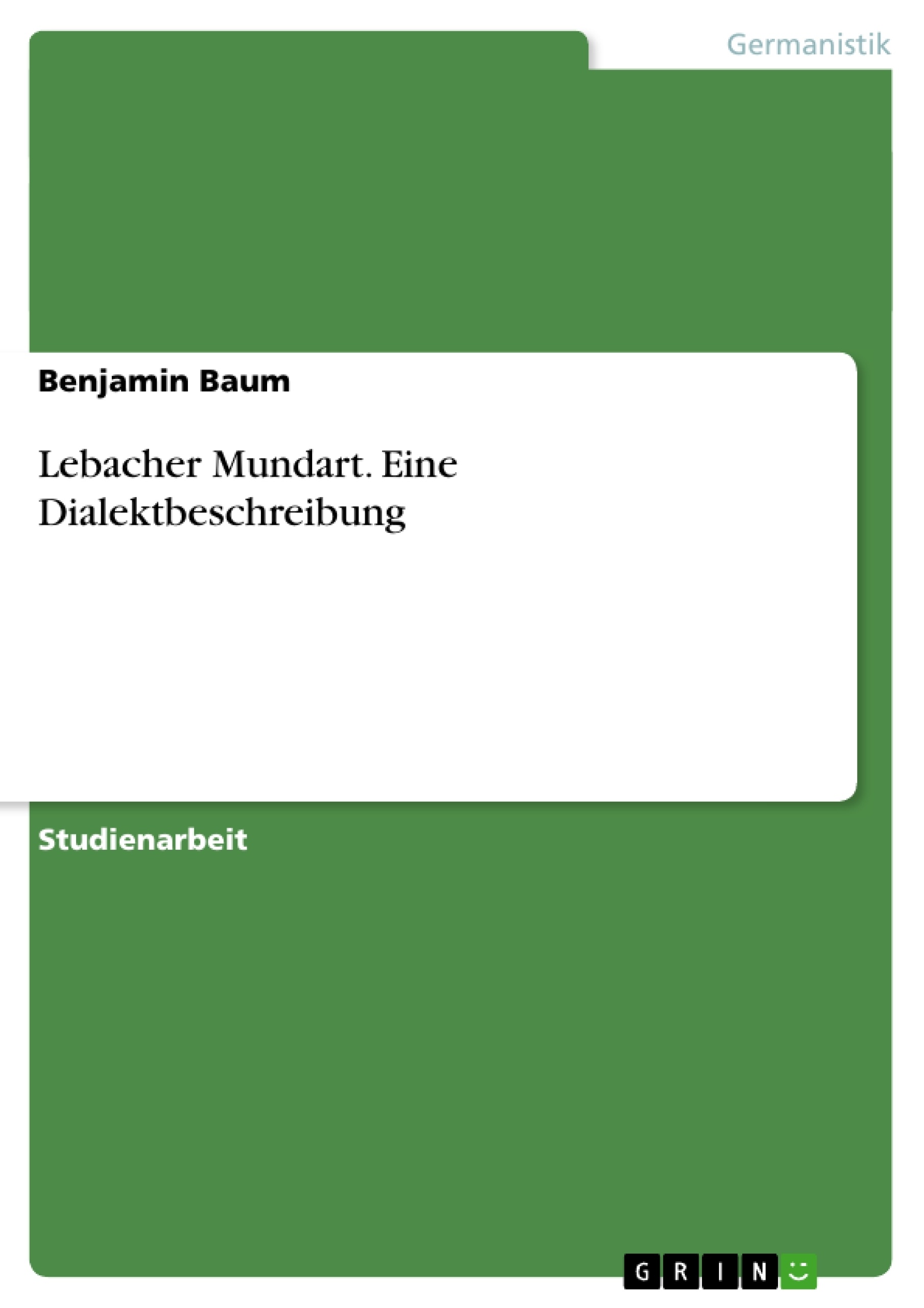Das im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit zu untersuchende Sprachgebiet erstreckt sich über die Stadt Lebach und die angrenzende Gemeinde Eppelborn. Daneben werden die zu Lebach gehörenden Ortschaften Aschbach, Dörsdorf, Eidenborn, Falscheid, Gresaubach, Knorscheid, Landsweiler, Niedersaubach, Steinbach und Thalexweiler untersucht. Alle diese Gebiete liegen zentral im Saarland, etwa 30 bis 40 Kilometer nördlich der Landeshauptstadt Saarbrücken.
Der Dialekt innerhalb dieses Gebiets unterscheidet sich vor allem auf phonetischer Ebene sehr stark von den ansonsten weithin deckungsgleichen saarländischen Subdialekten. In der Literatur wird die Mundart von Lebach, Eppelborn (meist in Zusammenhang mit der ca. 7 Kilometer nord-westlich gelegenen Gemeinde Schmelz) häufig als „Inseldialekt“ bezeichnet.
Im Vorfeld dieser Hausarbeit wurde jeweils einem genuinen Vertreter dieser Städte und Gemeinden das selbe Blatt mit je 40 Probesätzen vorgelegt, die von der Testperson in alltäglich gesprochenem Dialekt verlesen werden sollten. Eine Verfälschung des Resultats durch unnatürliche Anleihen aus der Standardsprache konnte durch gegebenenfalls mehrmaliges Wiederholen der betreffenden Sätze sowie Nachfragetests (die fraglichen Wörter und Wendungen wurden jenseits des Tests in anderem Kontext zur Sprache gebracht) weitgehend vermieden werden. Die vorab aufgestellte Theorie, bei den untersuchten Regionen handle es sich um eine Dialektgemeinschaft mit lediglich marginalen Differenzierungen ausschließlich auf phonetischer und in Ausnahmefällen auf lexikalischer Ebene, konnte durch Auswertung sämtlicher Testpersonen weithin bestätigt werden.
Diesem engen Sprachhorizont entzieht sich am ehesten die Stadt Lebach. Hier und in der Nachbarstadt Eppelborn – die beiden Ortschaften unterscheidet dialektal lediglich die Wiedergabe des [r] (Eppelborn: gerollt, Lebach: einfach) - liegt das weitaus „progressivste“ Gebiet. Hier kommt die praktizierte Mundart der Standardsprache am nächsten. Mit derzeit rund 21.500 Einwohnern weist gerade Lebach weitaus deutlicher typisch urbane Charakteristika auf als die umliegenden, weitaus kleineren Ortschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hochdeutsch oder Dialekt? - Eine Begriffbestimmung
- „Die griin Lung vum Saarland\" - Eine Stadt und ihr Dialekt
- Phonologie
- Vokale
- Diphthonge
- Konsonanten
- Morphologie
- Verben
- Substantive, Adjektive, Pronomen, Artikel
- Syntax
- Lexikon
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet eine umfassende Beschreibung der Lebacher Mundart. Sie zielt darauf ab, die sprachlichen Besonderheiten des Dialekts zu analysieren und ihn von der Hochsprache abzugrenzen. Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte der Lebacher Mundart, darunter Phonologie, Morphologie, Syntax und Lexikon.
- Abgrenzung des Dialekts von der Hochsprache
- Analyse der phonetischen und phonologischen Merkmale der Lebacher Mundart
- Untersuchung der morphologischen Besonderheiten des Dialekts
- Beschreibung der syntaktischen Strukturen der Lebacher Mundart
- Analyse des Wortschatzes der Lebacher Mundart
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit der Problematik der Definition des Begriffs „Dialekt“. Sie stellt fest, dass es in der Literatur zur Dialektologie keine einheitliche und weithin akzeptierte Definition des Begriffs gibt. Die Einleitung beleuchtet verschiedene Definitionsversuche aus der Fachliteratur und kritisiert deren Beliebigkeit und Unschärfe. Es wird argumentiert, dass eine präzise Definition des Begriffs „Dialekt“ schwierig ist und stattdessen eine Abgrenzung des Dialekts von der Hochsprache anhand verschiedener Merkmale vorgenommen werden soll.
Hochdeutsch oder Dialekt? - Eine Begriffbestimmung
Dieses Kapitel behandelt die Abgrenzung des Dialekts von der Hochsprache anhand verschiedener Kriterien. Die Defekt-Hypothese besagt, dass Dialekte im Vergleich zur Hochsprache eine mangelhafte Ausstattung auf verschiedenen grammatischen Ebenen aufweisen. Die Autoren diskutieren außerdem das Kriterium des Verwendungsbereiches, das auf die familiär-intime Anwendung des Dialekts im Gegensatz zur öffentlich-überörtlichen Verwendung der Hochsprache hinweist. Darüber hinaus wird das Kriterium der Sprachbenutzer erläutert, welches sich auf den Personenkreis konzentriert, innerhalb dessen die abzugrenzende Sprachform dominiert. Schließlich wird das Kriterium der sprachgeschichtlichen Entstehung behandelt, das die chronologische Primat des Dialekts hervorhebt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den wichtigsten Merkmalen der Lebacher Mundart. Sie analysiert phonetische und phonologische Besonderheiten, untersucht morphologische Strukturen, beschreibt syntaktische Besonderheiten und analysiert den Wortschatz des Dialekts. Die Arbeit befasst sich mit der Abgrenzung des Dialekts von der Hochsprache und beleuchtet verschiedene Ansätze in der Dialektologie.
- Citation du texte
- Benjamin Baum (Auteur), 2005, Lebacher Mundart. Eine Dialektbeschreibung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45043