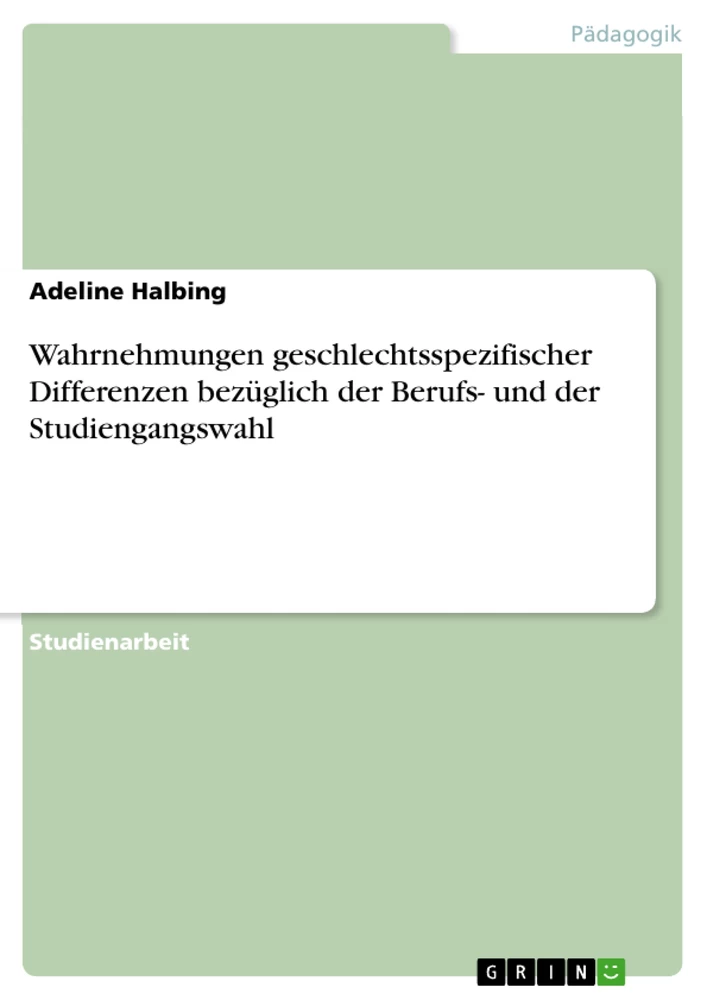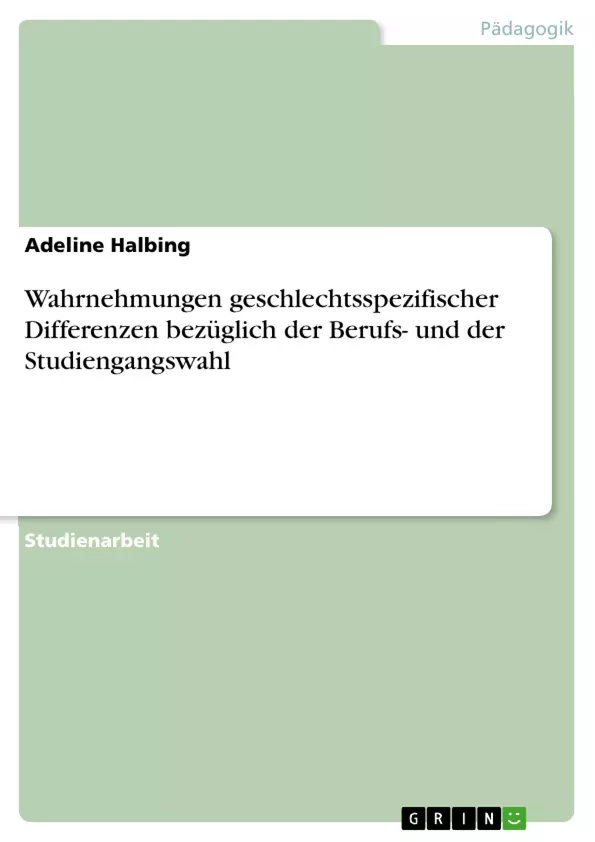Die Rolle des Geschlechtes und dessen Merkmalszuordnungen, sowie Charakteristik spielt in vielen Bereichen und Lebenslagen eine essentielle Rolle, welches sich auch verschiedene Wissenschaften zu Nutze gemacht haben. Dazu gehört unter anderem die Psychologie, die Soziologie oder die Wirtschaftswissenschaft, welche die verschiedenen Merkmale und Eigenschaften bezogen auf die unterschiedlichen Gegenstandsbereiche thematisieren. Auch für die Pädagogik ist die Rolle des Geschlechtes ein interessanter Untersuchungsgegenstand. So gehört zum Beispiel die Veränderung der Rolle zwischen Männern und Frauen im Bezug auf die Arbeitsteilung zu den am meisten diskutierten Themen, sowohl in den vergangenen Jahren, als auch heute noch. So vollzog sich die Berufswahl in der vergangenen Jahrhunderten aufgrund einer überschaubaren Arbeitswelt und einer Beständigkeit eher auf eine natürliche Weise, welches sich mit dem Hineinwachsen in dessen der Jugendlichen in die Erwachsenenwelt erklärte. Durch einen stetigen Wandel ist dies in der heutigen Zeit jedoch nicht mehr so. Die Untersuchungen gegenwärtig umschließen daher die Erwerbsarbeit, als auch die Hausarbeit, wobei analysiert wird, ob geschlechtstypische Unterschiede bezüglich der Arbeit zu vernehmen sind, oder ob bestimmte Unterschiede nur gewisse Ausnahmefälle darstellen. Dadurch stellen sich ebenso die Fragen, welche Eigenschaften dem jeweiligen Geschlecht zugeordnet werden können, oder inwieweit sich die Bilder, welche die Menschen von den beiden Geschlechtern haben, in den letzten Jahren verändert haben, beziehungsweise ob überhaupt noch ein traditionelles Bild der Geschlechterrolle besteht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Geschlechterrolle
- Die Geschlechterrolle des Mannes
- Die Geschlechterrolle der Frau
- Faktoren für die Berufs- und Studiengangswahl
- Die Geschlechterrolle im Zusammenhang mit der Berufs-, beziehungsweise Studiengangswahl
- Berufswahlmodelle
- Das Berufswahlmodell nach John L. Holland
- Das Modell der Laufbahnentwicklung nach Donald Super
- Die Darstellung der Zusammenhänge an der Studie von Karoline Hentrich
- Die Methode
- Die Operationalisierung der Variablen
- Die Beschreibung der Stichprobe
- Die Ergebnisse der Berufswahlmotive
- Die Zusammenhänge der Vorüberlegungen und der Studie
- Resümee
- Quellenverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle des Geschlechts und dessen Einfluss auf die Berufs- und Studiengangswahl. Die Arbeit untersucht, inwieweit geschlechtsspezifische Differenzen in den Berufs- und Studiengangsentscheidungen von jungen Menschen existieren und welche Faktoren diese beeinflussen.
- Die Bedeutung der Geschlechterrolle in der Gesellschaft
- Die Einflussfaktoren auf die Berufs- und Studiengangswahl
- Die Analyse von Berufswahlmodellen
- Die Untersuchung der Geschlechterrollenstereotypen im Kontext der Berufswahl
- Die Interpretation der Ergebnisse einer Studie zu Berufswahlmotiven
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Geschlechterrolle im Kontext der Berufs- und Studiengangswahl heraus. Es wird die historische Entwicklung der Berufswahl angesprochen und der Fokus auf die Bedeutung des Geschlechts im Wandel der Arbeitswelt gelegt.
- Die Geschlechterrolle: Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept der Geschlechterrolle als soziale Kategorie und analysiert die damit verbundenen Rollenzuschreibungen für Männer und Frauen. Es wird der Einfluss kultureller Erwartungen und Normen auf die Geschlechterrolle diskutiert.
- Faktoren für die Berufs- und Studiengangswahl: Das Kapitel beschreibt verschiedene Faktoren, die die Berufs- und Studiengangswahl von jungen Menschen beeinflussen. Hierzu zählen beispielsweise Interessen, Fähigkeiten, Wertvorstellungen, soziale Einflüsse und wirtschaftliche Aspekte.
- Berufswahlmodelle: Dieses Kapitel stellt zwei verschiedene Berufswahlmodelle vor: Das Modell nach John L. Holland und das Modell der Laufbahnentwicklung nach Donald Super. Beide Modelle bieten unterschiedliche Ansätze zur Erklärung der Berufswahlentscheidung.
- Die Darstellung der Zusammenhänge an der Studie von Karoline Hentrich: Dieses Kapitel analysiert eine Studie von Karoline Hentrich, die sich mit der Geschlechterrolle im Bezug auf die Berufswahl beschäftigt. Es werden die Methode, die Operationalisierung der Variablen, die Stichprobe und die Ergebnisse der Studie dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Geschlechterrolle, Berufswahl, Studiengangswahl, Geschlechterstereotypen, Berufswahlmodelle, und Studienanalyse. Die Arbeit analysiert die Zusammenhänge zwischen Geschlechterrolle und der Berufswahlentscheidung, wobei die Studie von Karoline Hentrich als Grundlage dient.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es heute noch geschlechtstypische Unterschiede bei der Berufswahl?
Ja, die Arbeit untersucht, inwieweit traditionelle Rollenbilder und Stereotypen die Entscheidungen für bestimmte Berufe oder Studiengänge weiterhin beeinflussen.
Was besagt das Berufswahlmodell von John L. Holland?
Holland geht davon aus, dass Menschen Berufe wählen, die ihrer Persönlichkeit entsprechen (RIASEC-Modell), wobei die Arbeit prüft, ob diese Typen geschlechtsspezifisch verteilt sind.
Welche Faktoren beeinflussen die Studienwahl junger Menschen?
Neben Interessen und Fähigkeiten spielen kulturelle Erwartungen, soziale Herkunft und das Bild der Geschlechterrolle eine wesentliche Rolle.
Was ist das Modell der Laufbahnentwicklung nach Donald Super?
Super betrachtet die Berufswahl als einen lebenslangen Prozess der Entwicklung und Umsetzung des eigenen Selbstkonzepts.
Welche Rolle spielen Geschlechterstereotypen heute?
Die Arbeit analysiert anhand einer Studie von Karoline Hentrich, ob sich die Bilder von „typisch männlichen“ oder „typisch weiblichen“ Eigenschaften gewandelt haben.
- Quote paper
- Adeline Halbing (Author), 2017, Wahrnehmungen geschlechtsspezifischer Differenzen bezüglich der Berufs- und der Studiengangswahl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/450452