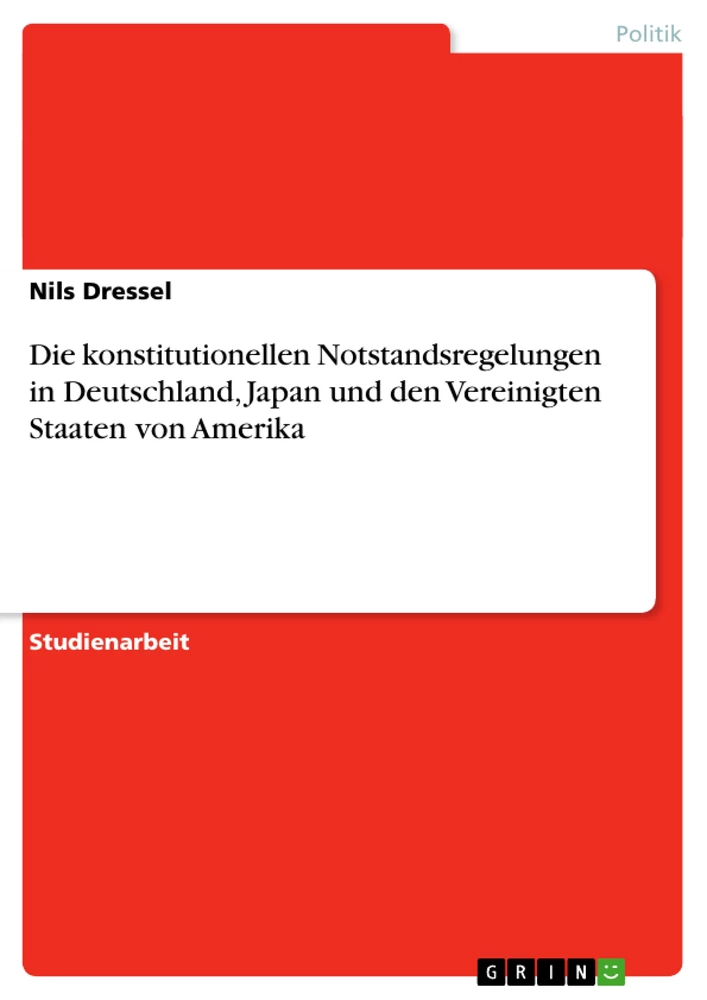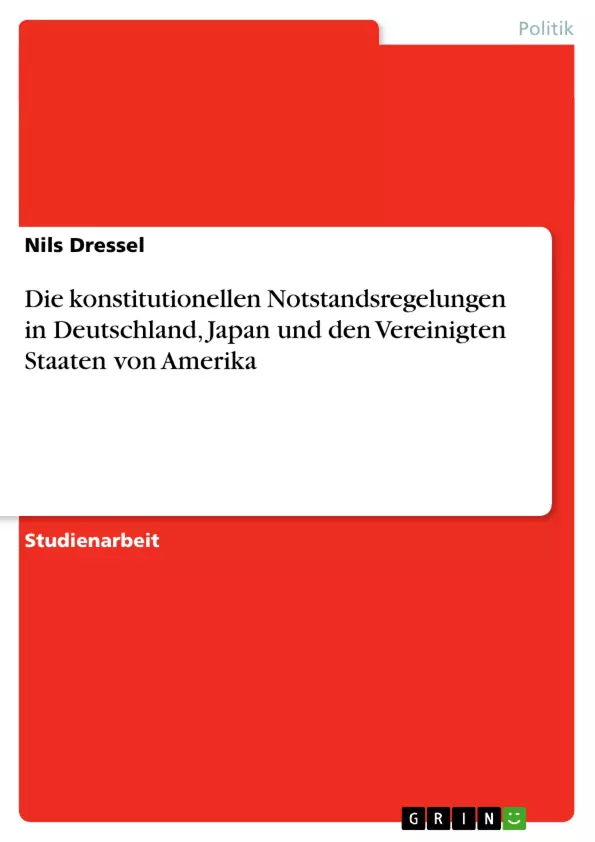Zu den Grundaufgaben des Staates und damit zu seiner Daseinsberechtigung zählt seit Hobbes der Schutz seiner Bürger „durch den innerstaatlichen Frieden und […] gegenseitige Hilfe gegen auswärtige Feinde“ (Hobbes 1991: 135). Diese Aufgabe, die Hobbes noch als konstituierendes Element des Staates angesehen hat, ist in den modernen Staaten westlicher Prägung inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Dabei dient der konstitutionelle Charakter der modernen Staatlichkeit als Absicherung des einzelnen Bürgers vor dem souveränen Gewaltmonopol des Staates, welches zur Durchführung der genannten Aufgaben notwendig ist.
Was aber geschieht in einer Situation, in der der Staat nicht mehr in der Lage ist, seiner Verpflichtung die Bürger zu schützen innerhalb des ihm von der Verfassung auferlegten Rahmens nachzukommen, da die notwendigen Maßnahmen weit über das hinaus gehen würden, was die Bürger ihm im Normalfall an Kompetenzen zu zugestehen bereit waren, um einem möglichen Missbrauch durch die Staatsorgane zuvor zu kommen? Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen hypothetischen, nicht voraussehbaren Ausnahme- oder Katastrophenfällen, für die der Staat weitreichende Kompetenzen benötigt um seine Bürger effektiv zu schützen und der sich gleichzeitig daraus ergebenen Gefahr des Missbrauchs durch Verletzung grundlegender Prinzipien konstitutioneller Staaten wie dem Grundsatz der Gewaltenteilung, Wahrung der Grundrechte oder dem Grundsatz der Volkssouveränität.
Zur Vermeidung solcher Entwicklungen hat die Mehrheit der konstitutionellen Demokratien, und darauf beschränkt sich der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, Regelungen innerhalb ihrer jeweiligen Verfassungen oder daraus abgeleitet auf Ebene der einfachen Gesetze getroffen, die Kompetenzen, Verfahren und Verhaltensweisen für den Fall eines Notstandes festlegen.
Herauszufinden wie solche Regelungen konkret ausgestaltet sind, also welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten es gibt, ist Ziel dieser Fallstudie. Lassen sich allgemein gültige Regeln finden wie Regelungen zum Notstand aufgebaut sind? Werden diese Regelungen immer auf Ebene des Verfassungsrechtes festgeschrieben? Welche Bereiche beziehungsweise Arten von Notständen werden als regelungsbedürftig angesehen? Wie ist die Aktivierung, Durchführung und Beendigung geregelt? Auf diese Fragen soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine Antwort gefunden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was bedeutet Notstand? – Ein Definitionsversuch am Beispiel des GG
- Vergleich der Notstandsregelungen in Deutschland, Japan und den USA
- Vergleichende Übersicht
- Verfassungsbestimmungen zum Notstand
- Regelungsfähigkeit
- Regelungsbedürftigkeit
- Regelungsstruktur
- Regelungsdichte
- Regelungsstruktur
- Gerichtliche Kontrolle
- Gründe für den besonderen Charakter der Notstandsregelungen
- Zusammenfassung
- Anhang
- Primärquellen
- Sekundärquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die konstitutionellen Notstandsregelungen in Deutschland, Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Regelungen in diesen drei Ländern zu analysieren und anhand dieser Analyse allgemeine Regeln für den Aufbau von Notstandsregelungen zu entwickeln. Darüber hinaus werden die Frage nach der Regulierungsebene, der Aktivierung, Durchführung und Beendigung der Regelungen sowie die Rolle der Gerichtsbarkeit im Notstandsfall behandelt.
- Die historische Entwicklung und die aktuelle Ausgestaltung der Notstandsregelungen in Deutschland, Japan und den USA
- Die Bedeutung der Notstandsregelungen im Kontext der modernen Staatlichkeit und der Gewaltenteilung
- Der Vergleich der Regelungen hinsichtlich ihrer Struktur, Inhalte und des Einflusses historischer Faktoren
- Die Rolle der Gerichtsbarkeit bei der Kontrolle von Notstandsmassnahmen
- Die Herausforderungen und Chancen der Notstandsregelungen in einer globalisierten Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den theoretischen Hintergrund des Notstandes und die Relevanz des Themas für die modernen konstitutionellen Demokratien dar. Sie führt die drei Untersuchungsobjekte – Deutschland, Japan und die USA – ein und formuliert die zentralen Forschungsfragen und Hypothesen der Arbeit.
- Was bedeutet Notstand? – Ein Definitionsversuch am Beispiel des GG: Dieses Kapitel analysiert den Begriff des Notstandes im deutschen Recht und beschreibt den Unterschied zu anderen Begriffen wie Ausnahmerecht und Staatsnotrecht. Es wird auf die historischen Entwicklungen im deutschen Recht Bezug genommen und die Relevanz des Notstandes für die Funktionsfähigkeit des Staates hervorgehoben.
- Vergleich der Notstandsregelungen in Deutschland, Japan und den USA: Dieses Kapitel stellt die Notstandsregelungen in Deutschland, Japan und den USA vergleichend dar. Es analysiert die Verfassungsbestimmungen zum Notstand, die Regelungsfähigkeit, -bedürftigkeit und -struktur sowie die Rolle der Gerichtsbarkeit in den drei Ländern. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Regelungen im historischen Kontext und unter Berücksichtigung der spezifischen politischen Strukturen der einzelnen Länder untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Notstand, Notstandsrecht, Verfassung, Verfassungspolitik, Grundrechte, Gewaltenteilung, Demokratie, Vergleichende Politikwissenschaft, Deutschland, Japan, USA. Sie analysiert die konstitutionellen Notstandsregelungen der drei Länder im Hinblick auf ihre Entstehung, ihre Struktur und ihre Funktionsweise. Dabei werden die historischen Entwicklungen und die aktuellen Herausforderungen für die Notstandsregelungen in einer globalisierten Welt berücksichtigt.
Häufig gestellte Fragen
Welche Länder werden in der Fallstudie zu Notstandsregelungen verglichen?
Die Arbeit vergleicht die konstitutionellen Notstandsregelungen von Deutschland, Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Was ist das zentrale Spannungsfeld im Notstandsrecht?
Es besteht zwischen der Notwendigkeit weitreichender staatlicher Kompetenzen zum Bürgerschutz und der Gefahr des Missbrauchs durch Verletzung von Grundrechten und Gewaltenteilung.
Wie wird "Notstand" im deutschen Grundgesetz definiert?
Das Kapitel analysiert den Begriff im deutschen Recht und grenzt ihn von Begriffen wie Ausnahmerecht oder Staatsnotrecht ab.
Welche Rolle spielt die gerichtliche Kontrolle im Notstand?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Notstandsmassnahmen in den drei Ländern einer Überprüfung durch die Justiz unterliegen.
Was sind die Forschungsfragen dieser Hausarbeit?
Es wird gefragt, wie Regelungen aktiviert und beendet werden, auf welcher Ebene (Verfassung oder Gesetz) sie stehen und welche Notstandsarten geregelt werden.
- Quote paper
- Nils Dressel (Author), 2005, Die konstitutionellen Notstandsregelungen in Deutschland, Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45069