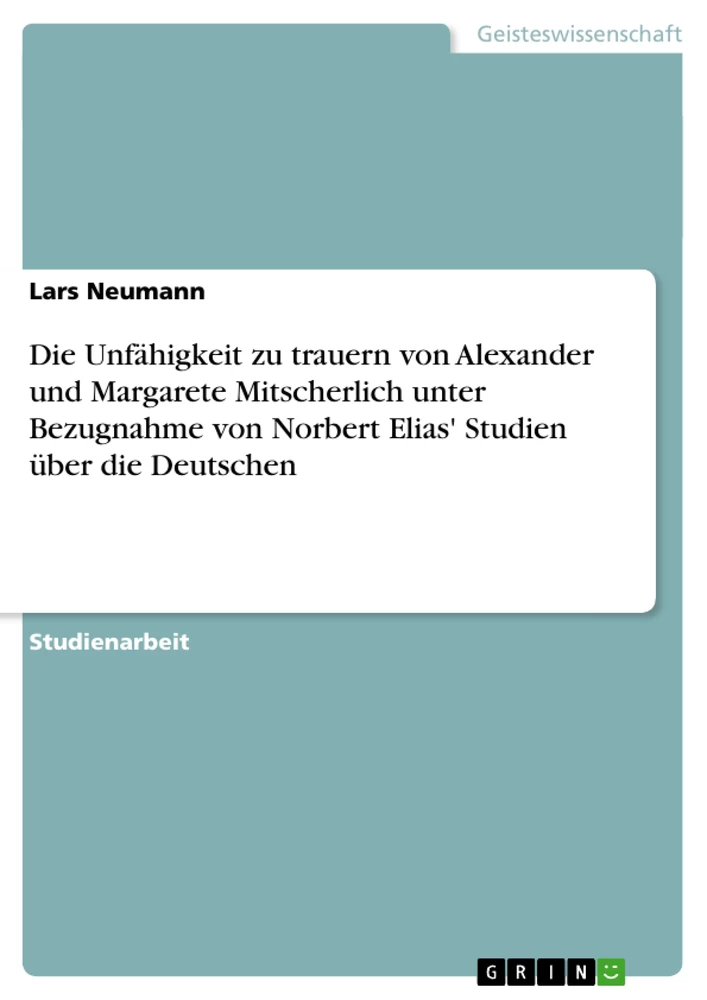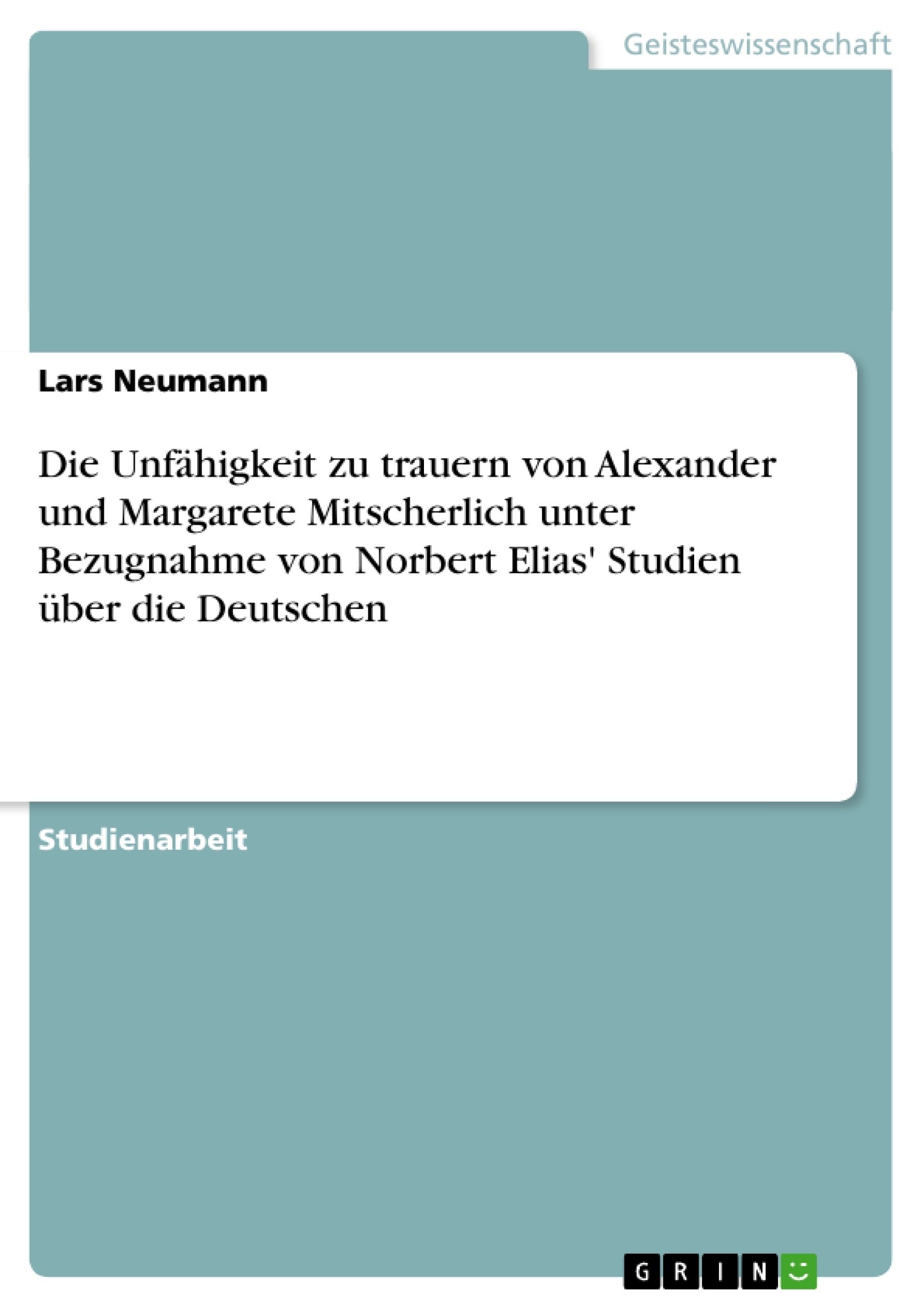1. Einleitung
Der 2. Weltkrieg hat in Deutschland tiefe Wunden hinterlassen, die größtenteils selbst heute, nach einem halben Jahrhundert, nicht verheilt sind.
Ich möchte mich aus diesem Grund mit dem Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ von Alexander und Margerete Mitscherlich befassen, in welchem sie darlegen, weshalb die Deutschen nicht imstande waren, ihre gemeinsam erlebte Vergangenheit wahrzunehmen und zu verarbeiten, also Trauerarbeit zu leisten.
Aus diesem Buch verwende ich zwei Kapitel, zum einem das Kapitel „Die Verliebtheit in den Führer“, in dem beschrieben wird, was diese Hörigkeit, diese Lust am Führer ausgemacht hat und warum es so schwer war und immer noch ist, davon loszukommen. Das zweite Kapitel „Emigration als Makel“ beschreibt die nichtobjektive Erinnerung der Menschen nach dem 2. Weltkrieg, wie sie die Geschichte nach ihren Gunsten färbten. Weiterhin ziehe ich das Buch „Das Vokabular der Psychoanalyse“ von J. Laplanche und J.-B. Pontalis zur Rate, um Begriffe besser erklären zu können.
Es reicht jedoch nicht, die nach dem Krieg aufgetretenen Symptome aus dem 2. Weltkrieg heraus zu erklären. Es ist notwendig zu beschreiben, wie und warum es überhaupt möglich war, dass Menschen das taten und daran glaubten, was im 2. Weltkrieg zu beobachten war. Um diese Entwicklung der Deutschen aufzuzeigen möchte ich dafür das Buch „Studien über die Deutschen“ von Norbert Elias verwenden, in welchem Entwicklungen des nationalen Habitus der Deutschen herausgearbeitet werden, die den Entzivilisierungsschub der Hitler -Epoche ermöglicht haben. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung der Staatsgesellschaft Deutschland
- Die Verliebtheit in den Führer
- Emigration als Makel
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ von Alexander und Margarete Mitscherlich und untersucht die Gründe, warum die Deutschen nach dem 2. Weltkrieg nicht in der Lage waren, ihre gemeinsame Vergangenheit zu verarbeiten.
- Die Auswirkungen des 2. Weltkriegs auf die deutsche Gesellschaft
- Die Rolle des Führers in der deutschen Geschichte
- Die Entwicklung des deutschen Nationalismus
- Die Psychologischen Mechanismen der Massenmanipulation
- Die Auswirkungen der Emigration auf die deutsche Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Motivation des Autors, sich mit dem Thema „Die Unfähigkeit zu trauern“ auseinanderzusetzen. Es werden die beiden zentralen Kapitel des Buches von Mitscherlich vorgestellt: „Die Verliebtheit in den Führer“ und „Emigration als Makel“. Darüber hinaus wird die Relevanz des Buches „Das Vokabular der Psychoanalyse“ von Laplanche und Pontalis für die Arbeit hervorgehoben.
- Entwicklung der Staatsgesellschaft Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der deutschen Staatsgesellschaft und analysiert die Ursachen für den Aufstieg Deutschlands zur Großmacht im 19. Jahrhundert. Dabei werden die sozialen und psychologischen Faktoren, die zur Entstehung des Nationalismus und der nationalistischen Ideologie geführt haben, untersucht.
- Die Verliebtheit in den Führer: In diesem Kapitel werden die Mechanismen der Massenmanipulation und die psychologischen Prozesse, die zur Entstehung der Führerverehrung führten, untersucht. Es wird auf Freuds „Massenpsychologie und Ich-Analyse“ Bezug genommen und die Rolle des Ich-Ideals in der Massenpsychologie erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der deutschen Geschichte, der Massenpsychologie, dem Nationalismus, der Führerverehrung und der Traumaverarbeitung. Zu den zentralen Begriffen gehören: Die Unfähigkeit zu trauern, die Verliebtheit in den Führer, Emigration, Staatsgesellschaft, Nationalismus, Ich-Ideal, Massenmanipulation und Trauma.
Häufig gestellte Fragen
Warum konnten die Deutschen laut Mitscherlich nach 1945 nicht trauern?
Alexander und Margarete Mitscherlich argumentieren, dass die Deutschen ihre Vergangenheit nicht verarbeiten konnten, da eine tiefgreifende Identifikation mit Hitler bestand, deren Verlust ohne Trauerarbeit verdrängt wurde.
Was wird unter der „Verliebtheit in den Führer“ verstanden?
Dieser Begriff beschreibt die psychologische Hörigkeit und die Lust an der Führerfigur, die als Ich-Ideal der Massen fungierte und eine kollektive moralische Entlastung ermöglichte.
Welchen Beitrag leisten die Studien von Norbert Elias in dieser Arbeit?
Norbert Elias analysiert den nationalen Habitus der Deutschen und zeigt historische Entwicklungen auf, die den „Entzivilisierungsschub“ der Hitler-Epoche soziologisch erklärbar machen.
Was bedeutet „Emigration als Makel“?
Es beschreibt die verzerrte Erinnerung der Nachkriegsgesellschaft, in der Emigranten oft misstrauisch betrachtet wurden, um die eigene Verstrickung im NS-Staat zu rechtfertigen.
Welche psychologischen Mechanismen werden zur Erklärung herangezogen?
Die Arbeit nutzt Konzepte der Psychoanalyse, wie das Ich-Ideal und die Massenpsychologie nach Freud, um die Manipulation und die emotionale Bindung an das NS-Regime zu untersuchen.
- Citar trabajo
- Lars Neumann (Autor), 2002, Die Unfähigkeit zu trauern von Alexander und Margarete Mitscherlich unter Bezugnahme von Norbert Elias' Studien über die Deutschen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45074