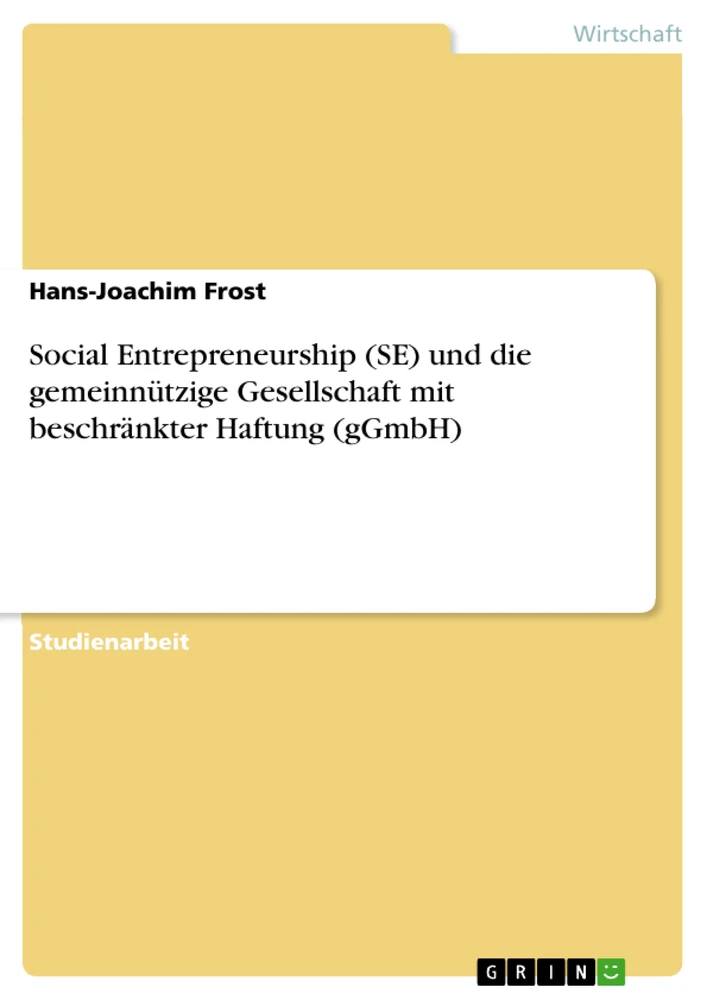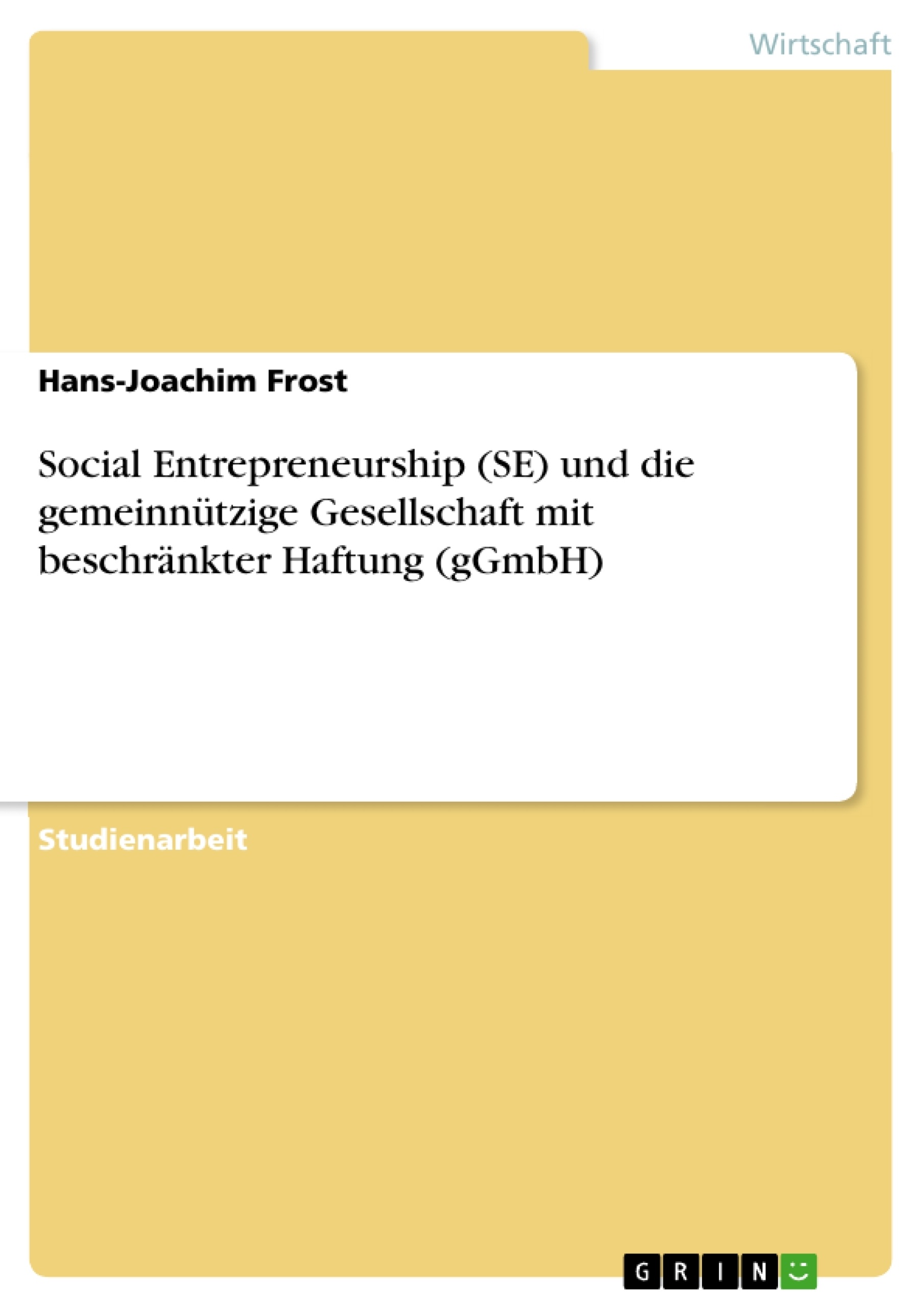Neben einem hohen Maß an intrinsischer Motivation und unabdingbaren Ressourcen, ist auch die Wahl der Rechtsform für den Erfolg einer gemeinnützigen Organisation von elementarer Bedeutung. Sie entscheidet mitunter darüber, in welcher Art und Weise eine Einrichtung betrieben werden kann, welche operativen Ziele gesteckt und erreicht werden können und welche diesbezüglichen Grenzen existieren. Sie ist daher auch richtungsweisend für eine inhaltliche Konfrontation jedweder Organisation mit sich selbst und gleichsam Fundament für eine effektive Entfaltung und praktische Realisierung der Geschäftsidee.
Insbesondere in den vielschichtigen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit stellen gemeinnützige Organisationen heutzutage ein bedeutsames Element unserer Ökonomie dar, deren zentrale Ausrichtung nicht die Generierung von Profit und Einkommen ist, sondern eine nachhaltige sozialunternehmerische Idee, die vorwiegend durch die Entwicklung von innovativen Lösungsansätzen für soziale und ökologische Problemstellungen geprägt wird. Gerade in diesem Kontext fällt in den letzten Jahren – meist im Rahmen von fachlichen Diskursen – immer wieder der Terminus Social Entrepreneurship (SE) oder auch Sozialunternehmertum. Doch was genau ist unter diesen Begrifflichkeiten zu verstehen? Diese Frage werden wir im ersten Teil dieser Arbeit, anhand einer sorgfältigen Erläuterung der existenten wissenschaftlichen Definitionen von Social Entrepreneurship, seiner historischen Entstehungsgeschichte und gängigen Differenzierungsmerkmalen sowie der damit korrelierenden Termini des Gemeinwohls und der Gemeinnützigkeit, beantworten.
Strukturell ist die gegenwärtige deutsche Sozialwirtschaft mehrheitlich von Dienstleistungsunternehmen aus dem Dritten Sektor – auch als Tertiärer Sektor bezeichnet durchzogen. Viele der darin tätigen Organisationen verfolgen zwar nach wie vor gemeinnützige Ziele, brauchen jedoch auch einen Vergleich mit kommerziellen Unternehmen hinsichtlich ihres erwirtschafteten Umsatzes und ihrer Personalmasse nicht zu scheuen. Vor diesem Hintergrund gewinnt die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) eine immer größere Bedeutung, da sie als Kapitalgesellschaft – gemäß den Regelungen des deutschen Steuerrechts – den Gemeinnützigkeitsstatus mit der Führung eines wirtschaftsnahen Unternehmens zu verbinden vermag. So soll es auch ein äquivalentes Ziel dieser Arbeit sein, ein möglichst genaues Bild der gGmbH zu zeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorüberlegungen und definitorische Eingrenzungen
- Gemeinwohl und Gemeinnützigkeit
- Social Entrepreneurship / Sozialunternehmertum
- Differenzierungsmerkmal I: Gemeinwohlorientierung
- Differenzierungsmerkmal II: Innovation
- Differenzierungsmerkmal III: Leistungsbasiertes Einkommen
- Social Entrepreneurship im engeren Verständnis
- Social Entrepreneurship im weiteren Verständnis
- Die Rechtsform der GmbH
- GmbH-Gesetz (GmbHG)
- Rechtsfähigkeit
- Rechtliche Souveränität gegenüber Gesellschaften
- Die GmbH als Handelsgesellschaft
- Haftungsbeschränkung und Durchgriffshaftung
- Gründungsprozess einer GmbH
- Vorgründungsgesellschaft
- Vor-GmbH
- Anmeldung beim Handelsregister
- Eintragung einer gGmbH in das Handelsregister
- Die in das Handelsregister eingetragene GmbH
- Geschäftsführer und Aufsichtsrat
- Einlagenleistung
- Organe einer gGmbH
- Grundlagen des Gemeinnützigkeitsrechts (gGmbH)
- Gemeinnützige Zwecke (§ 52 AO)
- Mildtätige Zwecke (§ 53 AO)
- Kirchliche Zwecke (§ 54 AO)
- Selbstlosigkeit (§ 55 AO)
- Ausschließlichkeit (§ 56 AO)
- Unmittelbarkeit (§ 57 AO)
- Gebot der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 AO)
- Ausnahmen von den Rechtsgrundsätzen
- Formelle Prämissen für die Steuervergünstigung
- Tätigkeitsfelder der gGmbH und ihre Steuerbehandlung
- Ideelle Sphäre und Vermögensverwaltung
- Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
- Besteuerung der gGmbH und Steuerbefreiungen
- Resümee: Eignung der gGmbH und ihre Vor- und Nachteile
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Rechtsform der gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) im Kontext von Social Entrepreneurship (SE). Ziel ist es, die gGmbH als Rechtsform im Hinblick auf ihre Eignung für gemeinnützige Organisationen und SE zu beleuchten und ihre Vor- und Nachteile darzustellen. Dies beinhaltet insbesondere eine Auseinandersetzung mit der rechtlichen Gestaltung der gGmbH, ihren Besonderheiten und der steuerlichen Behandlung.
- Definitorische Eingrenzung des Begriffs Social Entrepreneurship
- Analyse der Rechtsform der GmbH und ihrer Besonderheiten
- Erläuterung der rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit
- Bewertung der gGmbH als Rechtsform für gemeinnützige Organisationen und SE
- Untersuchung der Eignung der gGmbH für innovative soziale Projekte
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Rechtsformwahl für gemeinnützige Organisationen, insbesondere im Kontext von Social Entrepreneurship.
- Kapitel zwei beschäftigt sich mit den Begriffen Gemeinwohl, Gemeinnützigkeit und Social Entrepreneurship. Hierbei werden verschiedene Definitionsansätze diskutiert und die zentralen Differenzierungsmerkmale von Social Entrepreneurship herausgearbeitet.
- Kapitel drei liefert einen Überblick über die Rechtsform der GmbH, ihre Geschichte und die zentralen Regelungen des GmbH-Gesetzes (GmbHG). Es werden auch die Haftung der Gesellschafter und das Trennungsprinzip zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern erläutert.
- In Kapitel vier wird der Gründungsprozess einer GmbH dargestellt. Es werden die einzelnen Schritte der Gründung erläutert, von der Vorgründungsgesellschaft über die Vor-GmbH bis hin zur Eintragung im Handelsregister.
- Kapitel fünf beleuchtet die Organe der gGmbH, insbesondere die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Es werden auch die Aufgaben des Aufsichtsrats bzw. Beirats im Kontext der Gemeinnützigkeit erläutert.
- Kapitel sechs widmet sich den Grundlagen des Gemeinnützigkeitsrechts und den Anforderungen, die eine gGmbH erfüllen muss, um die Steuervergünstigungen und -befreiungen zu erhalten. Es werden die verschiedenen steuerbegünstigten Zwecke und die Kriterien der Zweckverfolgung erläutert, wie z.B. die Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit.
- In Kapitel sieben werden die formellen Prämissen für die Steuervergünstigung der gGmbH genauer betrachtet. Es wird die Bedeutung der Satzung und der tatsächlichen Geschäftsführung für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit hervorgehoben.
- Kapitel acht beschäftigt sich mit den Tätigkeitsfeldern der gGmbH und der steuerlichen Behandlung der verschiedenen Einnahmenbereiche. Es werden die vier Sphären (ideeller Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) dargestellt.
- Kapitel neun fasst die Steuerbefreiungen der gGmbH in den einzelnen Sphären zusammen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Social Entrepreneurship, gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), Gemeinnützigkeit, Steuerbegünstigung, Zweckverfolgung, Rechtsform, Gesellschaftsrecht und steuerliche Behandlung. Die Arbeit betrachtet die gGmbH als eine interessante und relevante Rechtsform für gemeinnützige Organisationen im Kontext von Social Entrepreneurship und beleuchtet die rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gründung und Tätigkeit.
- Citar trabajo
- Hans-Joachim Frost (Autor), 2017, Social Entrepreneurship (SE) und die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451185