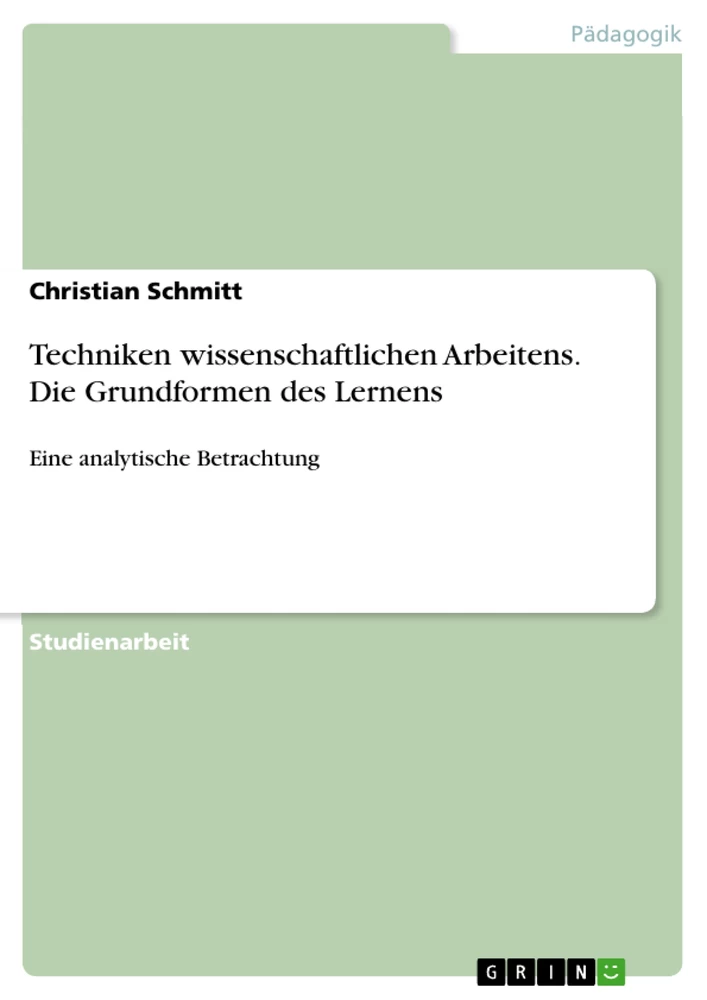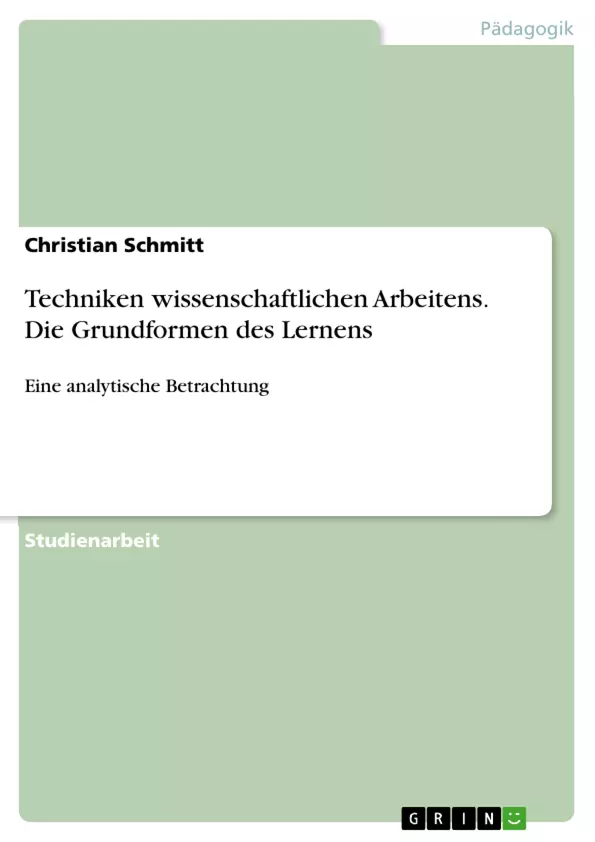Lernen ist eine Aufgabe, die sich Menschen ihr ganzes Leben lang in unterschiedlichen Ausprägungen stellt. Dabei geht es nicht nur um das aneignen von faktischem Wissen, wie mathematische Formeln oder Vokabeln, welches beispielsweise intentional in der Schule oder in anderen Institutionen und Bildungseinrichtungen vermittelt wird, sondern ebenso um die Dinge, denen inzidentell oder implizit im Alltag begegnet wird und das Verhalten wie auch die inneren kognitiven Prozesse beeinflussen. Als Säugling lernt er sich zu bewegen und später als Kleinkind, motorische Fertigkeiten wie Sprechen, Laufen und Schreiben. Ebenso lernt er Regeln beim Spielen und Regeln, die allgemeingeltend in der Gesellschaft vorhanden sind. Als Erwachsener schließlich lernt er Dinge die wichtig sind, sich sowohl im privaten als auch im beruflichen Alltag zurechtzufinden und auch im fortgeschrittenen Alter lernt er noch Dinge, welche sich aus der immerwährenden Entwicklung der Technik ergeben und das Leben beeinflussen. Doch wie funktioniert nun eigentlich Lernen und ist es möglich, bestimmte Grundformen des Lernens zu unterscheiden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff Lernen
- Was ist Lernen
- Die Abgrenzung von Mensch zu Tier
- Kategorisierungsmodelle zum Begriff Lernen
- Formales Lernen
- Nicht-formales Lernen
- Informelles Lernen
- Die Lernformen
- Reiz-Reaktions-Lernen
- Instrumentelles Lernen
- Begriffsbildung und Wissenserwerb
- Handeln und Problemlösen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Phänomen des Lernens und analysiert verschiedene Grundformen des Lernens. Das Ziel der Arbeit ist es, den Begriff "Lernen" aus psychologischer Sicht zu definieren und die Unterschiede zwischen menschlichem und tierischem Lernen zu beleuchten. Darüber hinaus werden verschiedene Kategorisierungsmodelle des Lernens vorgestellt, die auf den Ort des Lernens fokussieren. Der Hauptteil der Arbeit konzentriert sich auf eine detaillierte Betrachtung verschiedener Lerntheorien, um die Prozesse des Lernens zu verdeutlichen.
- Definition des Begriffs "Lernen" aus psychologischer Sicht
- Abgrenzung zwischen menschlichem und tierischem Lernen
- Kategorisierungsmodelle des Lernens (formales, nicht-formales, informelles Lernen)
- Analyse verschiedener Lerntheorien
- Untersuchung der Grundformen des Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit "Lernen" vor und beleuchtet die Bedeutung des lebenslangen Lernprozesses für den Menschen. Dabei wird betont, dass Lernen nicht nur auf das Aneignen von Faktenwissen beschränkt ist, sondern auch implizite und inzidentelle Lernerfahrungen im Alltag umfasst.
Der Begriff Lernen
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Lernen" aus unterschiedlichen Perspektiven und präsentiert verschiedene Definitionen aus der Lernpsychologie. Es werden die Unterschiede zwischen menschlichem und tierischem Lernen erläutert und die gängigen Kategorisierungsmöglichkeiten des Lernens, insbesondere in Bezug auf den Ort des Lernens, vorgestellt.
Die Lernformen
Das Kapitel beleuchtet verschiedene Lerntheorien und analysiert die Konzepte und Besonderheiten der einzelnen Formen. Es werden vier verschiedene Lerntheorien nach Walter Edelmann (2000) dargestellt: Reiz-Reaktions-Lernen, Instrumentelles Lernen, Begriffsbildung und Wissenserwerb sowie Handeln und Problemlösen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Lernen, Lerntheorien, Reiz-Reaktions-Lernen, Instrumentelles Lernen, Begriffsbildung, Wissenserwerb, Handeln, Problemlösen, Formales Lernen, Nicht-formales Lernen, Informelles Lernen, Mensch, Tier, psychologischer Ansatz, Lebenslanges Lernen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen formalem und informellem Lernen?
Formales Lernen findet intentional in Institutionen wie Schulen statt, während informelles Lernen inzidentell oder implizit im Alltag geschieht, ohne dass ein strukturierter Lehrplan vorliegt.
Was versteht man unter „Reiz-Reaktions-Lernen“?
Dies ist eine Lerntheorie, bei der ein bestimmtes Verhalten als Reaktion auf einen äußeren Reiz erlernt wird, oft basierend auf dem Konzept der klassischen Konditionierung.
Wie unterscheidet sich menschliches Lernen von tierischem Lernen?
Die Arbeit grenzt das Lernen des Menschen durch höhere kognitive Prozesse, wie komplexe Begriffsbildung, Sprache und Problemlösungsfähigkeiten, von den eher instinkt- oder reizbasierten Lernformen vieler Tiere ab.
Was ist „instrumentelles Lernen“?
Instrumentelles Lernen (oder operante Konditionierung) bedeutet, dass ein Verhalten häufiger gezeigt wird, wenn es zu einer positiven Konsequenz oder Belohnung führt.
Warum ist „lebenslanges Lernen“ heute so wichtig?
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Technik und Gesellschaft muss der Mensch bis ins hohe Alter neue Fertigkeiten erlernen, um sich im privaten und beruflichen Alltag zurechtzufinden.
- Arbeit zitieren
- Christian Schmitt (Autor:in), 2017, Techniken wissenschaftlichen Arbeitens. Die Grundformen des Lernens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451208