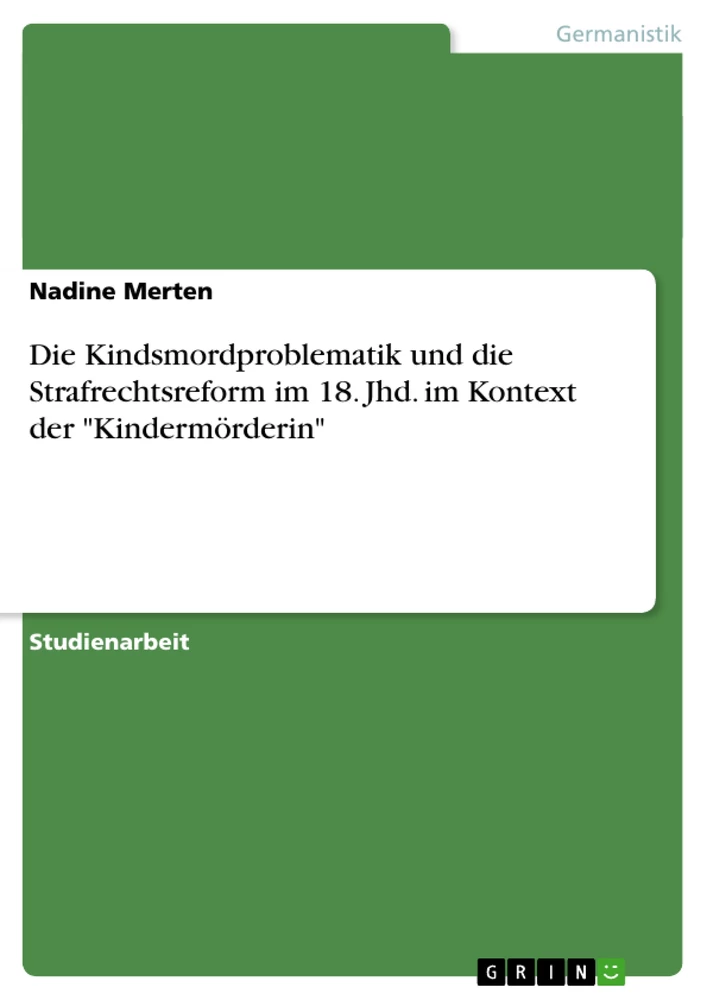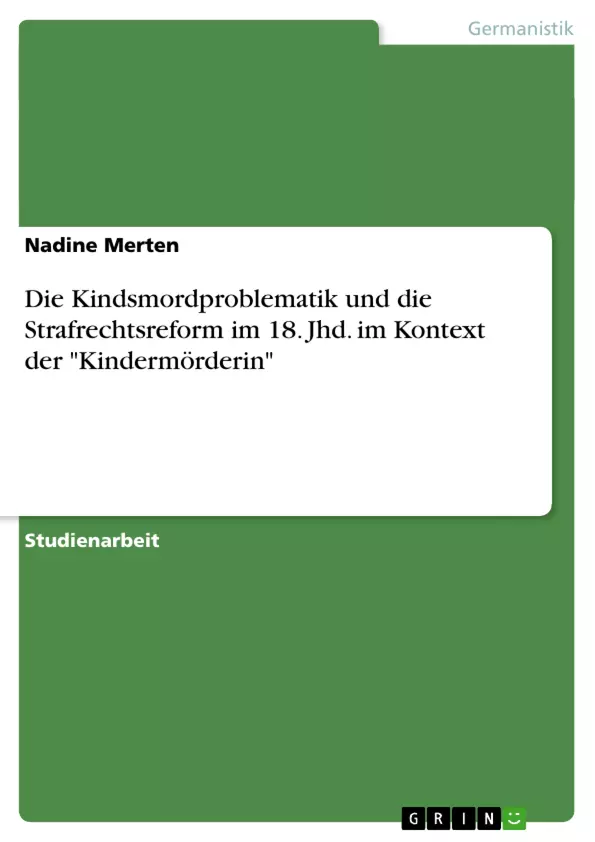Anhand des Werkes "Die Kindermörderin" von Wagner wird die damals aktuelle Problematik des Kindsmordes entfaltet, die sich in zahlreichen anderen Werken dieser Zeit wiederfindet (so auch bei Goethe, Schiller, Lenz...).
Inhaltsverzeichnis
- Die Kindsmordproblematik und die Strafrechtsreform im 18. Jhd.
- Die literarischen Stoffquellen für das Kindsmordmotiv
- Die historische Seite des Themas
- Die Bestrafung des Kindesmordes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit der Problematik des Kindesmordes im 18. Jahrhundert und dessen Darstellung in der deutschen Literatur des Sturm und Drang. Es untersucht die Gründe für die Popularität des Kindsmordmotivs in dieser Epoche und beleuchtet die Rolle der Strafrechtsreform im Kontext der damaligen Zeit.
- Das Kindsmordmotiv in der Literatur des Sturm und Drang
- Die Strafrechtsreform im 18. Jahrhundert
- Die Ursachen des Kindesmordes
- Die Bestrafung des Kindesmordes
- Die Rolle der Religion und der Familie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Kindsmordproblematik und die Strafrechtsreform im 18. Jhd.
Der Text beginnt mit einer Einführung in das Thema Kindesmord im Kontext der Strafrechtsreform des 18. Jahrhunderts. Er beschreibt das Streben nach einer milderen Strafrechtspflege in Europa, die jedoch je nach Land unterschiedliche Schwerpunkte hatte. In Deutschland zeigte sich die Problematik besonders deutlich am Motiv des Kindesmordes, das von zahlreichen Dichtern des Sturm und Drangs aufgegriffen wurde. Die Autoren des Sturm und Drang, die sich häufig mit juristischen Studien beschäftigten, sahen den Menschen als determiniert und die Verbrechen als Produkt der Gesellschaft. Die Hinrichtungen dieser Zeit inspirierten sie zu literarischen Werken, die ihrer Entrüstung über die damalige Justiz Luft machten.
Die literarischen Stoffquellen für das Kindsmordmotiv
Der Text untersucht die literarischen Quellen des Kindsmordmotivs, darunter das Puppenspiel, das Bänkelsängerlied und das Volkslied. Er zeigt auf, dass Wagner in seiner „Kindermörderin“ das Motiv des Schlaftrunks aus einem Volkslied und das Freudenhaus aus Richardsons Roman „Clarisse Harlowe“ entnahm. Der Kindesmord diente den Dichtern des Sturm und Drangs als Mittel, um die Rückständigkeit und Grausamkeit der damaligen Verfassung und Justiz zu kritisieren.
Die historische Seite des Themas
Der Text schildert die Armut der Bevölkerung im 18. Jahrhundert, die im Gegensatz zum Luxus an den Fürstenhöfen stand. Die Steuern, die die Bürger und Bauern zahlen mussten, finanzierten diesen Luxus. Die Offiziere und Soldaten, die zur Ehelosigkeit gezwungen waren, stellten eine ständige Gefahr für die Bürgerstöchter dar, da sie in deren Familien einquartiert wurden. Der Text zitiert Friedrich den Großen, der die damalige Zeit als geprägt von Armut, Ausbeutung und Anarchie beschreibt. Die Strafrechtspflege diente damals vor allem der Vergeltung und Abschreckung, eine Rehabilitation des Verbrechers war nicht vorgesehen. Die Todesstrafe wurde häufig angewendet und wurde mit besonders grausamen Methoden vollzogen.
Schlüsselwörter
Kindesmord, Strafrechtsreform, Sturm und Drang, Determinismus, Literatur, Volkslied, Puppenspiel, Bänkelsängerlied, Friedrich der Große, Todesstrafe, Religionsverständnis, Familie, patria potestas, Carolina, Feuerbach, Pestalozzi, Unzucht, Armut, Ehelosigkeit, Schuld, Verführung, Schuldfrage
Häufig gestellte Fragen
Warum war das Thema Kindsmord im 18. Jahrhundert so präsent?
Kindsmord war eine Folge extremer Armut, sozialer Ausgrenzung unehelicher Mütter und drakonischer Strafen. Literaten des Sturm und Drang nutzten das Motiv, um die grausame Justiz und veraltete Moralvorstellungen zu kritisieren.
Welche Rolle spielte die Strafrechtsreform in dieser Zeit?
Im 18. Jahrhundert gab es Bestrebungen für ein milderes Strafrecht. Denker wie Feuerbach und Pestalozzi setzten sich gegen die grausamen Hinrichtungsmethoden und für eine humanere Behandlung ein.
Welche literarischen Werke behandeln den Kindsmord?
Besonders bekannt ist Wagners „Die Kindermörderin“. Auch Goethe (Gretchen-Tragödie im Faust), Schiller und Lenz griffen dieses Motiv auf.
Wie wurden Kindsmörderinnen damals bestraft?
Die Strafen waren extrem hart und dienten der Abschreckung. Häufig wurde die Todesstrafe durch Enthaupten, Ertränken oder Lebendigbegraben vollstreckt.
Was waren die gesellschaftlichen Ursachen für diese Verbrechen?
Neben der Armut spielte die Verführung durch Soldaten (die oft nicht heiraten durften) und der drohende soziale Ruin sowie die Verstoßung durch die Familie eine entscheidende Rolle.
- Quote paper
- Nadine Merten (Author), 2003, Die Kindsmordproblematik und die Strafrechtsreform im 18. Jhd. im Kontext der "Kindermörderin", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45128