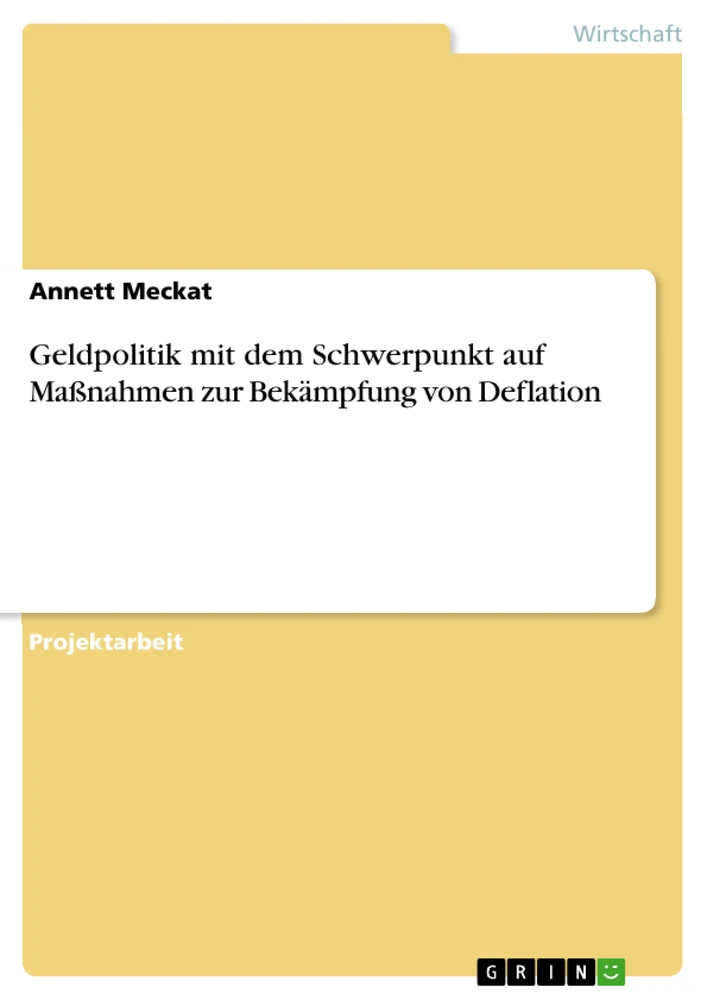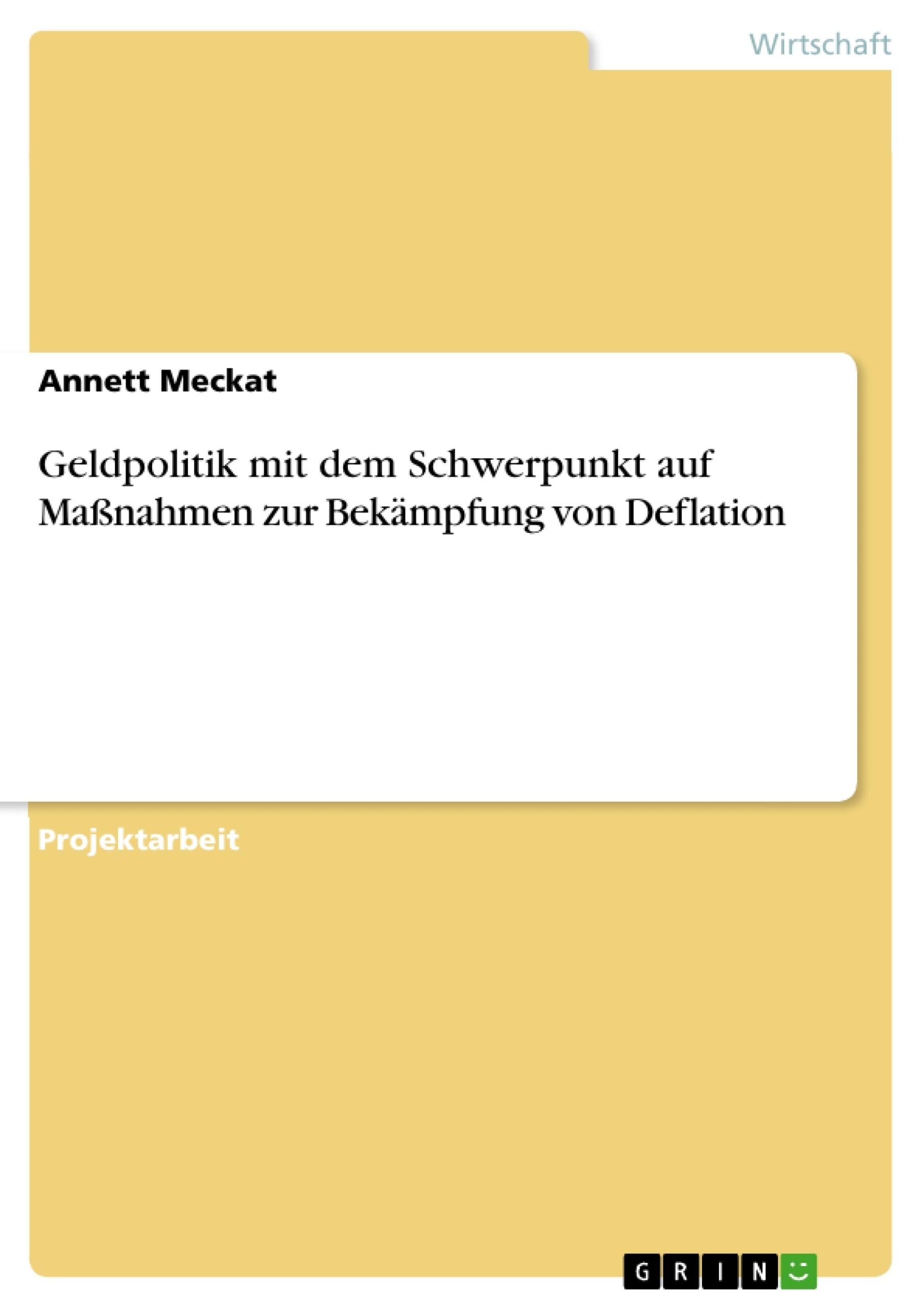Bei einer fehlgeleiteten Geldpolitik werden die Funktionen des Geldes beeinträchtigt und die Ausmaße sind für jeden Marktteilnehmer spürbar. So sind beispielsweise im Euroraum seitdem die EZB im Jahr 1999 für die Geldpolitik zuständig ist, die durchschnittlichen Zinsen auf täglich fällige Spareinlagen von 1,29 % auf 0,03 % und die durchschnittlichen Zinsen für Konsumentenkredite mit einem Jahr Laufzeit von 6,51 % auf 4,46 % gesunken. Eine logische Auswirkung ist folglich, dass die Marktteilnehmer, um den Wertverlust ihres Einkommens zu vermeiden, nicht mehr sparen, sondern in werthaltige Güter (Immobilien) investieren. Aufgrund der steigenden Nachfrage sind die Immobilienpreise in den letzten Jahren förmlich explodiert. So ist der Baupreisindex für Wohngebäude im Mai 2018 um 4,1 % gegenüber dem Mai 2017 gestiegen. Mit steigenden Baupreisen erhöhen sich auch die Mietpreise, was wiederum zum weiteren Sinken der Realeinkommen führt. Nun wurde in der Pressekonferenz der EZB vom 13.09.2018 voraussichtlich ab Sommer 2019 erstmals wieder eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt.
Die vorgelegte Projektarbeit hinterfragt, warum trotz guter Konjunkturlage in Deutschland weiterhin eine expansive Geldpolitik betrieben wird. Hierfür werden die Ursachen, Instrumente und Auswirkungen dieser Politik kritisch untersucht. Vorab erfolgt eine Einordnung der Geldpolitik in das System der Wirtschaftspolitik und eine Erläuterung der Geldwertstörungen mit deren Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Die kritische Beurteilung erfolgt auf der Grundlage von Literaturrecherchen und Auswertungen von Statistiken der Zentralbanken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Problemstellung
- Einordnung der Geldpolitik in das System der Wirtschaftspolitik
- Konjunktur und Wirtschaftspolitik
- Magisches Viereck und weitere Zielstellungen
- Geldwertstörungen
- Geldmengen, Kaufkraft und Preisniveau
- Arten der Geldwertstörung und deren Folgen
- Maßnahmen zur Dämpfung von Geldwertstörungen
- Das Banken- und Finanzsystem
- Geldpolitische Strategien und Instrumente
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Geldpolitik mit dem Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Deflation. Sie befasst sich mit der Einordnung der Geldpolitik in das System der Wirtschaftspolitik und beleuchtet die Rolle von Geldmengen, Kaufkraft und Preisniveau bei Geldwertstörungen. Weiterhin werden verschiedene Strategien und Instrumente zur Dämpfung von Geldwertstörungen sowie ihre Anwendung im Banken- und Finanzsystem untersucht.
- Einordnung der Geldpolitik in das System der Wirtschaftspolitik
- Geldwertstörungen und deren Folgen
- Geldmengen, Kaufkraft und Preisniveau
- Maßnahmen zur Bekämpfung von Deflation
- Geldpolitische Strategien und Instrumente
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beschreibt die Problemstellung im Kontext der aktuellen Wirtschaftslage und Geldpolitik. Kapitel 2 betrachtet die Einordnung der Geldpolitik in das System der Wirtschaftspolitik, insbesondere in Bezug auf Konjunktur und Wirtschaftspolitik. Des Weiteren werden die Ziele der Geldpolitik, insbesondere das Magische Viereck, betrachtet.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit Geldwertstörungen, insbesondere mit der Inflation und Deflation. Es werden die Auswirkungen von Geldmengen, Kaufkraft und Preisniveau auf die Geldwertstabilität erörtert.
Kapitel 4 beleuchtet Maßnahmen zur Dämpfung von Geldwertstörungen. Es werden das Banken- und Finanzsystem sowie die Geldpolitischen Strategien und Instrumente der Europäischen Zentralbank vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Geldpolitik, Deflation, Wirtschaftspolitik, Geldwertstörungen, Geldmengen, Kaufkraft, Preisniveau, Banken- und Finanzsystem, Geldpolitische Strategien und Instrumente.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird trotz guter Konjunktur eine expansive Geldpolitik betrieben?
Die Arbeit untersucht die Ursachen dieser Politik, die primär auf die Bekämpfung von Deflationsrisiken und die Stabilisierung des Preisniveaus abzielt.
Welche Folgen haben extrem niedrige Zinsen?
Niedrige Zinsen führen oft zu einer Flucht in Sachwerte wie Immobilien, was die Preise explodieren lässt und die Realeinkommen durch steigende Mieten mindert.
Was ist das "Magische Viereck"?
Es beschreibt die vier Hauptziele der Wirtschaftspolitik: Preisstabilität, hoher Beschäftigungsstand, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und stetiges Wirtschaftswachstum.
Wie definiert sich Deflation?
Deflation ist ein allgemeiner und anhaltender Rückgang des Preisniveaus für Güter und Dienstleistungen, was oft zu Investitionszurückhaltung führt.
Welche Instrumente nutzt die EZB zur Bekämpfung von Deflation?
Dazu gehören Leitzinssenkungen, Anleihekaufprogramme und die Bereitstellung von Liquidität für Banken.
- Citation du texte
- Annett Meckat (Auteur), 2018, Geldpolitik mit dem Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Deflation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451335