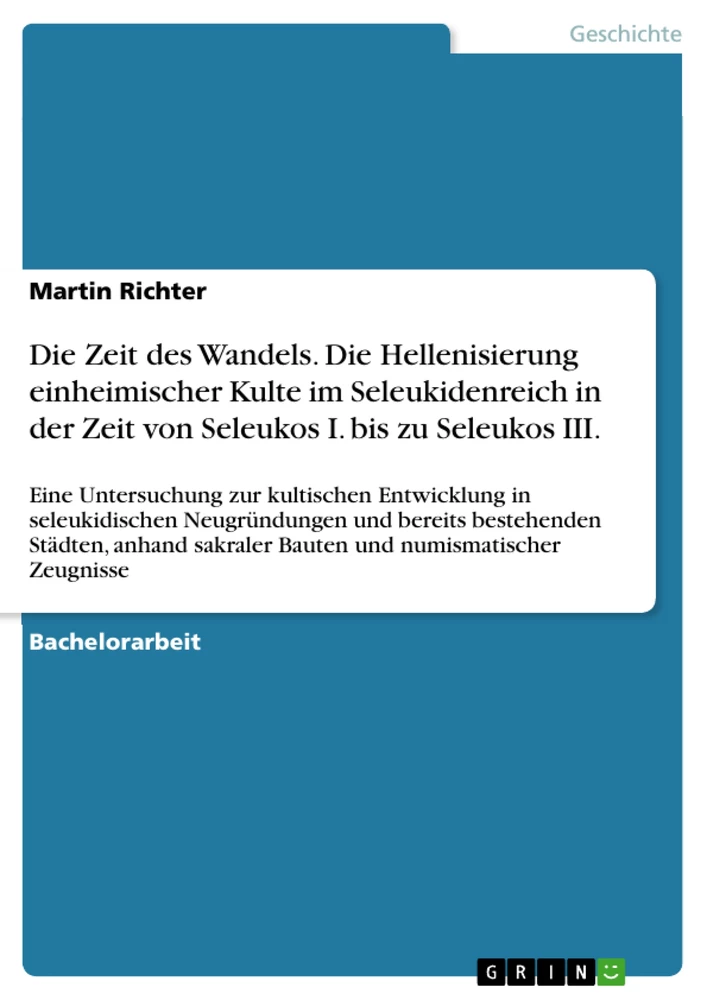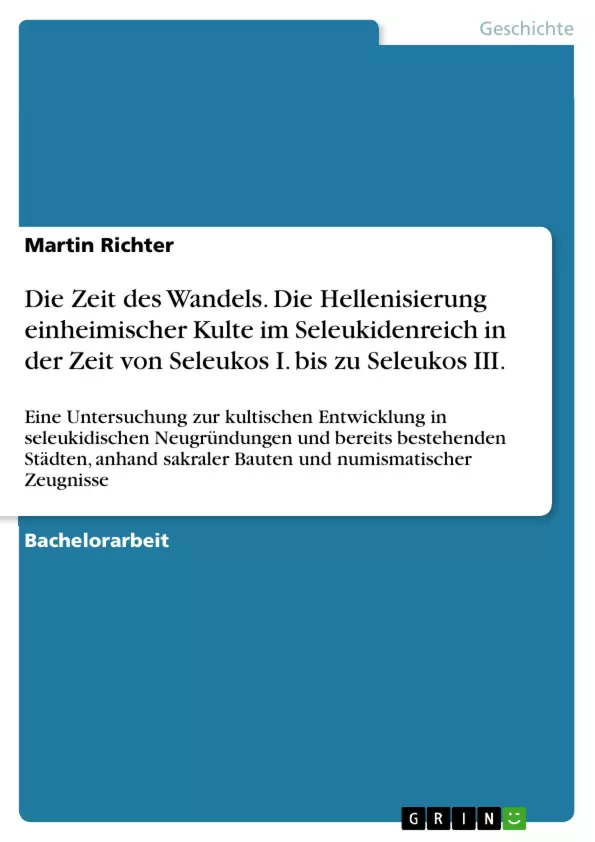Um eine Arbeit zu schreiben, die sich mit Hellenisierungsprozessen auseinandersetzt, ist es von Nöten sich vor Augen zu führen, was der Begriff des Hellenismus oder der Hellenisierung beinhaltet und beschreibt. Der allgemeine Epochenbegriff geht auf Johann Gustav Droysen zurück, der diesen erstmals verwendete. Er bezog sich dabei offensichtlich, laut Hans-Joachim Gehrke, auf Hegel, für den „das Voranschreiten in der Geschichte in einer spezifischen Dialektik [besteht], einem Widerspiel von Gegensätzen und Spannungen, die zu einer Synthese führen, in der die Gegensätze aufgehoben sind.“ Weiter heißt es bei Gehrke: „Eine solche Synthese stellte für Droysen der Hellenismus dar, in dem sich die gegensätzlichen Kulturen von Morgenland und Abendland, Orient und Okzident, verkörpert durch die griechische und altorientalische Tradition, miteinander verbanden.“
Welche zeitliche Einordnung ist aber mit dieser Kulturepoche verbunden? Wenn man Droysen folgen will, so beginnt die Epoche des Hellenismus mit der Machtergreifung vom Alexander dem Großen 336 v. Chr. Er begründet diese Ansetzung damit, dass er schreibt: „Die zweihundertjährigen Kämpfe der Hellenen mit den Persern, das erste große Ringen des Abendlandes mit dem Morgenlande, von dem die Geschichte weiß, schließt Alexander mit der Vernichtung des Perserreiches, mit der Eroberung bis zur afrikanischen Wüste und über den Jaxartes, den Indus hinaus, mit der Verbreitung griechischer Herrschaft und Bildung über die Völker ausgelebter Kulturen, mit dem Anfang des Hellenismus.“
Jedoch gehen heutzutage nicht alle Forscher mit dieser zeitlichen Ansetzung konform. Für viele ist der Epochenbeginn erst nach dem Tode Alexanders anzusetzen. Meißner zum Beispiel begründet diesen Fakt damit, dass seiner Meinung nach Philipp II. bereits mit einbezogen werden müsste, da dieser die Griechen einte um im Korinthischen Bund gegen das Achämenidenreich vorzugehen. Meiner Meinung nach wäre es korrekter die Epoche mit Alexander beginnen zulassen, da das, was den Hellenismus auszeichnet, nämlich die Monarchie, mit diesem seinen Anfang nahm. Somit gehe ich von einem Beginn im Jahre 336 v. Chr. aus, also dem Regierungsantritt von Alexander dem Großen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele der Arbeit
- Was ist Hellenismus bzw. Hellenisierung?
- geschichtlicher Abriss über die Zeit der frühen Seleukiden
- Die Entstehung des Diadochenreiches unter Seleukos I.
- Die Zeit von Antiochos I. bis Seleukos III.
- Die einheimischen Religionen im Bereich des späteren Seleukidenreiches
- Die Kleinasiatischen Religionen
- Lykier
- Karier
- Lydier
- Phrygier
- Die aramäische Religion
- Die mesopotamische Religion
- Zoroastrismus
- Die göttliche Verehrung der Seleukidenherrscher
- Allgemeines
- Seleukos I. Nikator
- Stätten der kultischen Verehrung
- numismatische Zeugnisse
- Antiochos I. Soter
- Stätten der kultischen Verehrung
- numismatische Zeugnisse
- Antiochos II. Teos - Seleukos II. Kallinikos - Seleukos III. Keraunos
- Die kultische Entwicklung in den Städten
- Stadtgründungspolitik der Seleukiden
- Kleinasien
- Sardes
- Allgemeine Informationen
- Der Tempel der Artemis
- Magnesia am Mäander
- Allgemeine Informationen
- Der Tempel der Artemis Leukophyene
- Syrien
- Abriss zur Geschichte Syriens
- Seleukeia Pieria
- Mesopotamien
- Uruk
- Geschichtlicher Überblick
- Anu-Zikkurrat
- Irigal
- Bīt Reš
- Ikaros/Failaka
- Tempel A
- Tempel B
- Baktrien - Ai Khanoum
- ,Temple à niches indentes' bzw.,Temple à redans'
- Das Heroon des Kineas
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Hellenisierung einheimischer Kulte im Seleukidenreich, genauer in der Zeit von Seleukos I. bis zu Seleukos III. Ziel ist es, herauszufinden, ob es im Seleukidenreich überhaupt einen Prozess der Hellenisierung gab, wie dieser sich im gesamten Herrschaftsbereich vollzog oder ob er regional beschränkt war. Darüber hinaus soll geklärt werden, wie die Verehrung einheimischer und griechischer Gottheiten nebeneinander existierte oder sich gegenseitig beeinflusste. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der Hellenisierung auf die Sakralarchitektur, insbesondere auf die Bauweise neuer Tempel im Vergleich zu einheimischen Traditionen.
- Hellenisierung einheimischer Kulte im Seleukidenreich
- Einfluss der Hellenisierung auf die Sakralarchitektur
- Verehrung einheimischer und griechischer Gottheiten
- Regionale Unterschiede in der Hellenisierung
- Bedeutung des Herrscherkultes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Begriff des Hellenismus, seine zeitliche Einordnung und die Ziele der Arbeit. Sie stellt die Frage, ob und in welchem Umfang eine Hellenisierung einheimischer Kulte im Seleukidenreich stattfand und welche regionalen Besonderheiten dabei zu beobachten sind. Darüber hinaus wird die Frage nach der Koexistenz und Vermischung einheimischer und griechischer Gottheiten sowie deren Einfluss auf die sakrale Architektur behandelt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit den einheimischen Religionen im späteren Seleukidenreich. Es werden die Religionen Kleinasiens, Mesopotamiens und der Aramäer sowie der Zoroastrismus vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich der göttlichen Verehrung der Seleukidenherrscher. Es werden allgemeine Aspekte der Herrscherverehrung behandelt sowie die Verehrung von Seleukos I., Antiochos I. und Antiochos II., Seleukos II. und Seleukos III. anhand von Stätten der kultischen Verehrung und numismatischen Zeugnissen beleuchtet.
Kapitel 4 untersucht die kultische Entwicklung in verschiedenen Städten des Seleukidenreiches. Es werden die Stadtgründungspolitik der Seleukiden sowie die Situation in Kleinasien, Syrien und Mesopotamien betrachtet. Anhand von Beispielstädten wie Sardes, Magnesia am Mäander, Seleukeia Pieria, Uruk und Ai Khanoum wird die Wechselwirkung zwischen einheimischen Traditionen und Hellenisierungsprozessen in der Architektur und Religion untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Hellenismus und der Hellenisierung einheimischer Kulte im Seleukidenreich. Wichtige Themen sind die sakrale Architektur, die Verehrung griechischer und einheimischer Gottheiten, die Stadtgründungspolitik der Seleukiden und die Rolle des Herrscherkultes. Insbesondere die Untersuchung von numismatischen Zeugnissen und sakralen Bauten liefert wichtige Erkenntnisse über die Prozesse der kultischen Entwicklung im seleukidischen Herrschaftsbereich.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Hellenisierung im Seleukidenreich?
Es bezeichnet den Prozess der Verbreitung griechischer Kultur, Sprache und Religion sowie deren Vermischung mit einheimischen Traditionen im Herrschaftsbereich der Seleukiden.
Wann begann die Epoche des Hellenismus?
Traditionell wird der Beginn mit der Machtergreifung Alexanders des Großen 336 v. Chr. angesetzt.
Wie beeinflussten sich griechische und einheimische Kulte?
Oft existierten sie nebeneinander oder verschmolzen (Synkretismus), was sich besonders in der Sakralarchitektur und in numismatischen Zeugnissen zeigt.
Was war der Seleukidische Herrscherkult?
Die religiöse Verehrung der Könige (wie Seleukos I. oder Antiochos I.) als göttliche Wesen, um die Loyalität im Vielvölkerstaat zu sichern.
Welche Städte werden in der Arbeit untersucht?
Die Analyse umfasst Orte wie Sardes und Magnesia in Kleinasien, Seleukeia Pieria in Syrien sowie Uruk in Mesopotamien.
- Arbeit zitieren
- Martin Richter (Autor:in), 2010, Die Zeit des Wandels. Die Hellenisierung einheimischer Kulte im Seleukidenreich in der Zeit von Seleukos I. bis zu Seleukos III., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451399