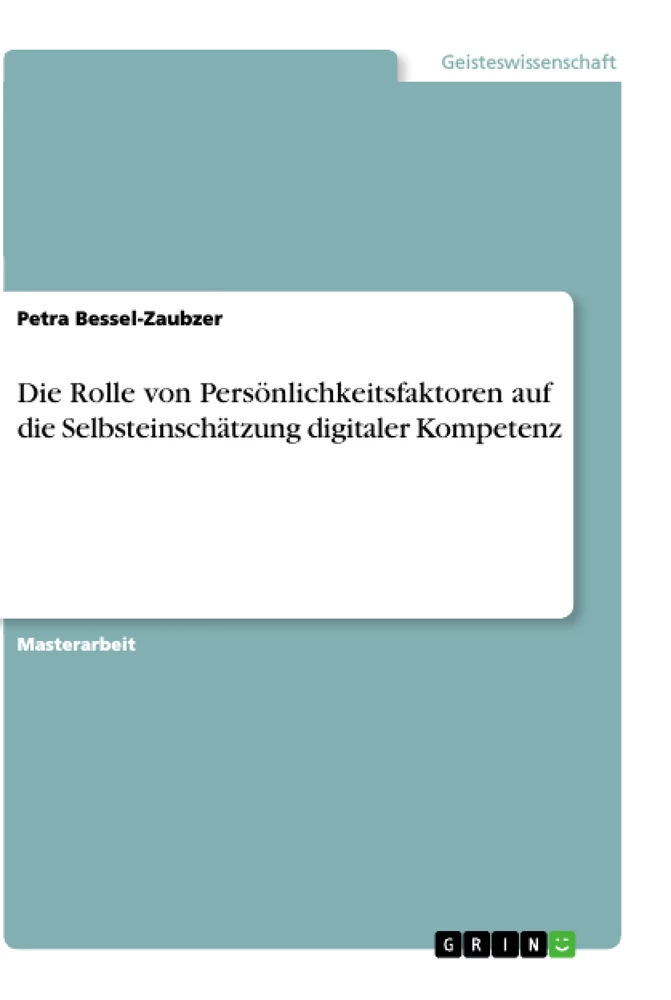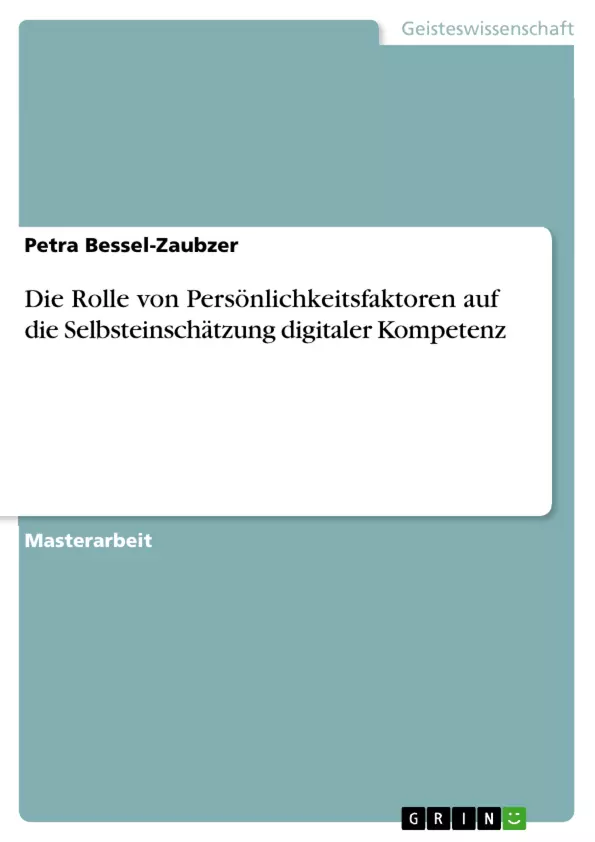Mit der Erfindung des PCs in den 70er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts, seinem Siegeszug in die Büros als Textverarbeitungssystem in den 80er Jahren und der Verbreitung des Internets im darauffolgenden Jahrzehnt hat ein neues Zeitalter für das Arbeitsleben begonnen. Die Digitalisierung hat unser Leben von Grund auf verändert und erfordert neue Kompetenzen zur Bewältigung der Herausforderungen in der neuen, digitalen Umgebung. Doch wie kompetent fühlen sich Anwender bei der Bedienung des Internets und welchen Einfluss hat die Persönlichkeit auf diese Einschätzung?
Es ist anzunehmen, dass das Konstrukt der "Digitalen Kompetenz" über die Begrifflichkeit der Computerkompetenz beziehungsweise der Internet(nutzungs)kompetenz hinausgeht. Damit stellt sich die Frage: Was ist unter dem Konstrukt der "Digitalen Kompetenz" zu verstehen? Und darüber hinaus: Wie kann man dieses Konstrukt beschreiben und erfassen?
Die Europäische Union hat bereits 2006 in einem Dossier die "Computerkompetenz" als Schlüsselkompetenz aufgeführt. Für Unternehmen eröffnet die Digitalisierung Innovationspotentiale und demzufolge Wettbewerbsvorteile, wenn diese Potentiale ausgeschöpft werden können. So gelangt die digitale Kompetenz der Mitarbeiter und Führungskräfte auch in den Fokus der Unternehmen. Neun von zehn Führungskräften halten die digitale Kompetenz der Mitarbeiter als erfolgsentscheidend für die zukünftige Unternehmensentwicklung und ein Großteil der Unternehmen erkennt genau darin einen enormen Handlungsbedarf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsfrage
- Vorgehensweise
- Theoretische Betrachtungen
- Das Phänomen der Persönlichkeit
- Zur wissenschaftlichen Debatte über Persönlichkeitsfaktoren
- Zum Big-Five-Konzept der Persönlichkeit
- Das wissenschaftliche Verständnis über Kompetenz und seine Erfassung
- Zum allgemeinen Kompetenzverständnis
- Möglichkeiten der Kompetenzmessung
- Die Bedeutung des Konstruktes „Digitale Kompetenz“
- Begriffliche Entwicklung des Konstruktes „Digitale Kompetenz“ und ähnlicher Konstrukte
- Das Konzept der Europäischen Union zur „Digitalen Kompetenz“
- Der Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsfaktoren und (digitaler) Kompetenz
- Ableitung von Hypothesen aus den bisherigen Betrachtungen
- Methodisches Vorgehen
- Das Untersuchungsdesign
- Die Messverfahren
- Zur deutschen Version des Big Five Inventory 2 (BFI-2)
- Beschreibung des Messinstrumentes
- Gütekriterien
- Das Raster zur Selbstbeurteilung digitaler Kompetenzen der EU
- Beschreibung des Messinstrumentes
- Gütekriterien
- Untersuchungsdurchführung
- Ergebnisse
- Stichprobenbeschreibung
- Hypothesentest
- Prüfen der Voraussetzungen
- Testresultate
- Diskussion
- Zusammenfassung
- Kritische Reflexion des methodischen Vorgehens
- Schlussfolgerungen und Empfehlungen für weitere Studien
- Das Konzept der digitalen Kompetenz und seine Bedeutung in der heutigen Arbeitswelt
- Die Rolle von Persönlichkeitsfaktoren, insbesondere im Kontext der Big-Five-Persönlichkeitstheorie
- Die Erfassung von digitaler Kompetenz durch Selbstauskunft
- Die Untersuchung der Beziehung zwischen Persönlichkeitseigenschaften und der Selbsteinschätzung digitaler Kompetenz
- Die Ableitung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen für weitere Studien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Rolle von Persönlichkeitsfaktoren auf die Selbsteinschätzung digitaler Kompetenz. Sie verfolgt das Ziel, das Zusammenspiel zwischen Persönlichkeitseigenschaften und der Selbsteinschätzung digitaler Kompetenzen zu untersuchen und potenzielle Zusammenhänge aufzudecken.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der digitalen Kompetenz für die heutige Arbeitswelt heraus und beschreibt die Entwicklung von der ersten industriellen Revolution bis hin zur digitalen Revolution. Außerdem wird die Forschungsfrage formuliert und die Vorgehensweise der Untersuchung skizziert.
Das Kapitel "Theoretische Betrachtungen" beleuchtet verschiedene Aspekte, die für die Untersuchung relevant sind. Es werden das Phänomen der Persönlichkeit mit Fokus auf die wissenschaftliche Debatte über Persönlichkeitsfaktoren und das Big-Five-Konzept erörtert. Zudem wird das wissenschaftliche Verständnis von Kompetenz und dessen Erfassung beleuchtet. Schließlich werden die Bedeutung des Konstruktes „Digitale Kompetenz“, dessen begriffliche Entwicklung und das Konzept der Europäischen Union zur „Digitalen Kompetenz“ erläutert.
Das Kapitel "Methodisches Vorgehen" beschreibt das Untersuchungsdesign, die verwendeten Messverfahren, die Durchführung der Untersuchung und die Analyse der Ergebnisse. Dabei werden sowohl das Big Five Inventory 2 (BFI-2) als auch das Raster zur Selbstbeurteilung digitaler Kompetenzen der EU vorgestellt und deren Gütekriterien analysiert.
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Stichprobenbeschreibung und die Ergebnisse des Hypothesentests. Dabei wird der Fokus auf die Prüfung der Voraussetzungen und die Interpretation der Testresultate gelegt.
Schlüsselwörter
Digitale Kompetenz, Persönlichkeitsfaktoren, Big-Five-Modell, Selbsteinschätzung, Kompetenzmessung, Europäische Union, Forschungsdesign, Hypothesentest
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Persönlichkeit die digitale Kompetenz?
Bestimmte Persönlichkeitsfaktoren aus dem Big-Five-Modell, wie Offenheit für Erfahrungen, korrelieren positiv mit der Selbsteinschätzung der eigenen digitalen Fähigkeiten.
Was versteht die EU unter „Digitaler Kompetenz“?
Die EU definiert digitale Kompetenz als Schlüsselkompetenz, die den sicheren und kritischen Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien umfasst.
Wie wird digitale Kompetenz gemessen?
Häufig geschieht dies über Selbsteinschätzungsraster (z. B. das EU-Raster), in denen Anwender ihre Fähigkeiten in Bereichen wie Informationsverarbeitung oder Sicherheit bewerten.
Was ist das Big-Five-Modell?
Es ist ein wissenschaftliches Konzept, das die menschliche Persönlichkeit in fünf Dimensionen unterteilt: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus.
Warum ist digitale Kompetenz für Unternehmen wichtig?
Neun von zehn Führungskräften halten sie für erfolgsentscheidend, da sie die Basis für Innovationen und Wettbewerbsvorteile in der digitalen Transformation bildet.
- Quote paper
- Petra Bessel-Zaubzer (Author), 2018, Die Rolle von Persönlichkeitsfaktoren auf die Selbsteinschätzung digitaler Kompetenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451706