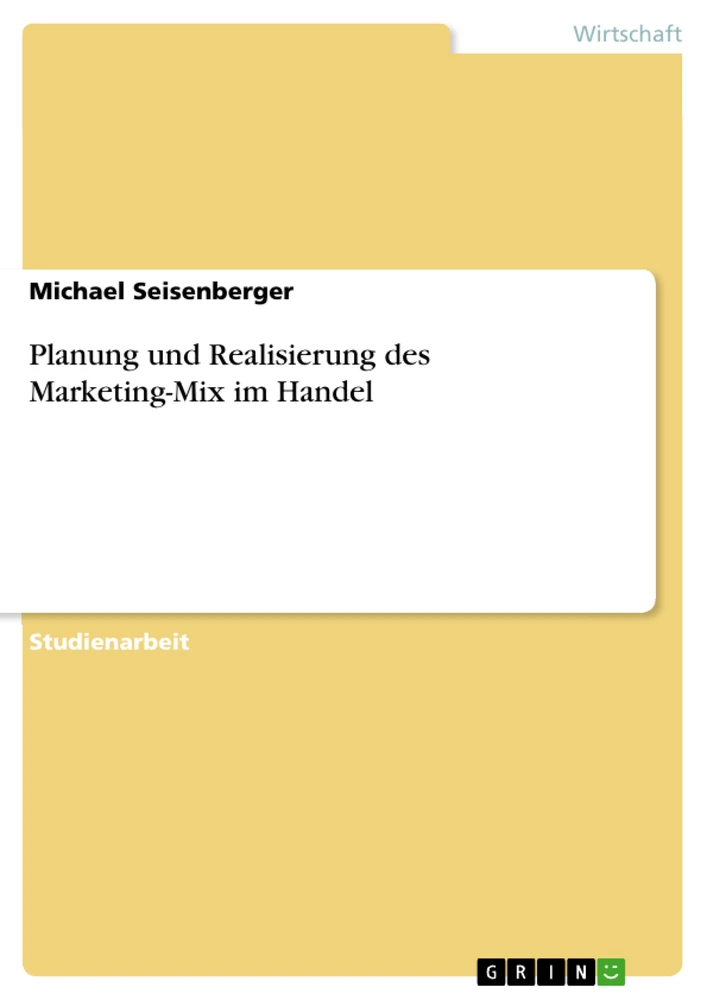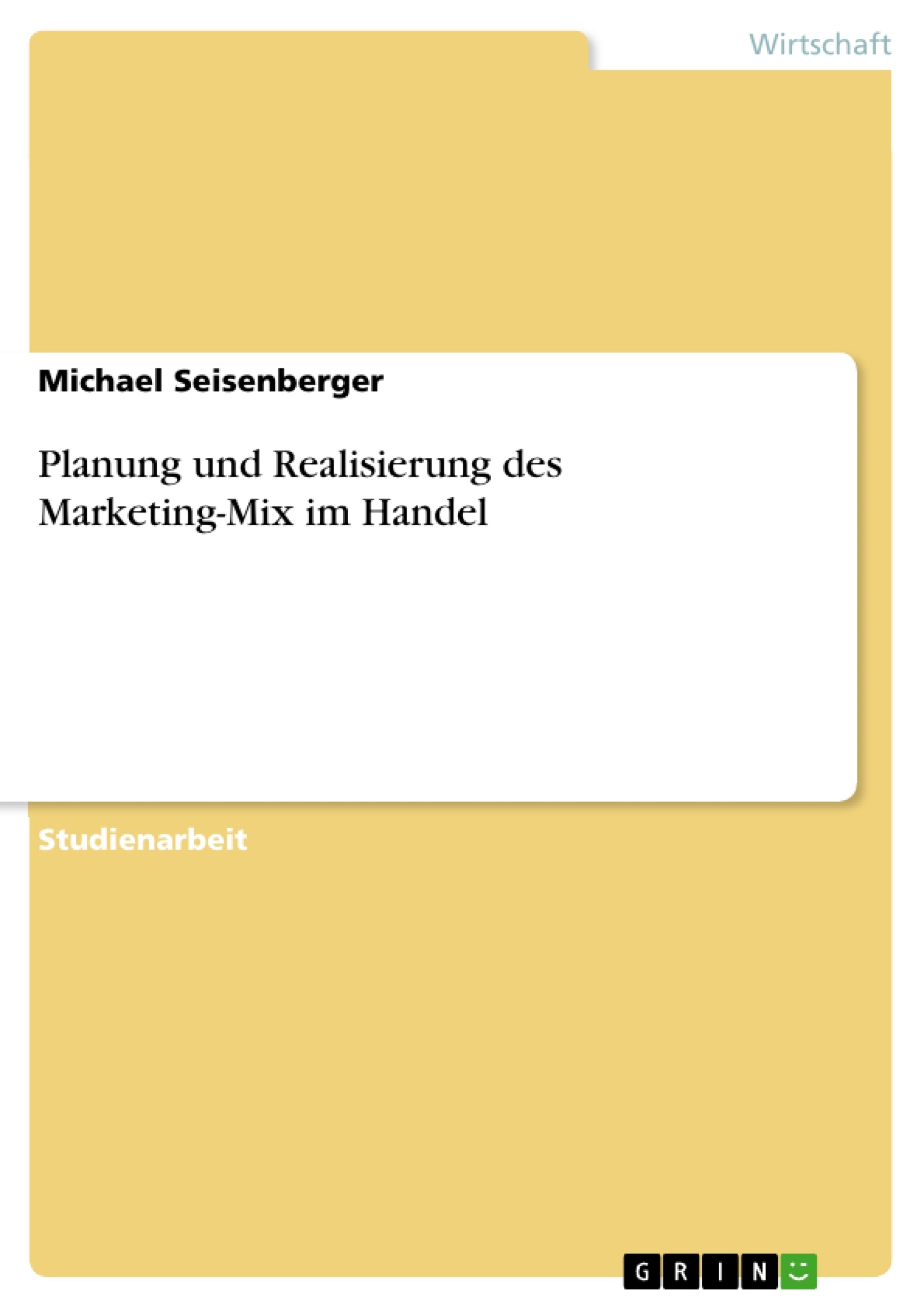Das Ziel der Arbeit ist es, die Planung und Realisierung des Marketing-Mix im Handel anhand von inhaltlichen und zeitlichen Aspekten kritisch zu analysieren. Der Aufbau der Arbeit ist der Planung und der Realisierung des Marketing-Mix nachempfunden. Der Planung des Marketing-Mix wird die Analyse der Ausgangssituation vorangestellt. Dazu gehört beispielsweise eine Portfolio- oder eine SWOT-Analyse. Danach wird die strategische Marketingplanung vorgestellt und zwei Marketingstrategien erläutert. Dies schließt den Teil der Planung ab. Mit „operatives Marketing“ ist nun die Realisierung des Marketing-Mix gemeint. Dort werden unter anderem die klassischen „4Ps“ vorgestellt. Die wissenschaftliche Arbeit wird durch die Unterscheidung von Hersteller- und Handelsmarketing, sowie durch einen kleinen Ausblick auf die Erfolgskontrolle im Handel – das Handelscontrolling – abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Ziel der Praxisarbeit
- 2 Der Handel - Der Gegenstand der Untersuchung.
- 2.1 Der Begriff Handel
- 2.2 Die merkantile Revolution..
- 3 Handelsfunktionen......
- 4 Informationen als Grundlage der Planung
- 5 Strategisches Marketing......
- 5.1 Analyse der strategischen Ausgangssituation
- 5.1.1 Portfolioanalyse......
- 5.1.2 SWOT – Analyse ...
- 5.2 Ausgewählte Marketing-Strategien
- 5.2.1 Produkt-Markt-orientierte Strategie
- 5.2.2 Marktsegment-orientierte Strategie.
- 6 Operatives Marketing ..
- 6.1 Produktpolitik.......
- 6.1.1 Produktpolitik im engeren Sinne.
- 6.1.2 Gestaltung der Produktpolitik.
- 6.2 Preispolitik..\n6.2.1 Preisbestimmung\n6.2.2 Konditionenpolitik
- 6.3 Vertriebspolitik
- 6.4 Kommunikationspolitik...…….\n6.4.1 Social Networks als Instrument\n6.4.2 Product Placement......
- 7 Die Unterschiede zwischen Handels-Marketing und Hersteller-Marketing ...............
- 8 Erfolgskontrolle im Handel.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert kritisch die Planung und Realisierung des Marketing-Mix im Handel anhand inhaltlicher und zeitlicher Aspekte. Die Arbeit folgt dabei dem Aufbau der Planung und Realisierung des Marketing-Mix, beginnend mit der Analyse der Ausgangssituation, gefolgt von der strategischen Marketingplanung und schließlich der operativen Umsetzung. Es werden wichtige Konzepte wie Portfolio- und SWOT-Analyse sowie die klassischen „4Ps“ des Marketing-Mix vorgestellt. Darüber hinaus wird die Unterscheidung von Hersteller- und Handelsmarketing beleuchtet, sowie ein kurzer Blick auf die Erfolgskontrolle im Handel – das Handelscontrolling – geworfen.
- Die Bedeutung des Handels und seine Entwicklung
- Die Planung und Realisierung des Marketing-Mix im Handel
- Die Analyse der strategischen Ausgangssituation
- Strategische und operative Marketingplanung
- Die Unterscheidung zwischen Hersteller- und Handelsmarketing
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert das Ziel der Arbeit und beschreibt den Aufbau. Es stellt die Untersuchung des Handels und der Marketing-Mix-Planung in den Kontext des Handels-Marketings.
Kapitel 2 befasst sich mit dem Handel als Gegenstand der Untersuchung. Es erläutert den Begriff Handel, die „merkantile Revolution“ und die verschiedenen Handelsfunktionen.
Das dritte Kapitel behandelt die Informationen als Grundlage der Planung des Marketing-Mix. Es beleuchtet die Relevanz von Daten und deren Verwendung bei der Entscheidungsfindung.
In Kapitel 4 wird das strategische Marketing im Handel beleuchtet. Es beinhaltet die Analyse der strategischen Ausgangssituation mithilfe von Portfolio- und SWOT-Analysen und stellt verschiedene Marketingstrategien vor.
Kapitel 5 befasst sich mit dem operativen Marketing im Handel. Es stellt die klassischen „4Ps“ des Marketing-Mix vor: Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik.
Kapitel 6 untersucht die Unterschiede zwischen Handels- und Hersteller-Marketing, wobei die spezifischen Herausforderungen und Besonderheiten des Handels-Marketings hervorgehoben werden.
Schließlich beschäftigt sich Kapitel 7 mit der Erfolgskontrolle im Handel – dem Handelscontrolling. Es beleuchtet wichtige Kennzahlen und Methoden zur Messung des Marketingerfolgs im Handel.
Schlüsselwörter
Handel, Marketing-Mix, Planung, Realisierung, Analyse, Strategisches Marketing, Operatives Marketing, Handelsfunktionen, Portfolioanalyse, SWOT-Analyse, Produktpolitik, Preispolitik, Vertriebspolitik, Kommunikationspolitik, Hersteller-Marketing, Handels-Marketing, Erfolgskontrolle, Handelscontrolling.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die "4Ps" des Marketing-Mix?
Die 4Ps stehen für Produktpolitik (Product), Preispolitik (Price), Vertriebspolitik (Place) und Kommunikationspolitik (Promotion).
Wie unterscheidet sich Handelsmarketing von Herstellermarketing?
Handelsmarketing fokussiert sich auf die Gestaltung des Sortiments und die Einkaufsstätte, während Herstellermarketing primär die Vermarktung einzelner Markenprodukte zum Ziel hat.
Was ist eine SWOT-Analyse?
Die SWOT-Analyse untersucht die Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) eines Unternehmens.
Welche Rolle spielt das Handelscontrolling?
Das Handelscontrolling dient der Erfolgskontrolle, indem es Kennzahlen analysiert und die Effektivität der Marketingmaßnahmen im Handel misst.
Was versteht man unter der "merkantilen Revolution"?
Dieser Begriff beschreibt tiefgreifende historische Veränderungen in den Handelsstrukturen und der Bedeutung des Handels für die Wirtschaft.
- Quote paper
- Michael Seisenberger (Author), 2017, Planung und Realisierung des Marketing-Mix im Handel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451755