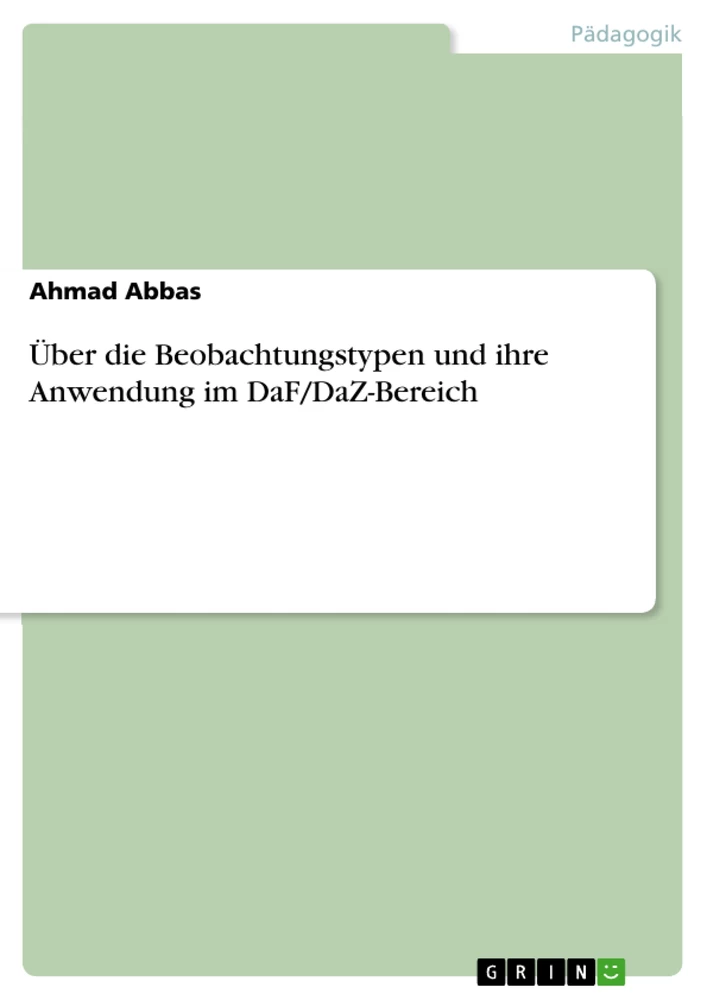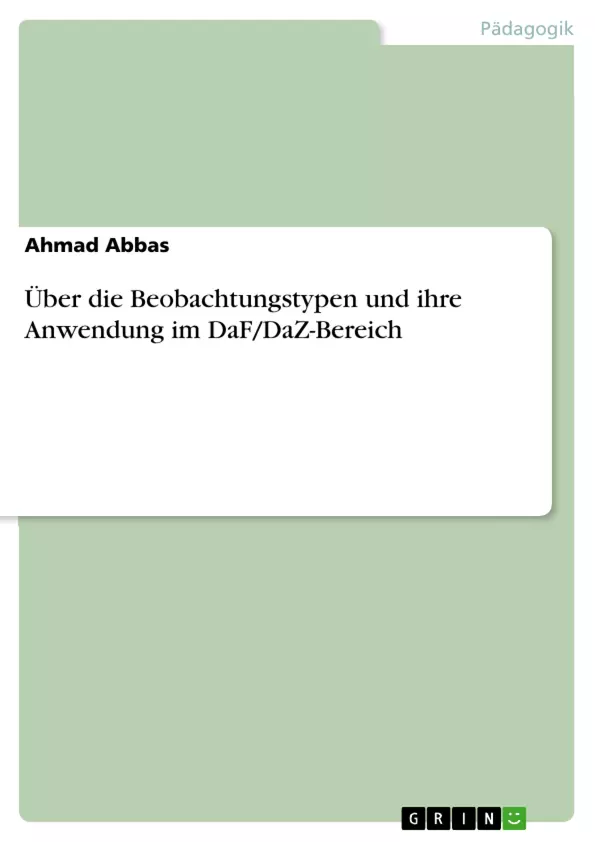Die Beobachtung gehört zu den grundlegenden empirischen Methoden der Datenerhebung. Bei Primärerhebungen ist sie neben der Befragung und dem Experiment die wichtigste Form der Informationsgewinnung. Anders als die Befragung und das Experiment stellt die Beobachtung als wissenschaftliche Methode ein relativ aufwendiges und zeitraubendes Verfahren der Datengewinnung dar, welche insbesondere dann zum Einsatz kommt, wenn die Ersteren sich nicht dazu eignen, ein authentisches und reliables Ergebnis zu erzeugen. Als empirische Methode findet die Beobachtung auch im Bereich Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (DaF/DaZ) Anwendung. Von signifikanter Bedeutung bei der wissenschaftlichen Beobachtung ist die Art, welche Position der Beobachter bzw. Forscher in Bezug auf die Beobachtung hat und wie er an die Beobachtenden herangeht. Ist der Beobachter während der Beobachtung präsent? Nimmt er aktiv am Geschehen teil oder beobachtet er die Lage von außen? Gibt er zu erkennen, dass er die Beforschten beobachtet oder verschweigt er es?
In dieser Arbeit soll untersucht werden, welcher Beobachtungtyp sich insbesondere für den DaF/DaZ-Unterricht eignen und von welchen Faktoren das abhängig ist. Dafür ist es erforderlich, die Beobachtung als empirisch-wissenschaftliche Methode zu definieren. Die wissenschaftliche Beobachtung unterscheidet sich in ihrer Systematik und Vorgehensweise von der individuellen und zufälligen Alltagsbeobachtung. Dieser Umstand mag verwirren, erschließt er sich doch nicht gleich aus dem Wortlaut. Eine Klärung des Begriffs der Beobachtung im wissenschaftlichen Sinne scheint notwendig. Im Anschluss werden die differierenden Beobachtungstypen benannt und voneinander abgegrenzt. Die Beschreibung der verschiedenen Beobachtungsformen hilft dabei, ein klares Urteil darüber zu fällen, welche der vorzustellenden Typen im DaF/DaZ Bereich Anwendung finden sollten. In einem weiteren Abschnitt werden die Besonderheiten von Beobachtungen im DaF/DaZ Bereich beleuchtet. Der DaF/DaZ Bereich unterscheidet sich von anderen Bereichen in Bezug auf einige Besonderheiten, die es zu beachten gilt, möchte man eine wissenschaftliche Beobachtung durchführen. Welche das sind und was das für den Forscher bedeutet, wird im weiteren Verlauf aufgezeigt. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse schließlich in den Kontext von DaF/DaZ gestellt und resümiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beobachtung: Eine Definition
- Differenz der Beobachtungstypen
- Grad der Offenheit
- Offene Beobachtung
- Verdeckte Beobachtung
- Status der Teilnahme
- Teilnehmende Beobachtung
- Nichtteilnehmende Beobachtung
- Grad der Offenheit
- Besonderheiten von Beobachtungen im DaF/DaZ Bereich
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der empirischen Methode der Beobachtung, insbesondere im Kontext des DaF/DaZ-Unterrichts. Sie untersucht die verschiedenen Beobachtungstypen und ihre Anwendbarkeit in diesem Bereich, indem sie deren Vor- und Nachteile und die damit verbundenen Herausforderungen beleuchtet.
- Definition der Beobachtung als wissenschaftliche Methode
- Differenzierung von Beobachtungstypen hinsichtlich Offenheit, Teilnahme und Strukturierung
- Besonderheiten der Beobachtung im DaF/DaZ-Bereich
- Bewertung der Anwendbarkeit verschiedener Beobachtungstypen im DaF/DaZ-Unterricht
- Relevanz der Wahl des richtigen Beobachtungstyps für die Datenerhebung und -analyse im DaF/DaZ-Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Beobachtung als empirische Methode im DaF/DaZ-Bereich ein und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor. Sie betont die Bedeutung der Unterscheidung verschiedener Beobachtungstypen und deren Relevanz für die wissenschaftliche Datenerhebung.
- Beobachtung: Eine Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Beobachtung im wissenschaftlichen Kontext und grenzt sie von der alltäglichen Beobachtung ab. Es erklärt die Systematik und Vorgehensweise wissenschaftlicher Beobachtungen und betont die Notwendigkeit der Intersubjektivität.
- Differenz der Beobachtungstypen: Dieses Kapitel beschreibt und unterscheidet verschiedene Beobachtungstypen, die in der empirischen Forschung verwendet werden. Es beleuchtet die Klassifizierungen nach Grad der Offenheit (offen vs. verdeckt), Status der Teilnahme (teilnehmend vs. nicht-teilnehmend) und Strukturierung (strukturiert vs. unstrukturiert). Der Fokus liegt auf den Beobachtungstypen, die im DaF/DaZ-Bereich relevant sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen der empirischen Forschung, insbesondere der Beobachtung im DaF/DaZ-Bereich. Die zentralen Themenbereiche umfassen die unterschiedlichen Beobachtungstypen, ihre Anwendung und Relevanz für den wissenschaftlichen Kontext. Die Schlüsselwörter umfassen: Beobachtung, Beobachtungstypen, empirische Forschung, Datenerhebung, DaF/DaZ, Fremdsprachenunterricht, wissenschaftliche Methode, Feldforschung, Laborforschung, Offenheit, Teilnahme, Strukturierung.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet wissenschaftliche Beobachtung von Alltagsbeobachtung?
Wissenschaftliche Beobachtung ist systematisch, geplant und folgt festgelegten Methoden zur Datengewinnung, während Alltagsbeobachtung zufällig und subjektiv erfolgt.
Was ist der Unterschied zwischen offener und verdeckter Beobachtung?
Bei der offenen Beobachtung wissen die Beforschten, dass sie beobachtet werden, während dies bei der verdeckten Beobachtung geheim gehalten wird.
Wann ist eine teilnehmende Beobachtung im DaF-Unterricht sinnvoll?
Sie ist sinnvoll, wenn der Forscher tiefe Einblicke in Interaktionsprozesse gewinnen möchte, indem er aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnimmt.
Welche Besonderheiten gibt es bei Beobachtungen im DaZ-Bereich?
Besonderheiten liegen in der sprachlichen Barriere, kulturellen Kontexten und der Notwendigkeit, authentische Sprachdaten in einer oft heterogenen Lerngruppe zu erfassen.
Was ist eine strukturierte Beobachtung?
Hierbei arbeitet der Beobachter mit einem festen Schema oder einer Checkliste, um gezielt vordefinierte Verhaltensweisen oder Ereignisse zu erfassen.
Warum ist die Position des Beobachters für das Ergebnis entscheidend?
Die Anwesenheit eines Beobachters kann das Verhalten der Schüler und Lehrer beeinflussen (Hawthorne-Effekt), was bei der Wahl des Beobachtungstyps berücksichtigt werden muss.
- Quote paper
- Ahmad Abbas (Author), 2018, Über die Beobachtungstypen und ihre Anwendung im DaF/DaZ-Bereich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/451794