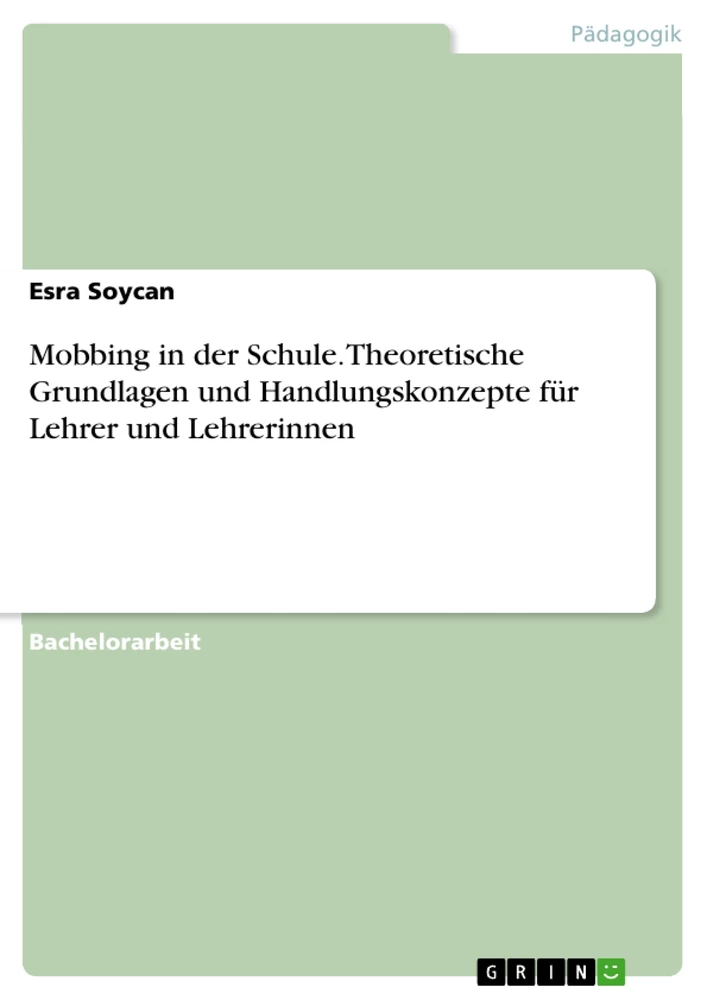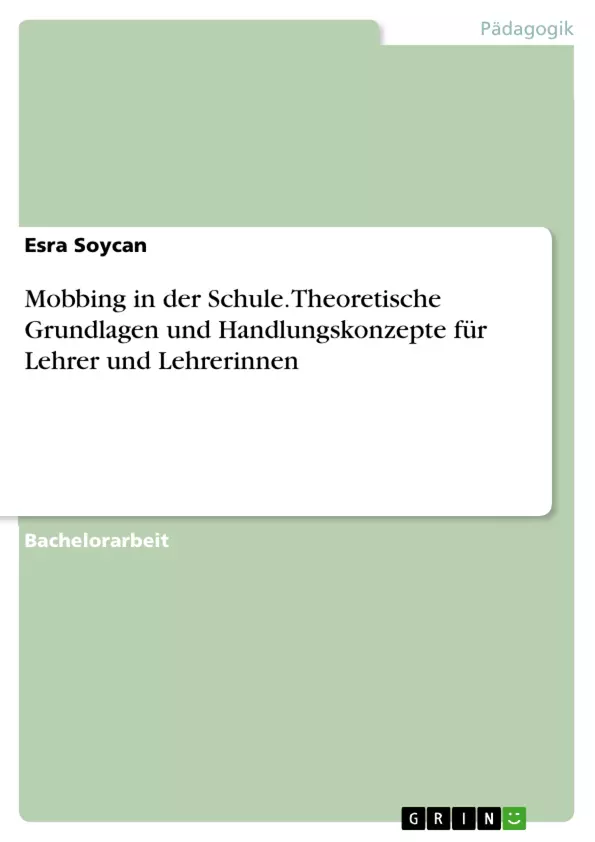Das Thema Mobbing stellt die Institution Schule als Sozialisationsinstanz unter einen hohen gesellschaftlichen Druck. Es gilt, gegen diese Art der Gewalt vorzugehen und Schülerinnen und Schüler davor zu schützen. Ziel dieser Arbeit ist es, Handlungsmaßnahmen und Verhaltensrichtlinien für Lehrer und Lehrerinnen in Bezug auf Mobbing zu erarbeiten.
Im ersten Teil der Arbeit wird das Phänomen Mobbing theoretisch aufgearbeitet. Dazu wird erst der Begriff Mobbing definiert, dann die Auftretenshäufigkeit dargelegt und schließlich die unterschiedlichen Erscheinungsformen beschrieben. Anschließend wird der kollektive Charakter von Mobbing aufgezeigt und es werden die verschiedenen Rollen, die im Mobbingprozess typischerweise eingenommen werden, differenziert. Nach der Darstellung alters- und geschlechtsspezifischer Unterschiede werden die Ursachen von Mobbing unter Berücksichtigung theoretischer Erklärungsansätze analysiert und mögliche Auswirkungen von Mobbing auf Opfer und Täter aufgezeigt. Daraus abgeleitet wird im zweiten Teil der Arbeit beschrieben, warum es notwendig ist an Schulen Mobbingprävention und -intervention zu betreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Begriffsherkunft und -definition von Mobbing
- Prävalenz
- Erscheinungsformen
- Rollenverteilung: Mobbing als Gruppenphänomen
- Merkmale einer Täterin oder eines Täters
- Merkmale eines Opfers
- Merkmale eines passiven Opfers
- Merkmale eines aggressiven Opfers
- Alters- und Geschlechtsspezifische Differenzen
- Altersspezifische Unterschiede
- Geschlechtsspezifische Unterschiede
- Mobbing als Prozess
- Die Ursachen von Mobbing
- Die Folgen von Mobbing
- Handlungskonzepte
- Grundlagen der Gewaltprävention und -intervention
- Drei verschiedene Handlungsebenen
- Allgemeine Maßnahmen auf Schulebene
- Allgemeine Maßnahmen auf Klassenebene
- Allgemeine Maßnahmen auf Individualebene
- Schulische Präventionskonzepte
- Das „fairplayer“ Programm
- Das Anti-Mobbing-Programm nach Olweus
- Schulische Interventionskonzepte
- Der „No blame Approach“
- Das „Gegen-Gewalt-Konzept“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Phänomen Mobbing in der Schule und zielt darauf ab, theoretische Erkenntnisse aus der Forschung mit Handlungsmaßnahmen und Verhaltensrichtlinien für Lehrkräfte zu verknüpfen. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen praxisbezogenen Teil.
- Definition und Prävalenz von Mobbing
- Erscheinungsformen und Rollenverteilung im Mobbingprozess
- Ursachen und Folgen von Mobbing
- Grundlagen der Gewaltprävention und -intervention
- Vorstellung konkreter Präventions- und Interventionskonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik Mobbing in der Schule ein und beleuchtet die Bedeutung des Themas im Kontext der aktuellen Debatte um Gewalt an Schulen. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit und gibt einen Überblick über die Gliederung.
- Begriffsherkunft und -definition von Mobbing: Dieses Kapitel widmet sich der historischen Entwicklung des Begriffs „Mobbing“ und seiner Definition. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf Mobbing, insbesondere die Unterscheidung zwischen Mobbing und Bullying.
- Prävalenz: Dieses Kapitel analysiert die Verbreitung von Mobbing an Schulen und stellt relevante Daten und Statistiken zur Häufigkeit von Mobbingvorfällen vor.
- Erscheinungsformen: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Formen, in denen Mobbing auftreten kann. Es beleuchtet sowohl verbale als auch physische und psychische Formen von Mobbing.
- Rollenverteilung: Mobbing als Gruppenphänomen: Dieses Kapitel geht der Frage nach, welche Rollen im Mobbingprozess typischerweise eingenommen werden. Es analysiert die Merkmale von Tätern, Opfern und Zuschauern.
- Alters- und Geschlechtsspezifische Differenzen: Dieses Kapitel untersucht die Unterschiede in der Häufigkeit und Ausprägung von Mobbing in Abhängigkeit vom Alter und Geschlecht.
- Mobbing als Prozess: Dieses Kapitel beleuchtet Mobbing als einen dynamischen Prozess, der sich über verschiedene Phasen erstreckt. Es analysiert die Entwicklung von Mobbingvorfällen und die Faktoren, die zur Eskalation von Mobbing beitragen können.
- Die Ursachen von Mobbing: Dieses Kapitel geht der Frage nach, welche Faktoren zur Entstehung von Mobbing beitragen. Es beleuchtet verschiedene theoretische Erklärungsansätze und diskutiert die Rolle von Persönlichkeitseigenschaften, sozialen Faktoren und Umwelteinflüssen.
- Die Folgen von Mobbing: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen von Mobbing auf Opfer und Täter. Es analysiert die psychischen, sozialen und schulischen Folgen von Mobbing.
- Grundlagen der Gewaltprävention und -intervention: Dieses Kapitel widmet sich den Grundlagen der Gewaltprävention und -intervention an Schulen. Es beleuchtet die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Vorbeugung von Mobbing und die Bedeutung von Interventionen bei Mobbingfällen.
- Drei verschiedene Handlungsebenen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Handlungsebenen für Maßnahmen zur Prävention und Intervention von Mobbing. Es analysiert die Möglichkeiten für allgemeine Maßnahmen auf Schulebene, Klassenebene und individueller Ebene.
- Schulische Präventionskonzepte: Dieses Kapitel stellt verschiedene schulische Präventionskonzepte vor, die auf die Reduzierung von Mobbing abzielen. Es erläutert die Prinzipien und Ziele der einzelnen Programme.
- Schulische Interventionskonzepte: Dieses Kapitel fokussiert auf Interventionen bei Mobbingfällen an Schulen. Es präsentiert verschiedene Ansätze zur Konfliktlösung und beschreibt die Rolle von Lehrkräften bei der Intervention.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen Mobbing in der Schule, Gewaltprävention, Interventionsstrategien, theoretische Grundlagen, Handlungskonzepte, Prävalenz, Erscheinungsformen, Rollenverteilung, Ursachen, Folgen, Schulische Maßnahmen und Präventions- und Interventionskonzepte.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Mobbing in der Schule definiert?
Mobbing ist eine Form von Gewalt, die durch wiederholte, systematische Schikane über einen längeren Zeitraum gegen eine Person gekennzeichnet ist, die sich nicht wirksam wehren kann.
Welche Rollen gibt es im Mobbingprozess?
Mobbing ist ein Gruppenphänomen. Es gibt Täter, Opfer (passive oder aggressive), Assistenten des Täters und Zuschauer, deren Verhalten den Prozess oft stabilisiert.
Was sind die Folgen von Mobbing für die Betroffenen?
Folgen umfassen psychische Probleme, soziale Isolation, Leistungsabfall in der Schule bis hin zu psychosomatischen Erkrankungen und schweren Traumata.
Was ist der „No Blame Approach“?
Es ist ein Interventionskonzept, das ohne Schuldzuweisungen arbeitet und darauf abzielt, die Unterstützungsgruppe des Opfers zu aktivieren, um das Mobbing zu beenden.
Welche Präventionsprogramme gibt es für Schulen?
Bekannte Programme sind das Olweus-Anti-Mobbing-Programm sowie das „fairplayer“-Programm, die auf verschiedenen Ebenen (Schule, Klasse, Individuum) ansetzen.
- Citar trabajo
- Esra Soycan (Autor), 2018, Mobbing in der Schule. Theoretische Grundlagen und Handlungskonzepte für Lehrer und Lehrerinnen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452076