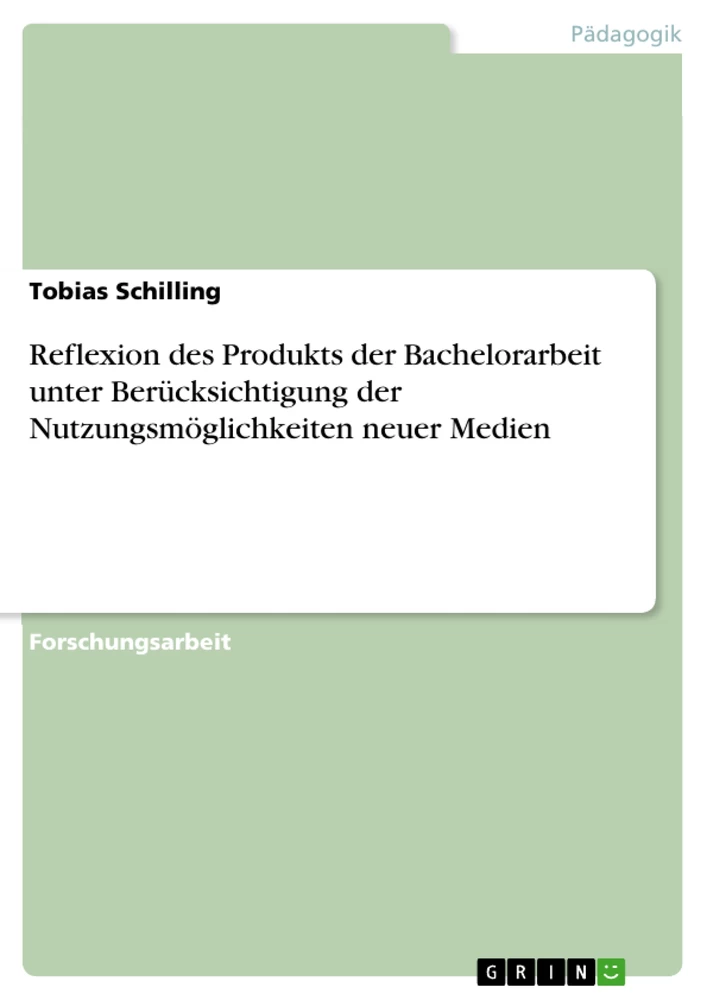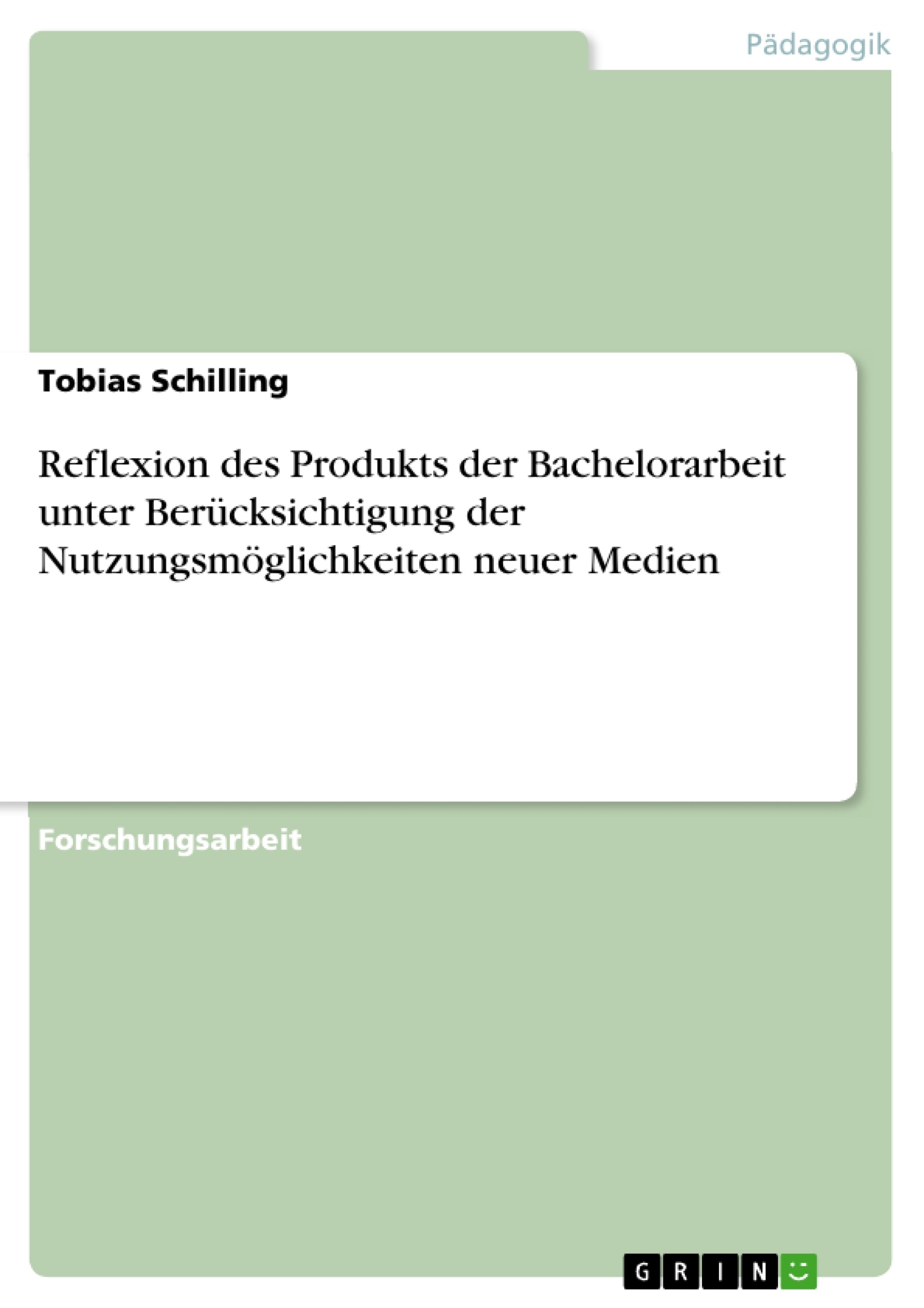Die Fragestellung unter dem Titel „Reflexion des Produkts der Bachelorarbeit unter Berücksichtigung der Nutzungsmöglichkeiten neuer Medien“ soll daher sein, ob die Bachelorarbeit Mängel in technischer als auch medienpädagogischer Hinsicht enthält und wie diese verbessert werden könnten.
Dafür wird in einem ersten Teil der Fallstudie das Lernprogramm der Bachelorarbeit vorgestellt. Es wird zunächst der theoretische Hintergrund und die technische Umsetzung beschrieben, die Erprobungsphase umrissen sowie Erkenntnisse und Besonderheiten der teilnehmenden Beobachtung genannt. Vor der anschließenden Reflexion des Lernprogramms werden Grundlagen der Medienpädagogik definiert, mit Hilfe derer der einerseits technische und andererseits medienpädagogische Gehalt des Lernprogramms kritisch reflektiert wird. Es soll weiterhin allgemein geklärt werden, inwiefern das Programm konstruktivistisch ausgerichtet ist und damit aktueller Didaktik genügt.
Darüber hinaus werden die Möglichkeiten des Einsatzes von neuen Medien und Lernprogrammen im Chemieunterricht exemplarisch dargestellt. Es wird aufgezeigt, welche neuen Medien im Chemieunterricht denkbar sowie welche in den Curricula der verschiedenen Schulformen vermerkt sind und inwiefern neue Medien im Chemieunterricht eine Rolle spielen können.
Abschließend werden in einem Fazit die Ergebnisse der Reflexion zusammengefasst. Darauf aufbauend werden die persönlichen Erkenntnisgewinne der Fallstudie genannt. Die Fallstudie endet mit einem Ausblick, der die aus der Fallstudie gezogenen Rückschlüsse für den zukünftigen, eigenen Lehrer*innenberuf darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Gliederung
- 2. Realisation
- 2.1 Realisation des Lernprogramms
- 2.1.1 Theoretischer Hintergrund
- 2.1.2 Technische Realisierung
- 2.2 Erprobung des Lernprogramms
- 2.2.1 Erprobung der Beta-Versionen des Lernprogramms zur „Fraktionierten Destillation von Orangenöl“
- 2.2.2 Erprobung der finalen Version des Lernprogramms zur „,Fraktionierten Destillation von Orangenöl“
- 2.2.3 Erkenntnisse und Besonderheiten der teilnehmenden Beobachtung
- 2.3 Zwischenfazit Kapitel 2
- 2.1 Realisation des Lernprogramms
- 3. Ankopplung an die medienpädagogische Literatur und Reflexion
- 3.1 Medienpädagogik
- 3.2 Medienkompetenz nach Baacke
- 3.3 Kritische Reflexion des Lernprogramms unter medienpädagogischen Gesichtspunkten
- 3.4 Reflexion der Vermittlung von chemischer Theorie mit Hilfe des Lernprogramms
- 3.5 Kritische Reflexion der Erprobung im Hinblick auf Konstruktivismus
- 3.6 Zwischenfazit Kapitel 3
- 4. Medien und Schule
- 4.1 Möglichkeiten des Einsatzes von neuen Medien im Chemieunterricht
- 5. Fazit
- 5.1 Weitere Erkenntnisse
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Fallstudie analysiert die Bachelorarbeit „Entwicklung und Erprobung eines linearen Lernprogramms zur Auswertung eines ausgewählten teutolab-Experimentes mit Hilfe neuer Medien“ aus dem Jahr 2013 unter medienpädagogischen und technischen Gesichtspunkten. Die Arbeit wird im Kontext des Masterstudiums des Autors kritisch beleuchtet, um Stärken und Schwächen des entwickelten Lernprogramms zu identifizieren und daraus Handlungsempfehlungen für die zukünftige Verwendung neuer Medien im Unterricht abzuleiten.
- Kritische Reflexion des Lernprogramms unter medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Bewertung der technischen Umsetzung des Lernprogramms
- Analyse der Eignung des Lernprogramms für den Chemieunterricht
- Beurteilung der Relevanz des Konstruktivismus im Kontext der Erprobung
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für den Einsatz neuer Medien im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Fallstudie ein und erläutert die Notwendigkeit einer kritischen Reflexion der Bachelorarbeit. Kapitel 2 widmet sich der Realisation des Lernprogramms, inklusive der theoretischen Grundlagen, der technischen Umsetzung und der Erprobungsphase. Die Erkenntnisse und Besonderheiten der teilnehmenden Beobachtung werden ebenfalls beleuchtet. In Kapitel 3 wird das Lernprogramm vor dem Hintergrund der Medienpädagogik und Medienkompetenz nach Baacke analysiert. Die kritische Reflexion des Lernprogramms unter medienpädagogischen Gesichtspunkten sowie die Vermittlung von chemischer Theorie werden ausführlich behandelt. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Möglichkeiten des Einsatzes neuer Medien im Chemieunterricht.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Fallstudie fokussiert auf Themen wie Medienpädagogik, Medienkompetenz, neue Medien im Unterricht, Lernprogramm, Konstruktivismus, Chemieunterricht, technische Umsetzung, Erprobung, teilnehmender Beobachtung, Bachelorarbeit, Reflexion, Handlungsempfehlungen. Die kritische Analyse der Bachelorarbeit im Kontext des Masterstudiums zeigt die Bedeutung einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Einsatz neuer Medien im Bildungsbereich auf.
Häufig gestellte Fragen
Was wurde in der Bachelorarbeit zur Chemie-Didaktik entwickelt?
Es wurde ein lineares Lernprogramm zur Auswertung eines teutolab-Experiments (fraktionierte Destillation von Orangenöl) mithilfe neuer Medien entwickelt.
Welche medienpädagogischen Grundlagen werden herangezogen?
Die Arbeit nutzt unter anderem das Konzept der Medienkompetenz nach Baacke zur kritischen Reflexion des Lernprogramms.
Welche Rolle spielt der Konstruktivismus beim Lernen mit Medien?
Es wird untersucht, inwiefern das Programm den Schülern ermöglicht, Wissen aktiv aufzubauen, anstatt Informationen nur passiv aufzunehmen.
Wie können neue Medien im Chemieunterricht eingesetzt werden?
Neben Lernprogrammen sind Simulationen, digitale Messwerterfassungen und interaktive Whiteboards denkbare Einsatzmöglichkeiten.
Was ist das Ziel der Reflexion in dieser Fallstudie?
Die Identifikation technischer und medienpädagogischer Mängel, um Verbesserungen für den zukünftigen Einsatz als Lehrer abzuleiten.
- Quote paper
- Tobias Schilling (Author), 2015, Reflexion des Produkts der Bachelorarbeit unter Berücksichtigung der Nutzungsmöglichkeiten neuer Medien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452284