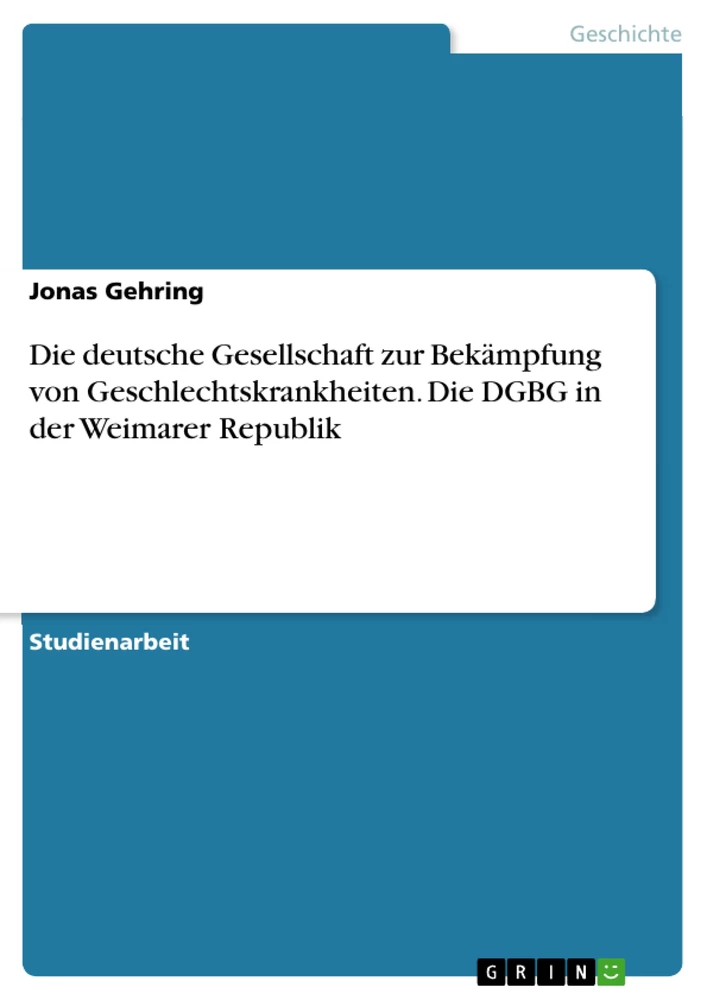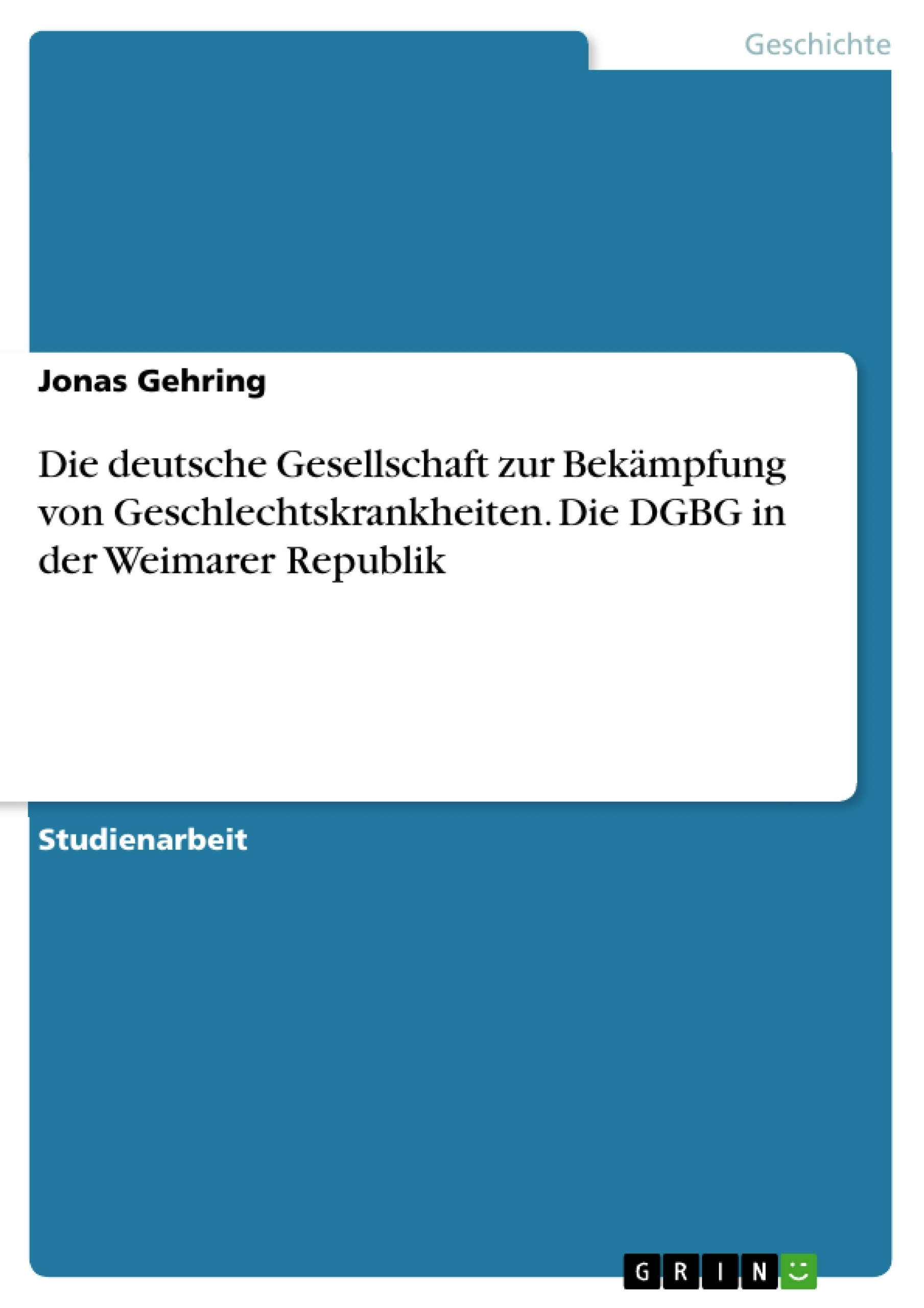In dieser Arbeit sollen folgende Fragen eruiert werden: Hat die DGBG zur allgemeinen Gesundheitsaufklärung beigetragen? Falls ja, in welchem Umfang hat sie dazu beigetragen und wie? Zunächst werden die Ausgangssituation für den Wohlfahrtsstaat der Weimarer Republik, die Aufklärung in Schulen und die allgemeinen Maßnahmen für die Volksgesundheit herausgearbeitet werden. Anschließend wird auf die genauen Umstände der Gründung der DGBG, deren Entwicklung während des ersten Weltkrieges und – als Fokus – ihr Handeln zur Zeit der Weimarer Republik eingegangen werden, um abschließend alle Ergebnisse in einem Resümee zusammenzufassen und die Entwicklung der DGBG bis heute zu skizzieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die allgemeine Gesundheitsaufklärung in der Weimarer Republik
- Ausgangssituation
- Wie gestaltete sich die Gesundheitsaufklärung an Schulen?
- Wie gestalteten sich die allgemeine Gesundheitsaufklärung, die Volksgesundheit und soziale Hygiene?
- Soziale Hygiene
- Volksgesundheit
- Gesundheitsaufklärung
- Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
- Wie ist die DGBG entstanden und was waren ihre Ziele?
- Der Aufbau der DGBG
- Wie war die DGBG von ihrer Gründung bis zum Ersten Weltkrieg strukturiert?
- Wie war die DGBG während des Ersten Weltkrieges strukturiert?
- Wie war die DGBG zur Zeit der Weimarer Republik strukturiert?
- Wie ging die DGBG vor, um ihre Ziele zu erreichen?
- Die weitere Entwicklung der DGBG
- Zusammenfassendes Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (DGBG) im Kontext der Weimarer Republik. Ziel ist es, die Rolle der DGBG in der allgemeinen Gesundheitsaufklärung zu analysieren und herauszufinden, in welchem Umfang sie zu ihrer Weiterentwicklung beigetragen hat.
- Die allgemeine Gesundheitsaufklärung in der Weimarer Republik und ihre Herausforderungen
- Die Entstehung und Entwicklung der DGBG
- Die Strukturen und Strategien der DGBG zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten
- Die Bedeutung der DGBG für die soziale Hygiene und Volksgesundheit
- Die Weiterentwicklung der DGBG nach der Weimarer Republik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation in der Weimarer Republik dar, die durch zahlreiche Veränderungen und Umbrüche in der Medizin geprägt war. Sie beleuchtet den demografischen Wandel und die Herausforderungen, die sich aus den Folgen des Ersten Weltkrieges ergaben.
Das zweite Kapitel widmet sich der allgemeinen Gesundheitsaufklärung in der Weimarer Republik. Es beleuchtet die Situation an Schulen, die Einführung von Schulspeisungen und Turnstunden, die Bedeutung der schulärztlichen Reihenuntersuchung und die Bemühungen um die Tuberkuloseverhinderung.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (DGBG). Es wird die Entstehung der DGBG, ihre Ziele und ihre strukturelle Entwicklung von der Gründung bis zur Weimarer Republik erläutert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit fokussiert auf die folgenden Schlüsselwörter: Gesundheitsaufklärung, Sozialhygiene, Volksgesundheit, Geschlechtskrankheiten, Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (DGBG), Weimarer Republik, Prävention, Prophylaxe.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Aufgabe der DGBG in der Weimarer Republik?
Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (DGBG) widmete sich der Aufklärung und Prävention von sexuell übertragbaren Krankheiten als Teil der Volksgesundheit.
Wie gestaltete sich die Gesundheitsaufklärung an Schulen damals?
Die Aufklärung umfasste Maßnahmen wie Schuluntersuchungen, die Einführung von Turnstunden und Bemühungen zur Tuberkuloseverhinderung sowie Schulspeisungen.
Was versteht man unter "Sozialer Hygiene"?
Soziale Hygiene war ein Konzept der Weimarer Republik, das medizinische Prävention mit sozialen Maßnahmen verband, um die Gesundheit der gesamten Bevölkerung zu verbessern.
Wann wurde die DGBG gegründet?
Die Arbeit beleuchtet die Gründung vor dem Ersten Weltkrieg und die anschließende strukturelle Entwicklung bis in die Zeit der Weimarer Republik.
Welche Ziele verfolgte die DGBG konkret?
Hauptziele waren die Entstigmatisierung von Geschlechtskrankheiten, die Förderung der Prophylaxe und die Bereitstellung von Informationen für die breite Öffentlichkeit.
- Citation du texte
- Jonas Gehring (Auteur), 2017, Die deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten. Die DGBG in der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452490