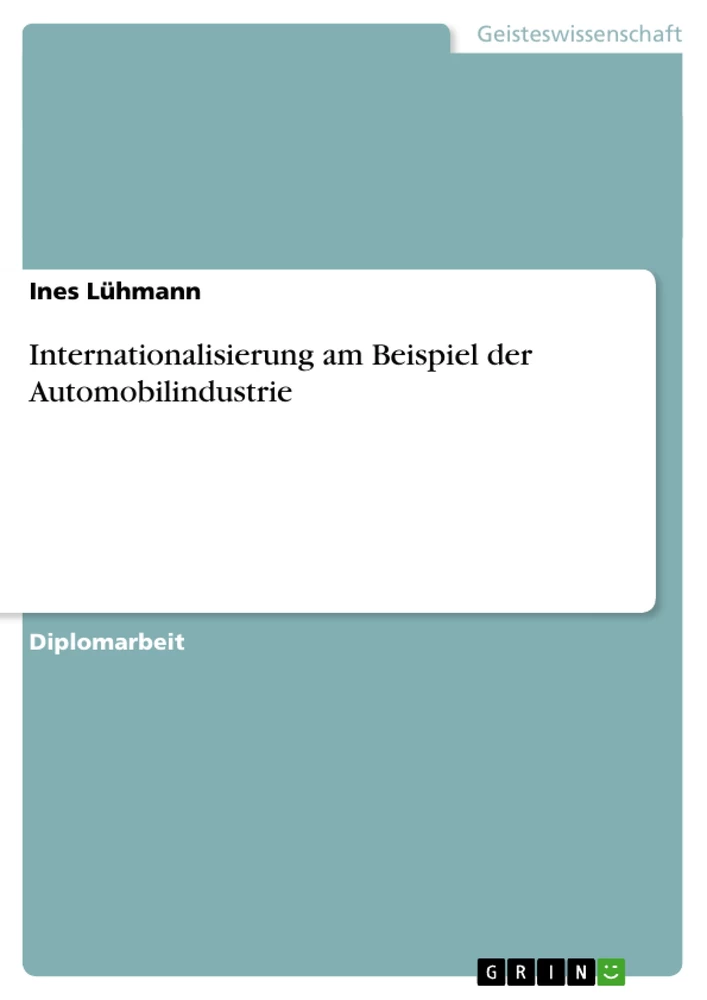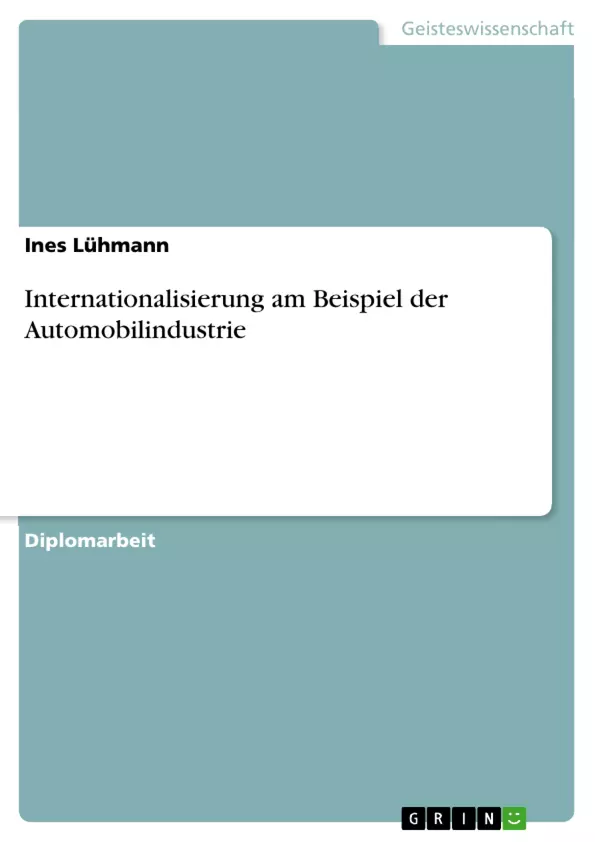Das Goldene Zeitalter der westlichen Wirtschaft nach dem zweiten Weltkrieg ist eng mit dem Begriff des Fordismus, der an die Einführung der Fließbandproduktion in der Automobilindustrie durch Henry Ford anknüpft, verbunden. Die Volkswirtschaften der Nationalstaaten als Bezugsrahmen des wirtschaftliches Handelns waren relativ abgeschlossen und auf der Basis der standardisierten Massenproduktion und des Massenkonsums auf Kosten nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen organisiert.
Der Fordismus hatte seine Blütezeit in der Boomphase nach dem Zweiten Weltkrieg, die zeitlich mit dem vierten Kondratieff-Zyklus zusammenfiel, dessen Basistechnologien das Fernsehen, die Petrochemie und die Weiterentwicklung bestehender Innovationen wie dem Automobil, dem Flugzeug und von Kunststoffen waren.
Der Trend zur Globalisierung ist ohne Zweifel eine der wichtigsten ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen am Anfang des 21. Jahrhunderts. Die Globalisierung beeinflusst auch die Wettbewerbsfähigkeit nationaler Ökonomien und stellt sie vor neue Preiskonkurrenz und Rationalisierungsmaßnahmen. Meist sind es in den Unternehmen Kostensenkungen, die oft mit einem Verlust oder Abbau von Arbeitsplätzen verbunden sind. Auf der anderen Seite wurden die Kapitalmärkte und internationalen Finanzmärkte liberalisiert, was die Kapitalmobilität deutlich erhöht hat und Investitionen im Ausland wahrscheinlicher macht.
Das Zusammenwachsen der verschiedenen nationalen Märkte zu einem integrierten und homogenen Weltmarkt, und die Folgen dieses Prozesses werden seit einigen Jahren intensiv diskutiert. Dabei gehen die Bewertungen weit auseinander. Während die Mehrzahl der Ökonomen die positiven Seiten der Globalisierung betont - Abbau von Reglementierungen, Verbesserung der Ressourcenallokation, Wachstum und Wohlstandsmehrung auf weltwirtschaftlicher Ebene -, werden von anderer Seite vor allem negative Folgen befürchtet: Arbeitslosigkeit und Erosion der Sozialsysteme in den Industrieländern, Ausbeutung von Arbeitskräften und massive Umweltzerstörung in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie insgesamt ein Verlust von staatlicher Souveränität und demokratischer Kontrolle gegenüber der Macht internationaler Unternehmungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Vorklärung und Bezugsrahmen
- Fragestellung und Erkenntnisinteresse
- Globalisierung der Märkte
- Erläuterung zentraler Begriffe
- Internationalisierung vs. Globalisierung
- Internationale Unternehmung
- Multinational / Transnational
- Internationalisierung als neue Handlungsoption
- Erarbeitung klarer Zielvorstellungen
- Wahl der richtigen Internationalisierungsstrategie
- Strategische Richtungen der Internationalisierung
- EPRG-Modell
- Triade-Modell
- Globalisierung nach Porter
- Wahl der geeigneten Form der Internationalisierung
- Exportstrategie
- Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern / Kooperation
- Direktinvestitionen
- Lizenzvergabe / Franchise
- Neugründung
- Internationalisierungsprozesse in der Automobilindustrie
- Motive und Ziele dieses Industriezweiges
- Entwicklung des Produktionsstandortes BRD für die deutsche Automobilindustrie
- Entwicklungsphasen der deutschen Automobilindustrie
- Generelle Motive für Standortentscheidungen internationaler Automobilhersteller
- Kriterien für Marktentscheidungen
- Bedeutung der Determinanten Logistik und Transport
- Konzerninterne Standortkonkurrenz durch Internationalisierung?
- Einfluss eines investitionsfreundlichen politischen Klimas auf die Standortentscheidung
- Konzerninternationalisierung am Beispiel des Volkswagen Konzerns
- Historischer Abriss
- Volkswagen als distributionsorientierter multinationaler Konzern
- Volkswagen als produktionsorientierter Konzern
- Der Übergang zu einem transnationalen Konzern
- Globalisierung und Restrukturierung am Beispiel: Puebla / Mexiko
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Internationalisierungsprozesse in der Automobilindustrie. Ziel ist es, die verschiedenen Motive, Strategien und Herausforderungen der Internationalisierung zu analysieren und am Beispiel des Volkswagen Konzerns zu veranschaulichen. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung der Branche, die Bedeutung von Standortentscheidungen und die Transformation von multinationalen zu transnationalen Konzernen.
- Motive und Strategien der Internationalisierung in der Automobilindustrie
- Bedeutung von Standortfaktoren für die Automobilproduktion
- Entwicklungsphasen der deutschen Automobilindustrie im internationalen Kontext
- Analyse der Internationalisierung des Volkswagen Konzerns
- Vergleich verschiedener Internationalisierungsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung legt den theoretischen Bezugsrahmen und die Fragestellung der Arbeit fest. Sie beschreibt das Erkenntnisinteresse und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel. Es wird die Relevanz der Internationalisierung im Automobilsektor hervorgehoben und die methodische Vorgehensweise kurz erläutert.
Globalisierung der Märkte: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss der Globalisierung auf die Märkte und die Notwendigkeit internationaler Expansion für Unternehmen der Automobilindustrie. Es werden wirtschaftliche, politische und technologische Faktoren diskutiert, die diesen Prozess vorantreiben.
Erläuterung zentraler Begriffe: Hier werden zentrale Begriffe wie Internationalisierung, Globalisierung, internationale Unternehmung, multinational und transnational präzise definiert und voneinander abgegrenzt. Dies dient der konsistenten Verwendung dieser Schlüsselbegriffe im weiteren Verlauf der Arbeit.
Internationalisierung als neue Handlungsoption: Dieses Kapitel beschreibt die Internationalisierung als strategische Option für Unternehmen. Es werden verschiedene Internationalisierungsstrategien (EPRG-Modell, Triade-Modell, Porter's Ansatz) vorgestellt und die Auswahl der geeigneten Form der Internationalisierung (Export, Kooperation, Direktinvestitionen) detailliert erläutert.
Internationalisierungsprozesse in der Automobilindustrie: Dieser Abschnitt untersucht die spezifischen Motive und Ziele der Internationalisierung in der Automobilindustrie. Die Entwicklung des Produktionsstandortes Deutschland und die Entwicklungsphasen der deutschen Automobilindustrie werden analysiert und eingeordnet.
Generelle Motive für Standortentscheidungen internationaler Automobilhersteller: Das Kapitel beleuchtet die entscheidenden Kriterien bei der Auswahl von Produktionsstandorten im internationalen Kontext. Es werden Marktbedingungen, logistische Faktoren, politische Rahmenbedingungen und die interne Konzernkonkurrenz berücksichtigt.
Konzerninternationalisierung am Beispiel des Volkswagen Konzerns: Dieser Teil analysiert die Internationalisierung des Volkswagen Konzerns anhand verschiedener Entwicklungsphasen. Die Entwicklung von einem distributionsorientierten multinationalen zu einem produktionsorientierten und schließlich transnationalen Konzern wird detailliert beschrieben und anhand des Beispiels Puebla/Mexiko veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Internationalisierung, Globalisierung, Automobilindustrie, Standortentscheidung, Internationalisierungsstrategien, Volkswagen Konzern, Multinationales Unternehmen, Transnationales Unternehmen, EPRG-Modell, Direktinvestitionen, Produktionsstandorte, Marktbedingungen, Logistik.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Internationalisierungsprozesse in der Automobilindustrie am Beispiel des Volkswagen Konzerns
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Internationalisierungsprozesse in der Automobilindustrie, analysiert die Motive, Strategien und Herausforderungen dieser Prozesse und veranschaulicht diese am Beispiel des Volkswagen Konzerns. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Branche, der Bedeutung von Standortentscheidungen und der Transformation von multinationalen zu transnationalen Konzernen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Motive und Strategien der Internationalisierung in der Automobilindustrie, Bedeutung von Standortfaktoren für die Automobilproduktion, Entwicklungsphasen der deutschen Automobilindustrie im internationalen Kontext, Analyse der Internationalisierung des Volkswagen Konzerns und Vergleich verschiedener Internationalisierungsstrategien. Konkrete Begriffe wie Internationalisierung, Globalisierung, multinationale und transnationale Unternehmen werden definiert und abgegrenzt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (mit theoretischem Bezugsrahmen und Fragestellung), Globalisierung der Märkte, Erläuterung zentraler Begriffe (Internationalisierung vs. Globalisierung etc.), Internationalisierung als neue Handlungsoption (inkl. Strategien wie EPRG-Modell und Triade-Modell), Internationalisierungsprozesse in der Automobilindustrie, Generelle Motive für Standortentscheidungen internationaler Automobilhersteller, Konzerninternationalisierung am Beispiel des Volkswagen Konzerns (inkl. historischem Abriss und Analyse der Entwicklungsphasen) und Fazit.
Welche Internationalisierungsstrategien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Internationalisierungsstrategien, darunter das EPRG-Modell und das Triade-Modell sowie den Ansatz nach Porter. Darüber hinaus werden unterschiedliche Formen der Internationalisierung wie Export, Kooperation und Direktinvestitionen (inkl. Lizenzvergabe/Franchise und Neugründung) detailliert erläutert.
Welche Rolle spielt der Volkswagen Konzern in der Arbeit?
Der Volkswagen Konzern dient als Fallbeispiel zur Veranschaulichung der Internationalisierungsprozesse. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Konzerns von einem distributionsorientierten multinationalen Unternehmen zu einem produktionsorientierten und schließlich transnationalen Konzern. Das Beispiel Puebla/Mexiko wird zur Illustration herangezogen.
Welche Faktoren beeinflussen Standortentscheidungen in der Automobilindustrie?
Die Arbeit untersucht verschiedene Faktoren, die Standortentscheidungen internationaler Automobilhersteller beeinflussen. Hierzu gehören Marktbedingungen, logistische Faktoren (Transport und Logistik), politische Rahmenbedingungen und die konzerninterne Standortkonkurrenz.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Internationalisierung, Globalisierung, Automobilindustrie, Standortentscheidung, Internationalisierungsstrategien, Volkswagen Konzern, Multinationales Unternehmen, Transnationales Unternehmen, EPRG-Modell, Direktinvestitionen, Produktionsstandorte, Marktbedingungen, Logistik.
Welche Methode wurde in der Arbeit verwendet?
Die methodische Vorgehensweise wird in der Einleitung kurz erläutert. Die Arbeit kombiniert theoretische Grundlagen mit einer Fallstudienanalyse am Beispiel des Volkswagen Konzerns. Genaueres zur angewandten Methodik ist dem Haupttext zu entnehmen.
- Citation du texte
- Ines Lühmann (Auteur), 2005, Internationalisierung am Beispiel der Automobilindustrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45262