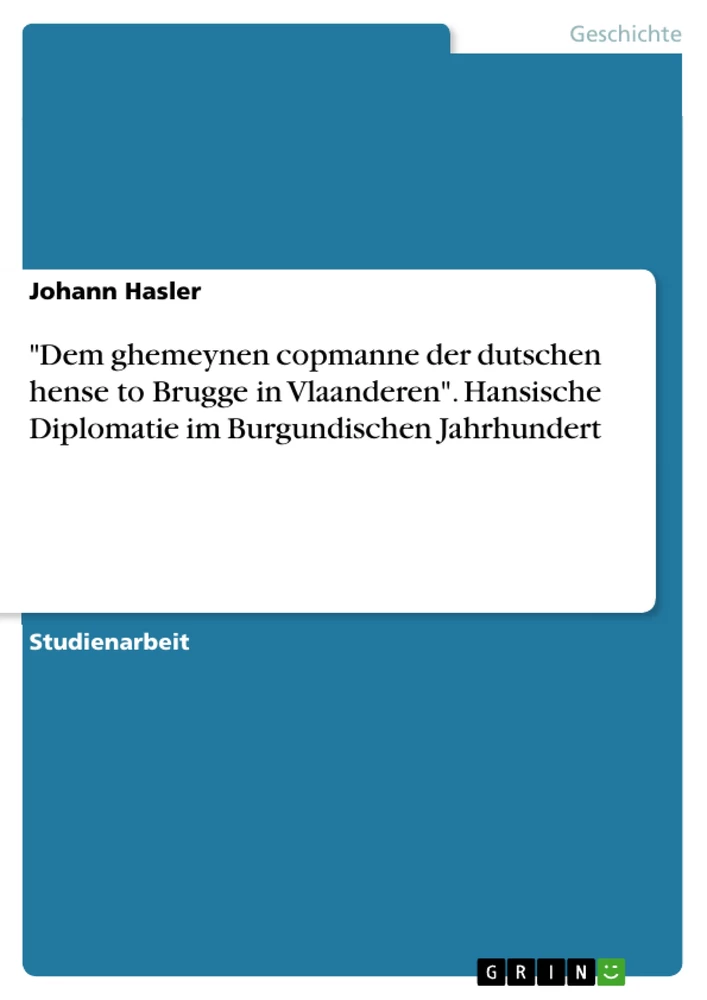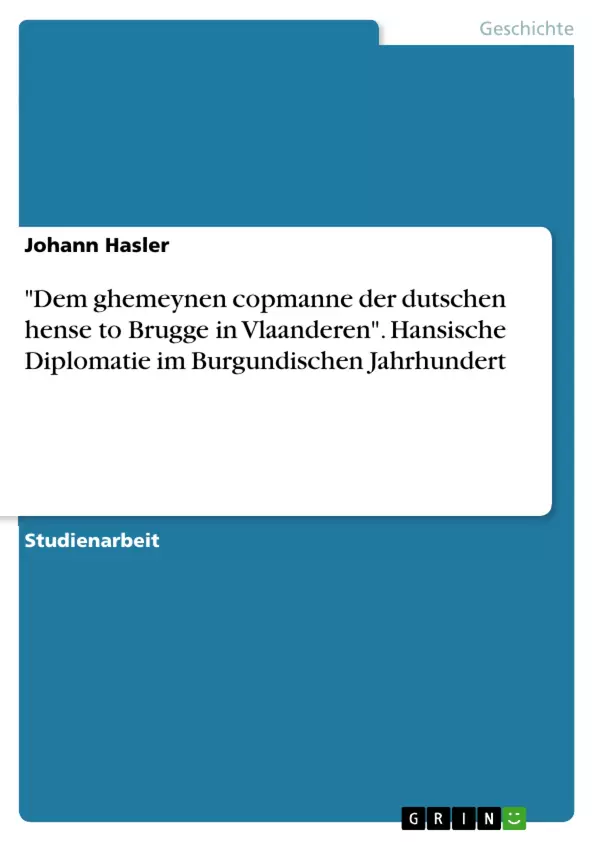Die Geschichte der Hanse wird, grade im populären Geschichtsverständnis, immer wieder als Wirken eines kaufmännischen Verbunds dargestellt - und dabei meist nach ihren außenpolitischen Erfolgen bemessen. Diese Außenpolitik wird in der hansischen Geschichte besonders dann interessant, wenn wir uns in Randgebiete des hansischen Einflussraumes begeben; so auch in dieser Arbeit, die sich mit dem hansischen Wirken in Flandern befasst. Erwerb von Privilegien, Handelskriege, Kontorverlegungen; die diplomatischen Mittel der "Flandernfahrer" waren vielfältig.
Doch zur selben Zeit stieg in den Niederlanden eine Familie auf, die die nächsten hundert Jahre über die Region der Niederlande herrschen und ihr Schicksal entscheiden sollte: die Burgunder aus Frankreich waren ein nicht zu unterschätzender Faktor in der diplomatischen Rechnung der hansischen Kaufleute. Durch die Machtverschiebung innerhalb der Niederlande konnte sich für die Hanse schlagartig alles ändern - deswegen stellt der Autor die spannende Frage: Wie wirkte sich das Erstarken des Hauses Burgund auf die Machtposition der
hansischen Flandernfahrer in der Frühen Neuzeit aus?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kontorverlegung als Druckmittel – Hansische Diplomatie in Flandern
- Der Aufstieg Brügges und die ersten hansischen Ambitionen
- Aardenburg als „Ausweich-Stapel"
- Leden und Graf – das „Doppelprivileg“ von 1360
- Der Umzug nach Holland
- Die Burgundischen/Habsburgerischen Niederlande
- Der Aufstieg Burgunds
- In Brügge bleiben?
- Der schleichende Umzug nach Antwerpen
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des aufstrebenden Hauses Burgund auf die Machtposition der hansischen Flandernfahrer in der Frühen Neuzeit. Sie analysiert, wie die Hansestädte durch ihre Diplomatie und ihre Kontorverlegungen Druck auf die lokalen Machthaber ausübten, um ihre Handelsinteressen zu sichern.
- Die Rolle der Kontorverlegung als diplomatisches Druckmittel
- Der Aufstieg Brügges als Handelszentrum und die ersten hansischen Ambitionen
- Die Rivalität zwischen den Städten Flanderns und die Bedeutung der „Leden“ für die Hansische Diplomatie
- Die Bedeutung des Hauses Burgund und seine Auswirkungen auf die Handelspolitik in den Niederlanden
- Der schleichende Umzug des Hansekontors von Brügge nach Antwerpen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Hanse als einen kaufmännischen Verbund vor, der durch seine außenpolitische Aktivität geprägt war. Sie zeigt, dass die Erringung von Privilegien im „Ausland” schwieriger war als im deutschen Raum. Die prominentesten Kontore der Hanse waren der Stalhof in London, der Peterhof in Nowgorod, die Tyskebryggen in Bergen sowie das Brügger Hansekontor.
- Kontorverlegung als Druckmittel – Hansische Diplomatie in Flandern: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung des Brügger Hansekontors und die ersten hansischen Ambitionen in Flandern. Es beleuchtet die Rivalität zwischen den Städten Flanderns und die Bedeutung der „Leden“ für die Hansische Diplomatie.
- Die Burgundischen/Habsburgerischen Niederlande: Dieses Kapitel beschreibt den Aufstieg des Hauses Burgund und seine Auswirkungen auf die Handelspolitik in den Niederlanden. Es untersucht die Frage, ob die Hansestädte in Brügge bleiben sollten oder ob sie sich nach Antwerpen verlegen sollten.
Schlüsselwörter
Hansische Diplomatie, Flandern, Brügge, Hansekontor, Kontorverlegung, Burgund, Leden, Handelsprivilegien, Handelssperre, Frühe Neuzeit, Diplomatie, Machtposition.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste das Haus Burgund die Hanse in Flandern?
Der Aufstieg der Burgunder führte zu einer Machtverschiebung in den Niederlanden, die die diplomatische Position der hansischen Kaufleute und deren Privilegien stark beeinflusste.
Welche Rolle spielte das Hansekontor in Brügge?
Das Brügger Kontor war eines der wichtigsten der Hanse. Die Arbeit untersucht, wie die Hanse durch Drohungen zur Kontorverlegung Druck auf lokale Machthaber ausübte.
Was ist das "Doppelprivileg" von 1360?
Es handelt sich um eine diplomatische Vereinbarung zwischen den flandrischen Städten (Leden) und dem Grafen, die der Hanse wichtige Handelsprivilegien sicherte.
Warum zog die Hanse von Brügge nach Antwerpen um?
Aufgrund wirtschaftlicher Veränderungen und politischer Verschiebungen unter den Burgundern und Habsburgern verlor Brügge an Bedeutung, was einen schleichenden Umzug nach Antwerpen zur Folge hatte.
Welche diplomatischen Mittel nutzten die "Flandernfahrer"?
Die Mittel waren vielfältig und reichten vom Erwerb von Privilegien über Handelskriege und Handelssperren bis hin zur strategischen Verlegung von Handelsstützpunkten.
Was versteht man unter den "Leden" in der hansischen Geschichte?
Die "Leden" waren die führenden Städte Flanderns, die als wichtige Verhandlungspartner für die hansische Diplomatie fungierten.
- Quote paper
- Johann Hasler (Author), 2017, "Dem ghemeynen copmanne der dutschen hense to Brugge in Vlaanderen". Hansische Diplomatie im Burgundischen Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452728