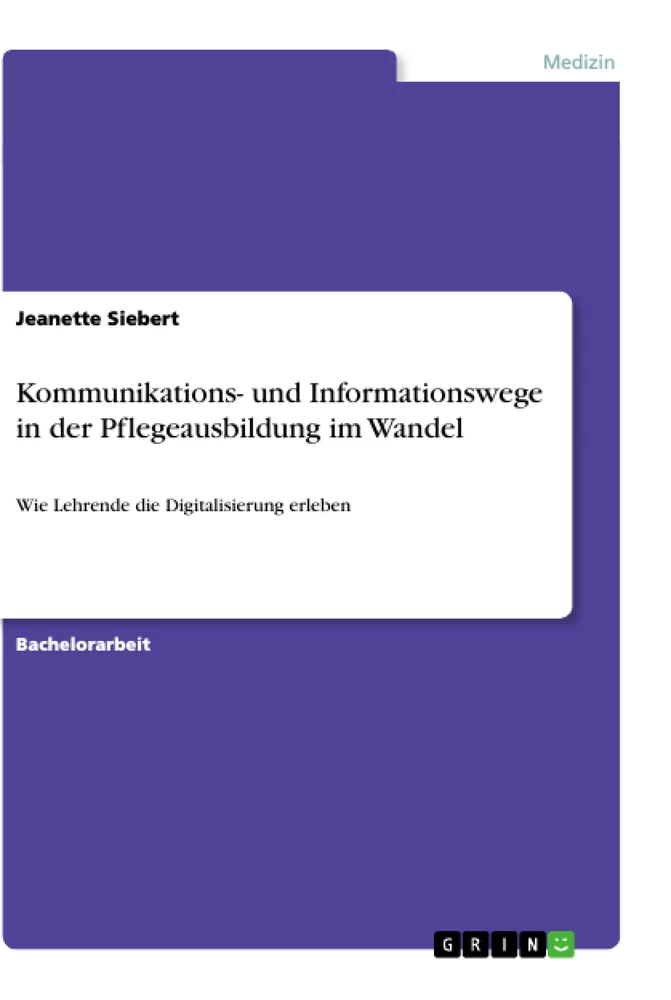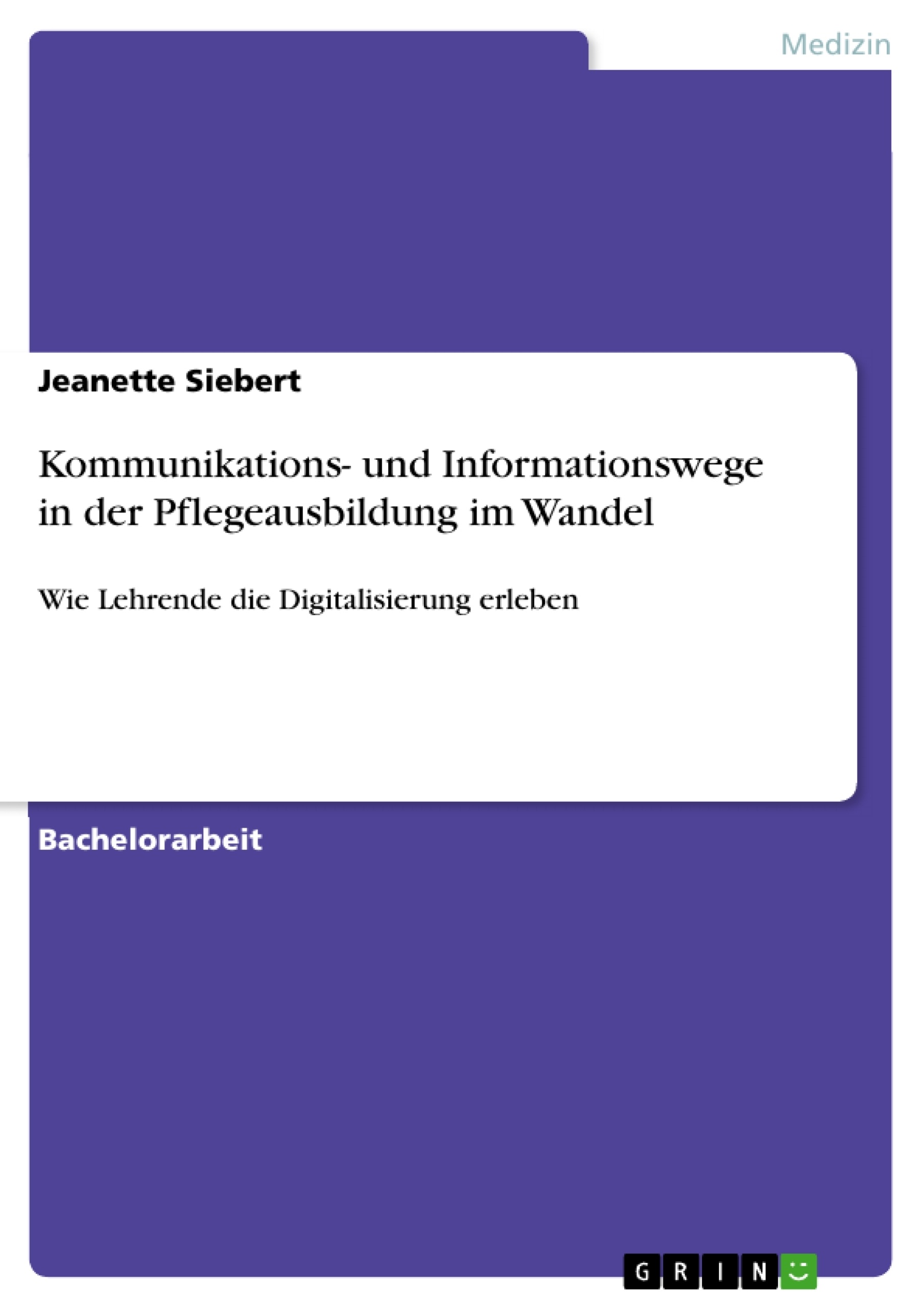Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein tiefes Verständnis für die Wahrnehmung der Auswirkungen des digitalen Wandels aus der Perspektive Lehrender zu erlangen. Die Haltungen von Lehrpersonen gegenüber dem Einsatz von interaktiven Medien im Lehr- und Lernsetting soll herausgearbeitet werden, um ein Verständnis für Widerstände gegen den Prozess der Digitalisierung des Unterrichtes zu erreichen.
Der Prozess des digitalen Wandels beeinflusst die Lebensräume der Menschen in den Industrieländern. Auch der Bereich der Lehre wird von der Digitalisierung tangiert. Vor allem die Entwicklung des Internets hat Auswirkungen auf das menschliche Lernverhalten. Während das Internet zunächst als „Leseweb“, welches lediglich von Programmierern editiert werden konnte, etabliert wurde, entsteht mit dem Ausbau des Internets zum „Mitmachweb“ eine neue Informations- und Kommunikationsdimension, die Auswirkungen auf das Lehr- und Lernverhalten haben kann. Mit der Etablierung des „Mitmachwebs“ als Web 2.0 stehen den Lernenden umfangreiche Informationen zur Verfügung, die von anderen Internetnutzern im Rahmen von Enzyklopädien im World Wide Web bereitgestellt werden. Diese Informationen werden im Gegensatz zu Fachbüchern zwar vor ihrer Publikation redigiert, jedoch können Änderungen auch von Laien direkt im Browser vorgenommen werden, sodass von inhaltlicher Qualität nicht per se ausgegangen werden kann.
Um Lernen auch im Prozess der Digitalisierung zu ermöglichen, ist es notwendig, dass die lehrenden Personen den sich wandelnden Aufgaben gerecht werden. Dies lässt auf den Ansatz einer konstruktivistischen Didaktik, die ermöglicht, dass Lernende sich Wissen durch individuelle Konstruktion selbst erarbeiten, schließen. Die mediale Dimension des Web 2.0 kann hier als Informations- und Kommunikationsmedium dienen. Dies impliziert die Verwendung sozialer Netzwerke und Messenger-Dienste wie Facebook oder WhatsApp – auch im Hinblick auf den Bereich der Bildung. Smartphones, Tablets und Notebooks werden in den Klassenräumen von Pflegeschulen noch eher selten aktiv in den Unterricht integriert, obwohl anzunehmen ist, dass ihr Einsatz den Lernprozess unterstützen könnte. Um die Lernenden der Pflegeausbildungen auf die berufliche Praxis vorzubereiten, ist es notwendig, als Lehrperson den Umgang mit virtuellen Lernräumen zu kennen. Dann können die Lernenden dahingehend befähigt werden, qualitativ hochwertige Informationen aus dem Internet zu beziehen, um so professionell pflegen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Problemstellung und Ziel der Arbeit
- Begriffsbestimmungen und theoretische Verortung der Thematik
- Web 2.0
- Social Media
- Nutzen von Social Media im privaten Kontext
- Nutzen von Social Media im beruflichen Kontext
- Die Theorie des Sozialen Raumes und das Konzept des Habitus nach Pierre Bourdieu
- Medialer Habitus
- Digital Natives und Digital Immigrants
- Forschungsmethode
- Datenerhebung
- Sampling
- Leitfadenkonstruktion
- Durchführung der Experteninterviews
- Transkription des Datenmaterials
- Datenanalyse
- Datenerhebung
- Ergebnisse
- Nutzungsverhalten der Lehrperson von Web 2.0 und Social Media
- Vertrauensdefizit im Hinblick auf die Qualität neuer Medien
- Unsicherheit beim Einsatz von webbasierten Diensten
- Widerstand gegen die Darstellung der eigenen Person im Internet
- Erleben der Lehrenden im Hinblick auf die Nutzung von Web 2.0 und Social Media durch die Lernenden
- Unterrichtsstörung „Smartphone“
- Erlebte Kluft im Mediennutzungsverhalten zwischen Lehrenden und Lernenden
- Reduzierte Lese- und hermeneutische Kompetenz bei den Lernenden
- Reduzierte Konfliktlösungskompetenz bei den Lernenden
- Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden im Zeitalter des sich verändernden Mediennutzungsverhalten
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Nutzungsverhalten der Lehrperson von Web 2.0 und Social Media
- Diskussion der Ergebnisse
- Kontrolle und Kontrollverlust im berufspädagogischen Kontext
- Milieugrenzen und deren Reproduktion durch Unterschiede im medialen Habitus
- Ambivalenz und Überforderung bei der Nutzung von Web 2.0 und Social Media durch die Lehrenden
- Unterschiede in der digitalen Sprache zwischen Lehrenden und Lernenden
- Chancen und Grenzen dieser Arbeit für den berufspädagogischen Kontext
- Bedeutung dieser Arbeit für die Pädagogik in den Pflegeberufen
- Möglichkeiten für eine Implementierung neuer Medien im Bereich der Pädagogik der Pflegeberufe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Herausforderungen der Digitalisierung in der Pflegeausbildung aus der Perspektive der Lehrenden. Im Fokus steht die Analyse des Mediennutzungsverhaltens und der damit verbundenen Ambivalenzen sowie Herausforderungen, die Lehrende im Umgang mit Web 2.0 und Social Media erleben.
- Die unterschiedlichen Einstellungen und Erfahrungen von Lehrenden im Umgang mit digitalen Medien und sozialen Netzwerken
- Die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Kommunikation und Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden in der Pflegeausbildung
- Die Rolle des medialen Habitus und die Unterschiede in der digitalen Kompetenz zwischen Lehrenden und Lernenden
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Integration neuer Medien im berufspädagogischen Kontext ergeben
- Mögliche Ansätze für eine gelingende Integration von Web 2.0 und Social Media in der Pflegeausbildung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problematik der digitalen Transformation in der Pflegeausbildung und definiert die zentralen Begriffe Web 2.0 und Social Media. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Nutzungsformen von Social Media im privaten und beruflichen Kontext und stellt die Theorie des Sozialen Raumes und das Konzept des Habitus nach Pierre Bourdieu vor.
Die Forschungsmethode umfasst die Durchführung von Experteninterviews mit Lehrenden in der Pflegeausbildung. Die Analyse der erhobenen Daten konzentriert sich auf das Nutzungsverhalten der Lehrenden von Web 2.0 und Social Media, ihre Erfahrungen mit der Nutzung durch Lernende und die Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden.
Die Ergebnisse zeigen, dass Lehrende in der Pflegeausbildung ein ambivalentes Verhältnis zu Web 2.0 und Social Media haben. Sie erleben Unsicherheiten und Herausforderungen im Umgang mit den neuen Medien, aber auch die Notwendigkeit, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um den Bedürfnissen der Lernenden gerecht zu werden.
Die Diskussion der Ergebnisse beleuchtet die Herausforderungen der digitalen Transformation im berufspädagogischen Kontext. Dabei werden Themen wie Kontrolle und Kontrollverlust, die Reproduktion von Milieugrenzen durch Unterschiede im medialen Habitus und die Bedeutung einer digitalen Sprachkompetenz behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Digitalisierung, Pflegeausbildung, Web 2.0, Social Media, Medienkompetenz, Habitus, Kommunikation, Interaktion, Beziehungsgestaltung und berufspädagogische Praxis. Die Arbeit untersucht die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Rolle von Lehrenden und Lernenden in der Pflegeausbildung und bietet Einblicke in die Herausforderungen und Chancen der Integration neuer Medien in den Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Digitalisierung die Pflegeausbildung?
Sie verändert die Informationsbeschaffung (Web 2.0) und erfordert neue didaktische Konzepte sowie Medienkompetenz bei Lehrenden und Lernenden.
Was versteht man unter dem „medialen Habitus“?
Nach Pierre Bourdieu beschreibt dies die verinnerlichten Muster der Mediennutzung, die je nach sozialem Milieu und Generation variieren.
Warum haben Lehrende oft Widerstände gegen digitale Medien?
Gründe sind oft Vertrauensdefizite in die Qualität von Internetquellen, Unsicherheit bei der Technik und die Sorge vor Kontrollverlust im Unterricht.
Was ist der Unterschied zwischen Digital Natives und Digital Immigrants?
Natives sind mit digitaler Technik aufgewachsen; Immigrants haben diese erst im Erwachsenenalter erlernt, was zu unterschiedlichen Nutzungsmustern führt.
Welche Rolle spielt Social Media im Lernprozess?
Plattformen wie WhatsApp oder Facebook können als Kommunikations- und Austauschräume dienen, bergen aber auch das Risiko von Unterrichtsstörungen.
Wie kann die Qualität von Internetinformationen in der Pflege gesichert werden?
Lehrende müssen Lernende befähigen, Quellen kritisch zu prüfen, um professionelle Pflegeentscheidungen auf Basis valider Daten zu treffen.
- Arbeit zitieren
- Jeanette Siebert (Autor:in), 2018, Kommunikations- und Informationswege in der Pflegeausbildung im Wandel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453121