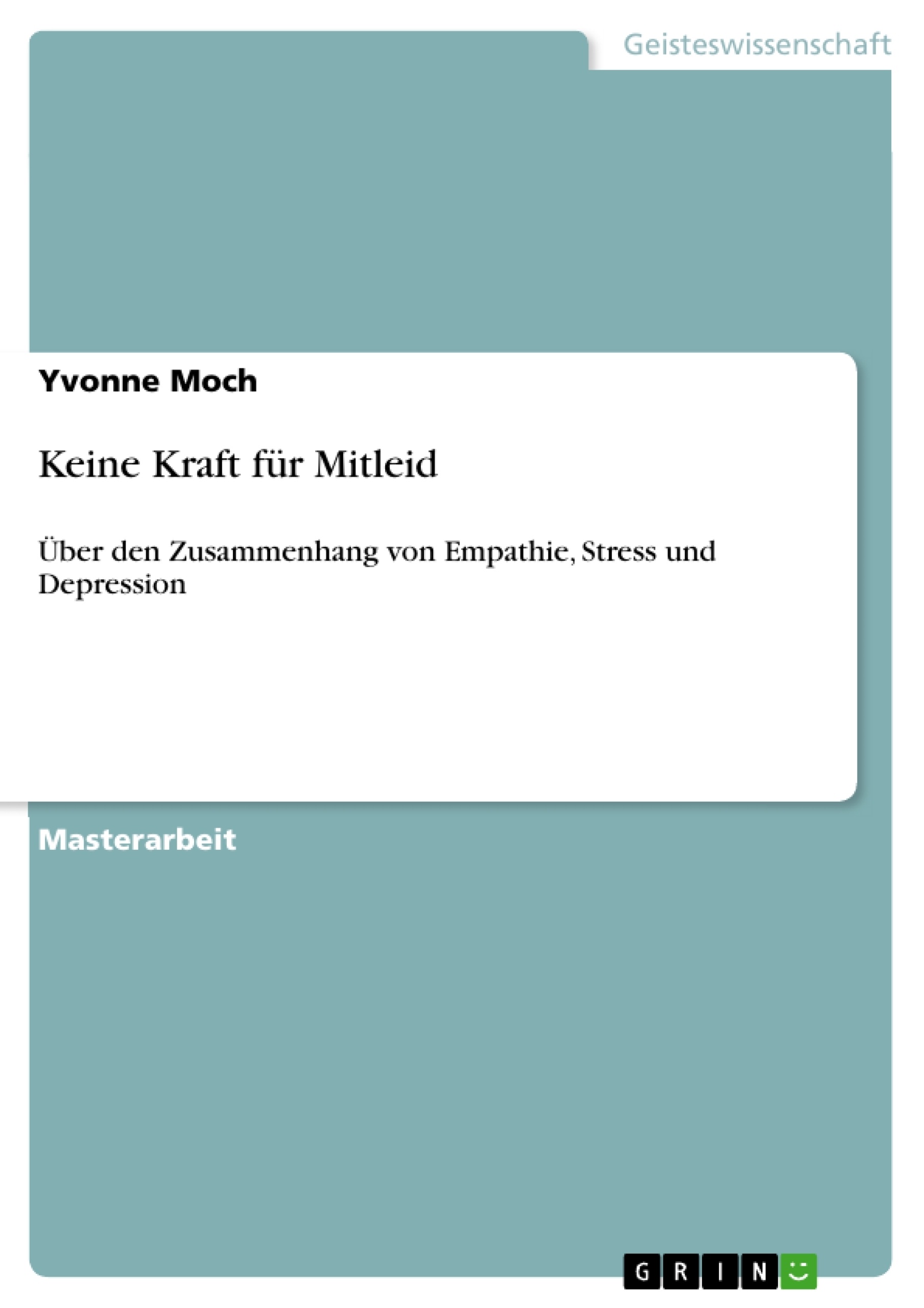In dieser Arbeit wurden die Zusammenhänge von Empathie, Stress und Depression unter der Zuhilfenahme eines Onlinefragebogen erforscht, welcher sich aus folgenden Messinstrumenten zusammensetzte: dem Interpersonal Reactivity Index, der Cambridge Mindreading Face-Battery, der Perceived Stress-Scale, dem Stressverarbeitungsfragebogen sowie dem revidierten Beck Depression Inventory.
Auf der Grundlage einer Theorie von Eisenberg und Kollegen (1989, 1990) wurde bezüglich der Verbindung zwischen Empathie und Stress ein umgekehrt u-förmiger Zusammenhang an-genommen. Des Weiteren wurde ein positiver, linearer Zusammenhang zwischen Stress und der Empathiefacette Personal Distress vermutet. In der zweiten Hypothese wurden die beiden Variablen der kognitiven Empathie (die Leistung in der CAM und die IRI-Facette Perspective Taking) auf ihre Gemeinsamkeiten hin überprüft. Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Empathie und Depression wurde von einem positiven Zusammenhang zwischen Empathie und Personal Distress ausgegangen, während sich die übrigen IRI-Variablen nicht zwischen Menschen mit verschiedener Depressionsschwere unterscheiden sollten. Außerdem wurde vermutet, dass depressive Personen schlechtere Leistungen in der korrekten Benennung von Gesichtsausdrücken zeigen. Die vierte Hypothesengruppe thematisierte den Zusammenhang zwischen Stress und Depression, wobei hier von einer positiven Linearität ausgegangen wurde. Außerdem wurde angenommen, dass die Valenz der hauptsächlich eingesetzten Copingstrategien einen moderierenden Effekt auf diesen Zusammenhang haben würde.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Einführung
- Theoretische Grundlagen
- Empathie
- Stress
- Depression
- Bisherige Befunde zu Verbindungen zwischen Empathie, Stress und Depression
- Zielsetzung und Hypothesen
- Methodisches Vorgehen
- Verwendete Testverfahren zur Erfassung von Empathie (IRI, CAM)
- Verwendete Fragebögen zur Erfassung von Stress (PSS-10, SVF 120)
- Verwendeter Fragebogen zur Erfassung von Depression (BDI-II)
- Verwendete Fragebögen zur Erfassung von Persönlichkeit (BFI-10, IPIP-240) und belastender Lebensereignisse (CLEQ)
- Stichprobe
- Durchführung
- Ergebnisse
- Vorbereitung der Variablen und Gütekriterien
- Überprüfung der Hypothesen zu Stress und Empathie
- Überprüfung der Hypothese zur gezeigten und berichteten Empathie
- Überprüfung der Hypothesen zu Empathie und Depression
- Überprüfung der Hypothesen zu Stress und Depression
- Diskussion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Empathie, Stress und Depression. Ziel ist es, die angenommenen Beziehungen zwischen diesen Variablen mithilfe eines Online-Fragebogens zu überprüfen und praktische Implikationen für die Forschung und Anwendung zu identifizieren.
- Zusammenhang zwischen Empathie und Stress
- Zusammenhang zwischen Stress und Depression
- Zusammenhang zwischen Empathie und Depression
- Einfluss von Copingstrategien auf den Stress-Depression-Zusammenhang
- Untersuchung kognitiver Aspekte der Empathie
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, indem sie den zunehmenden Stress in der modernen, globalisierten Gesellschaft und die damit verbundenen psychischen Folgen wie Depressionen beleuchtet. Sie hebt die Bedeutung von Empathie im Kontext von zwischenmenschlichen Beziehungen hervor, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen reduzierter Face-to-Face-Interaktionen. Die Arbeit zielt auf die Untersuchung der komplexen Zusammenhänge zwischen Empathie, Stress und Depression ab, wobei der Fokus auf der Überprüfung bestehender Hypothesen liegt.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund der Studie. Es werden die Konzepte von Empathie, Stress und Depression umfassend definiert und unterschiedliche Theorien und Modelle zu ihrem Verständnis vorgestellt. Der Abschnitt beleuchtet verschiedene Facetten der Empathie und diskutiert verschiedene Stressmodelle. Zusätzlich wird die Forschung zu Depressionen in ihren verschiedenen Erscheinungsformen und Ursachen zusammenfassend dargestellt. Die Kapitel legen den Grundstein für die Formulierung der Hypothesen und die Interpretation der Ergebnisse.
Methodisches Vorgehen: In diesem Kapitel wird die Methodik der Studie detailliert beschrieben. Es werden die verwendeten Messinstrumente, wie der Interpersonal Reactivity Index (IRI), die Cambridge Mind Reading Face Battery (CAM), die Perceived Stress Scale (PSS), der Stressverarbeitungsfragebogen (SVF) und der Beck Depression Inventory (BDI-II), vorgestellt und ihre psychometrischen Eigenschaften erläutert. Die Zusammensetzung der Stichprobe wird beschrieben und das Vorgehen bei der Datenerhebung und -analyse detailliert dargestellt. Die Beschreibung der Methodik soll die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Studie gewährleisten.
Schlüsselwörter
Empathie, Stress, Depression, Personal Distress, Kognitive Empathie, Copingstrategien, Online-Fragebogen, IRI, CAM, PSS, SVF, BDI-II.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Zusammenhänge zwischen Empathie, Stress und Depression
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen Empathie, Stress und Depression. Sie überprüft die Beziehungen zwischen diesen drei Variablen mithilfe eines Online-Fragebogens und identifiziert praktische Implikationen für Forschung und Anwendung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Zusammenhang zwischen Empathie und Stress, Stress und Depression, sowie Empathie und Depression. Zusätzlich wird der Einfluss von Copingstrategien auf den Stress-Depression-Zusammenhang und die kognitiven Aspekte der Empathie untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Abstract, Einführung, Theoretische Grundlagen (Empathie, Stress, Depression, bisherige Befunde), Zielsetzung und Hypothesen, Methodisches Vorgehen (Testverfahren, Fragebögen, Stichprobe, Durchführung), Ergebnisse (Vorbereitung der Variablen, Hypothesenüberprüfung), Diskussion und Ausblick.
Welche Testverfahren und Fragebögen wurden verwendet?
Zur Erfassung von Empathie wurden der Interpersonal Reactivity Index (IRI) und die Cambridge Mind Reading Face Battery (CAM) eingesetzt. Stress wurde mit der Perceived Stress Scale (PSS-10) und dem Stressverarbeitungsfragebogen (SVF 120) gemessen, Depression mit dem Beck Depression Inventory (BDI-II). Persönlichkeit wurde mit dem BFI-10 und IPIP-240 erfasst, belastende Lebensereignisse mit dem CLEQ.
Wie ist die Stichprobe zusammengesetzt?
Die Informationen zur genauen Zusammensetzung der Stichprobe finden sich im Kapitel "Methodisches Vorgehen".
Welche Hypothesen wurden überprüft?
Die Arbeit überprüft Hypothesen zu den Zusammenhängen zwischen Stress und Empathie, gezeigter und berichteter Empathie, Empathie und Depression, sowie Stress und Depression.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die detaillierten Ergebnisse sind im Kapitel "Ergebnisse" dargestellt. Es werden die Ergebnisse der Hypothesenüberprüfungen präsentiert.
Wo finde ich die Zusammenfassung der Kapitel?
Eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einführung, Theoretische Grundlagen, Methodisches Vorgehen) ist im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" enthalten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Empathie, Stress, Depression, Personal Distress, Kognitive Empathie, Copingstrategien, Online-Fragebogen, IRI, CAM, PSS, SVF, BDI-II.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die theoretischen Grundlagen umfassen umfassende Definitionen und verschiedene Theorien und Modelle zu Empathie, Stress und Depression. Es werden verschiedene Facetten der Empathie, Stressmodelle und die Forschung zu Depressionen in ihren verschiedenen Erscheinungsformen und Ursachen dargestellt.
- Citar trabajo
- M.Sc. Psychologie Yvonne Moch (Autor), 2018, Keine Kraft für Mitleid, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453181