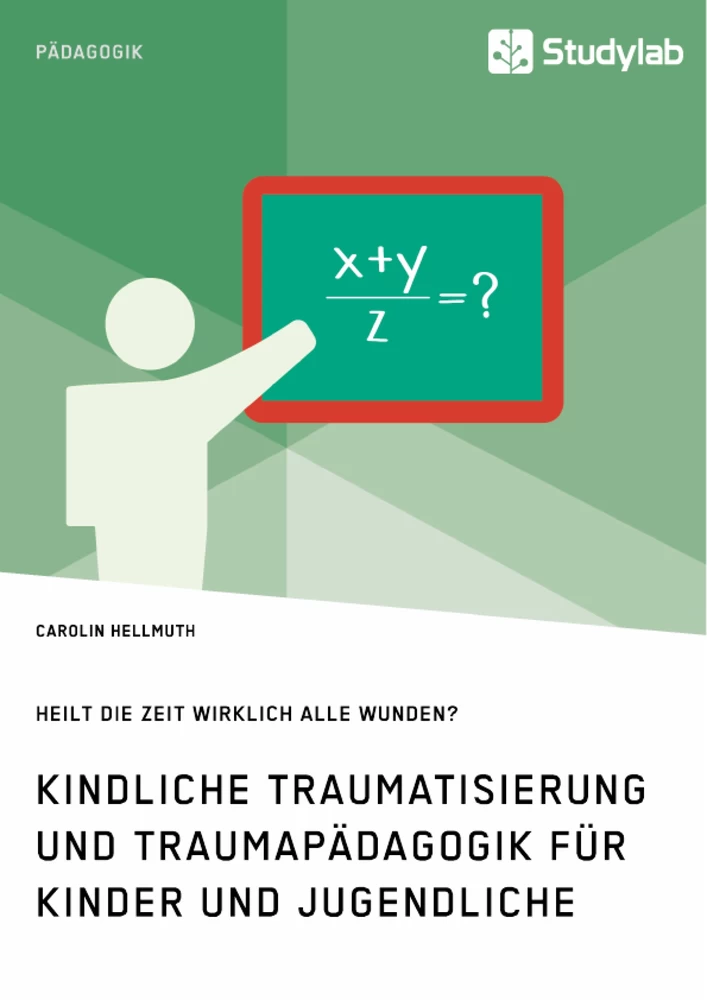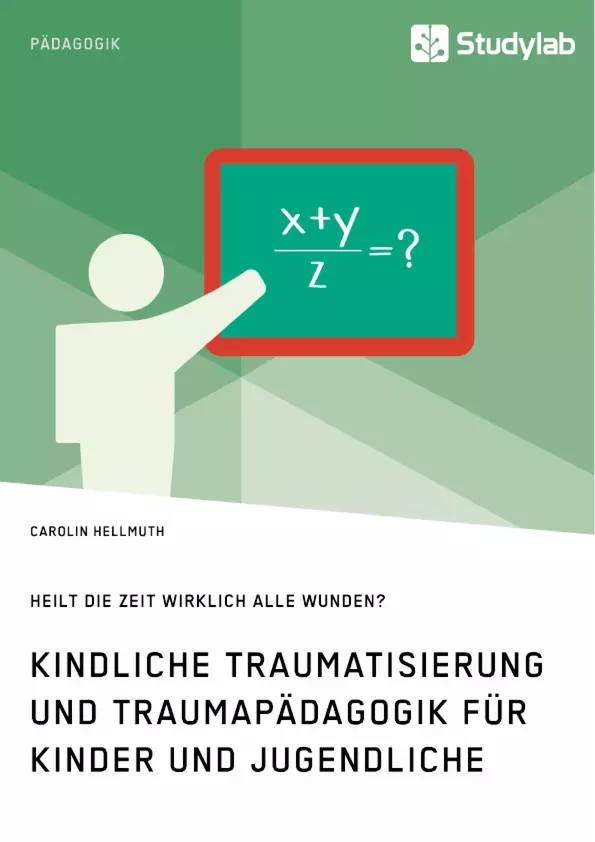Traumatische Erfahrungen hinterlassen verheerende Spuren im Leben eines Kindes. Oft beeinflussen sie auch die weitere kindliche Entwicklung negativ. Doch Erzieherinnen oder Lehrer erkennen nicht immer, wenn auffällige Verhaltensweisen auf traumatische Erlebnisse zurückgehen.
Unabdingbar sind daher adäquate Hilfsangebote, die das Kind bei der Bewältigung seiner traumatischen Erfahrungen unterstützen. Was kann die Traumapädagogik in diesem Prozess leisten? In ihrer Publikation geht Carolin Hellmuth dieser Frage nach.
Der Umgang mit traumatisierten Kindern kann schnell zu Überforderung führen, vor allem im näheren Umfeld des Kindes. Hellmuth erklärt die Formen kindlicher Traumatisierung sowie deren Folgen für die kindliche Entwicklung. Im Anschluss stellt sie unterschiedliche Konzepte der Traumapädagogik vor.
Aus dem Inhalt:
- Trauma;
- Traumafolgestörungen;
- ADHS;
- Posttraumatische Belastungsstörung;
- Traumatherapie;
- Kinder und Jugendliche
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Trauma
- Trauma- Klassifikation
- Zwischenfazit
- Neurobiologische Prozesse
- Funktionen der Hirnareale
- Bedeutung von Hormonen und Neurotransmittern
- Traumaverarbeitung
- Neurobiologische Bewältigungsstrategien
- Zwischenfazit
- Formen kindlicher Traumatisierungen
- Vernachlässigung
- Kindesmisshandlung
- Sexuelle Gewalt
- weitere Formen kindlicher Traumatisierungen
- Zwischenfazit
- Folgen traumatischer Ereignisse
- Traumafolgestörungen
- Risiko- und Schutzfaktoren
- Folgen eines traumatischen Ereignisses auf Kinder
- Spätfolgen einer unverarbeiteten kindlichen Traumatisierung
- Zwischenfazit
- Entwicklung unter traumatischen Bedingungen
- Traumakompensatorische Muster
- Zwischenfazit
- Unterstützungsmöglichkeiten
- Institutionen und Hilfsformen
- Zwischenfazit
- Notwendigkeiten professioneller Traumapädagogik
- Grundkompetenzen und Haltungen für professionelles Handel
- Zentrale Aspekte traumapädagogischer Interventionen
- Bindungsorientierung
- Zwischenfazit
- Konzepte der Traumapädagogik
- Konzept des sicheren Ortes
- Pädagogik der Selbstbemächtigung
- Traumapädagogische Gruppenarbeit
- Weitere traumapädagogische Konzepte
- Zwischenfazit
- Traumatherapie vs. Traumapädagogik
- Abgrenzungen
- Zwischenfazit
- Herausforderungen und Grenzen für pädagogische Fachkräfte
- Selbstfürsorge
- Zwischenfazit
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis von kindlicher Traumatisierung und der Rolle der Traumapädagogik in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Es beleuchtet die neurobiologischen Prozesse, die bei Traumatisierung ablaufen, und untersucht die verschiedenen Formen kindlicher Traumatisierungen sowie deren Auswirkungen auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen.
- Neurobiologische Prozesse bei Trauma
- Formen kindlicher Traumatisierungen
- Folgen traumatischer Ereignisse für Kinder
- Entwicklung unter traumatischen Bedingungen
- Notwendigkeiten und Konzepte der Traumapädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Trauma und Traumapädagogik ein. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Klassifikation von Trauma und beleuchtet die neurobiologischen Prozesse, die bei Traumatisierung eine Rolle spielen. In Kapitel 3 werden die verschiedenen Formen kindlicher Traumatisierungen, wie Vernachlässigung, Kindesmisshandlung und sexuelle Gewalt, untersucht. Kapitel 4 befasst sich mit den Folgen traumatischer Ereignisse, darunter Traumafolgestörungen, Risiko- und Schutzfaktoren sowie Spätfolgen einer unverarbeiteten kindlichen Traumatisierung. Kapitel 5 analysiert die Entwicklung unter traumatischen Bedingungen und die Entstehung traumakompensatorischer Muster. Kapitel 6 behandelt verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für traumatisierte Kinder und Jugendliche. In Kapitel 7 werden die Notwendigkeiten und Grundkompetenzen für professionelles Handeln in der Traumapädagogik vorgestellt. Kapitel 8 beleuchtet verschiedene traumapädagogische Konzepte und deren Anwendung in der Praxis. Schließlich werden in Kapitel 9 die Unterschiede zwischen Traumatherapie und Traumapädagogik herausgearbeitet. Das Buch schließt mit einer Betrachtung der Herausforderungen und Grenzen, denen pädagogische Fachkräfte im Umgang mit Traumatisierung begegnen.
Schlüsselwörter
Kindliche Traumatisierung, Traumapädagogik, Neurobiologie, Traumafolgen, Entwicklung, Unterstützungsmöglichkeiten, professionelles Handeln, traumapädagogische Konzepte, Traumatherapie.
- Citar trabajo
- Carolin Hellmuth (Autor), 2019, Kindliche Traumatisierung und Traumapädagogik für Kinder und Jugendliche. Heilt die Zeit wirklich alle Wunden?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453240