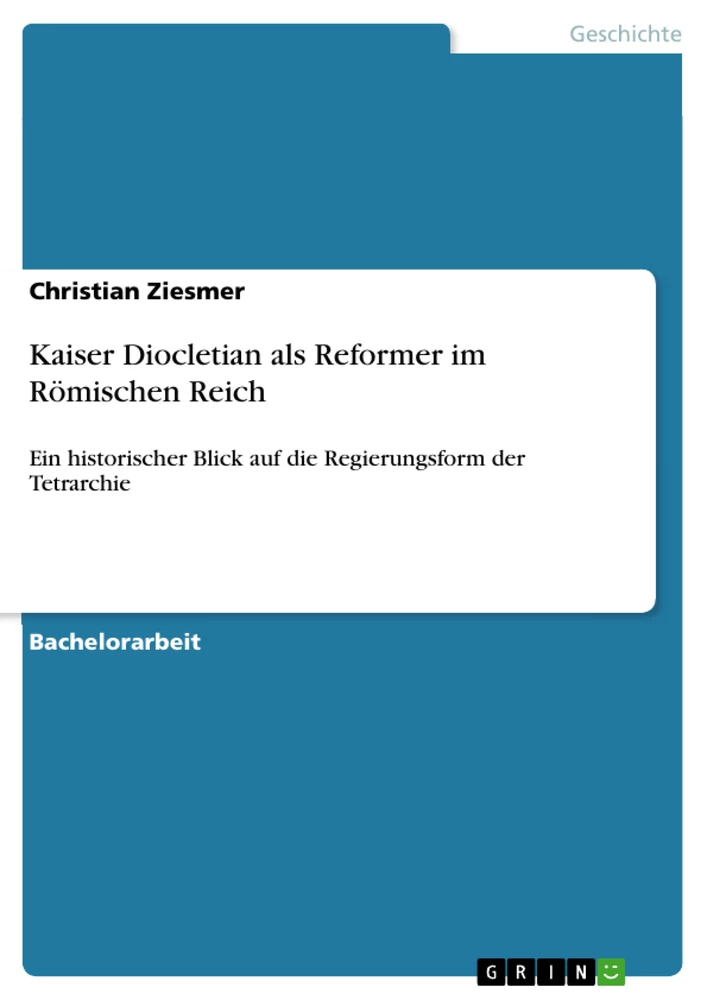Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Augustus Diocletian als Reformer. Nach einer Phase der Destabilisierung nahm er das Zepter des Imperium Romanus in die Hand und konnte durch weitreichende Reformen die inneren und äußeren Krisenherde abwenden. Im Zentrum der Arbeit wird der Wandel von der Allein- oder Doppelherrschaft zur "Vier-Mann-Herrschaft" als Antwort auf die jahrzehntelange Krise des Römischen Reiches untersucht. Das Ziel der Arbeit wird es sein, die Reform des Herrschaftstypus zu untersuchen. Dabei wird die politische Neuordnung, die Tetrarchie, in Vergleich zum vorherigen Herrschaftstypus, der Dyarchie, gesetzt. Dabei gilt es zu klären, inwieweit die Tetrarchie einem geplanten Konstrukt gleicht. Abzugrenzen ist die Arbeit von den Reformbestrebungen der Augusti während der diocletianisch-tetrarchischen Zeit, da alleinig die Reform des Herrschaftstypus im Fokus der Arbeit steht.
Hierzu wird es eine Einführung in Form eines ereignisgeschichtlichen Überblicks geben, um über die Problematik der Reichskrise im dritten Jahrhundert und die Epoche der Soldatenkaiser die Symptomatik des geschwächten Römischen Reiches aufzuzeigen. Diesbezüglich wird das Beispiel der vorherigen Dyarchie von Carus, Carinus und Numerianus angeführt, um einerseits ein zeitnahes Problembeispiel anzuführen und um andererseits einen Vergleich der anschließenden Reformen zu ermöglichen.
Im ersten Abschnitt des Hauptteils wird der Herrschaftstypus der Dyarchie über den Lebensweg Diocletians bis zu seiner Kaiserproklamation nachgezeichnet. Zur besseren Strukturierung der Arbeit folgt nach der Bezugnahme der Herrschaftsideologie über den Entschluss der dyarchischen Strukturen ein kurzes Fazit. Im zweiten Abschnitt des Hauptteils wird die Zusammenarbeit der Dyarchen und die Problematik dieses Herrschaftstypus am Beispiel des Usurpators Carausius erörtert. Diesem Beispiel folgend wird die Reform zur Tetrarchie angeschlossen. Hierzu wird die sukzessive Einführung der tetrarchischen Strukturen erläutert und das Beispiel des Carausius erneut aufgegriffen, wodurch der Wandel und die Planung des Konstruktes der Tetrarchie nachvollzogen werden soll. Hierzu schließt die Arbeit mit einer Schlussfolgerung der vorangestellten Schilderungen ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage
- Ereignisgeschichtlicher Hintergrund
- Die Reichskrise
- Die Soldatenkaiser
- Die Herrschaft des Carus', Carinus' und Numerianus'
- Das dyarchische Prinzip
- Diocletians Weg zur Herrschaft
- Die Ernennung zum Caesar
- Iovius et Herculius
- Zwischenfazit zum Entschluss der Dyarchie
- Die Zusammenarbeit der Dyarchen
- Die ersten Schritte der Zusammenarbeit
- Das ,Sonderreich' Britannien
- Die Tetrarchie
- Die Reform des politischen Herrschaftssystems
- Ein geglückter Reformimpuls am Beispiel Britanniens
- In Eintracht regierend
- Die Übergabe der Regierungsgewalt
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die umfassenden Reformen des römischen Kaisers Diocletian im 3. Jahrhundert nach Christus, die zur Einführung der Tetrarchie führten. Insbesondere konzentriert sich die Arbeit auf die Frage, inwieweit diese politische Neuordnung, die auf einer "Vier-Mann-Herrschaft" beruhte, ein geplantes Konstrukt war. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse der Tetrarchie im Vergleich zur vorherigen Dyarchie.
- Die Reichskrise im 3. Jahrhundert und die Epoche der Soldatenkaiser
- Der Wandel des Herrschaftstypus von der Allein- oder Doppelherrschaft zur Tetrarchie
- Die Herausforderungen der Zusammenarbeit zwischen den Dyarchen
- Die sukzessive Einführung der Tetrarchie als Reformmaßnahme
- Die Tetrarchie als geplantes Konstrukt und ihre Auswirkungen auf die Stabilität des römischen Reiches
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung gibt einen Überblick über die Reformen Diocletians und die Problematik der Reichskrise im dritten Jahrhundert.
- Das Kapitel "Quellenlage" beleuchtet die wichtigsten literarischen Quellen, die für die Untersuchung der tetrarchischen Zeit relevant sind.
- Das Kapitel "Ereignisgeschichtlicher Hintergrund" schildert die Reichskrise und die Epoche der Soldatenkaiser als Vorgeschichte für die Tetrarchie. Des Weiteren wird die Herrschaft der Dyarchie von Carus, Carinus und Numerianus analysiert.
- Das Kapitel "Das dyarchische Prinzip" untersucht die Entwicklung der Dyarchie, Diocletians Weg zur Macht und die Prinzipien der gemeinsamen Herrschaft.
- Das Kapitel "Die Zusammenarbeit der Dyarchen" analysiert die Schwierigkeiten der Zusammenarbeit und die Problematik der Usurpation am Beispiel von Carausius.
- Das Kapitel "Die Tetrarchie" erläutert die Reform des politischen Herrschaftssystems und untersucht die Auswirkungen der Tetrarchie am Beispiel Britanniens.
- Das Kapitel "Die Übergabe der Regierungsgewalt" analysiert den Prozess der Machtübertragung innerhalb der Tetrarchie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der tetrarchischen Reform des römischen Reiches unter Diocletian. Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenbereiche sind: Reichskrise, Soldatenkaiser, Dyarchie, Tetrarchie, politische Neuordnung, Reform des Herrschaftstypus, geplantes Konstrukt, Stabilität des römischen Reiches. Die Arbeit beleuchtet insbesondere die Ursachen und Auswirkungen der tetrarchischen Reform sowie die Bedeutung von Zusammenarbeit und Machtübergabe innerhalb des neuen politischen Systems.
- Citation du texte
- Christian Ziesmer (Auteur), 2016, Kaiser Diocletian als Reformer im Römischen Reich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453808