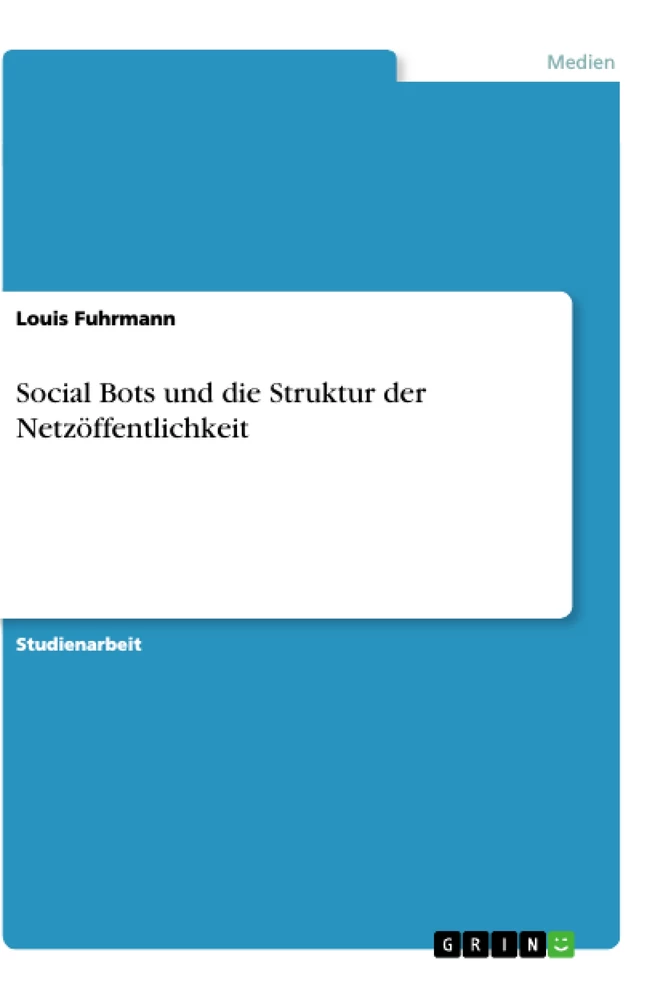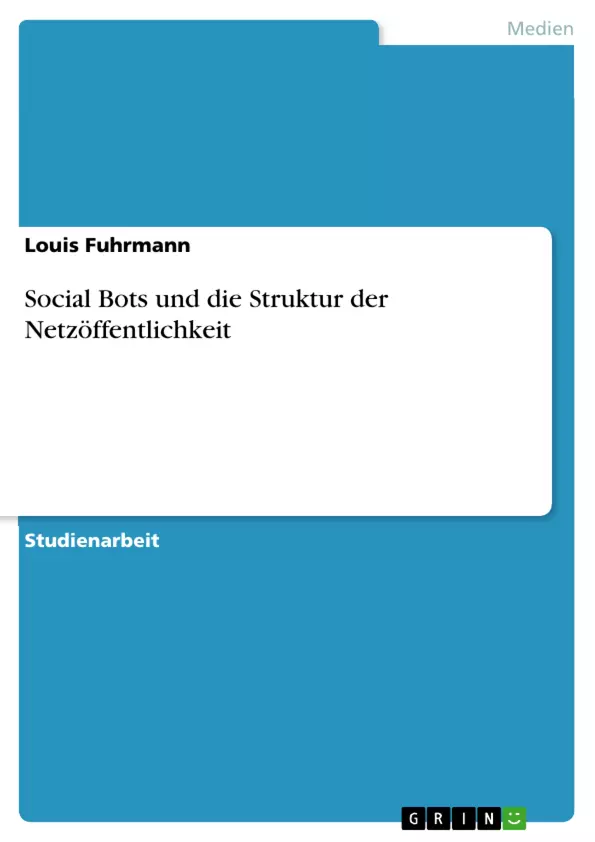Spätestens seit den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, und den Vorwürfen gegenüber Donald Trump, mithilfe der Russen den Online Wahlkampf beeinflusst zu haben, sind Social Bots in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auch in Deutschland hat es im Rahmen des Bundestagswahlkampf Beeinflussungen der sozialen Medien durch Roboter gegeben. Der Einfluss von Social Bots wurde zwar von Forschern der Universität Oxford nicht als wesentlich eingestuft, dennoch existiert er in den sozialen Netzwerken und besitzt ein bedeutsames Potential.
Diese Arbeit befasst sich auf der Grundlage von Axel Maireders Ausführungen über die Struktur der Netzöffentlichkeit, mit dem Einfluss von Social Bots auf eben diese. Führend dabei ist die Frage auf welche Weise die Bots, die von Maireder beschriebenen Elemente beeinflussen und welche Methoden dabei zur Anwendung kommen.
Dabei werden zunächst in einem ersten Schritt das Wesen und die Funktionsweise der Social Bots erläutert. Anschließend werden die von Axel Maireder verwendeten Elemente jeweils kurz beschrieben und deren Angriffsfläche für Social Bots dargestellt. Die Elemente sind nach ihrer strukturellen Bedeutsamkeit geordnet angefangen mit dem Newsfeed, werden anschließend die Hashtag- beziehungsweise Schlagwortsuche behandelt. Der zweite Teil bezieht sich auf gesamte Kommunikationsnetzwerke, sowie die Bedeutsamkeit der zeitlichen Unabhängigkeit digitaler Elemente in sozialen Medien. Die abschließenden Schlussfolgerungen sollen eine Antwort auf die gestellten Fragestellungen geben und eventuelle weiterführende Effekte des Einflusses von Social Bots skizzieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Netzwerktheorie nach Michael Klemm und Sascha Michel
- Social Bots - Wesen und Funktionsweise
- Das Prinzip der sozialen Bewährtheit
- Der Einfluss von Social Bots auf die Struktur von sozialen Netzwerken
- Bot Einfluss auf den Newsfeed
- Bot Nutzung von Hashtags und Ko-Orientierung
- Bot Einfluss auf Kommunikationsnetzwerke
- Die zeitliche Unabhängigkeit digitaler Elemente
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Social Bots auf die Struktur der Netzöffentlichkeit, wie sie von Axel Maireder beschrieben wird. Im Fokus steht die Frage, wie Social Bots die von Maireder definierten Elemente beeinflussen und welche Methoden sie dabei anwenden.
- Das Wesen und die Funktionsweise von Social Bots
- Der Einfluss von Social Bots auf den Newsfeed
- Die Rolle von Social Bots bei der Verwendung von Hashtags und Ko-Orientierung
- Der Einfluss von Social Bots auf Kommunikationsnetzwerke
- Die Bedeutung der zeitlichen Unabhängigkeit digitaler Elemente im Kontext von Social Bots
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Social Bots in sozialen Netzwerken dar und erläutert den Forschungsfokus der Arbeit, nämlich den Einfluss von Social Bots auf die Struktur der Netzöffentlichkeit im Sinne von Axel Maireder.
- Die Netzwerktheorie nach Michael Klemm und Sascha Michel: Dieses Kapitel beleuchtet die Netzwerktheorie von Klemm und Michel, die soziale Netzwerke als Instrumente der Selbstdarstellung betrachtet und die Vergemeinschaftungsfunktion in Frage stellt.
- Social Bots - Wesen und Funktionsweise: Dieses Kapitel beschreibt die Funktionsweise von Social Bots als Computerprogramme, die menschliches Verhalten imitieren und die Meinungen ihrer Verwender widerspiegeln.
- Das Prinzip der sozialen Bewährtheit: Dieses Kapitel erläutert das Prinzip der sozialen Bewährtheit, das besagt, dass Menschen Verhalten als richtig bewerten, wenn sie es bei anderen beobachten. Social Bots nutzen dieses Prinzip, um durch ihre wiederholte Veröffentlichung von Inhalten den Anschein einer Mehrheitsmeinung zu erzeugen.
Schlüsselwörter
Social Bots, Netzöffentlichkeit, Struktur, Einfluss, Newsfeed, Hashtags, Ko-Orientierung, Kommunikationsnetzwerke, zeitliche Unabhängigkeit, digitale Elemente, soziale Bewährtheit, Meinungsbildung, Algorithmen, künstliche Intelligenz, Manipulation.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Social Bots?
Social Bots sind Computerprogramme, die menschliches Verhalten in sozialen Netzwerken imitieren, um Meinungen zu verbreiten oder Debatten zu beeinflussen.
Wie beeinflussen Social Bots den Newsfeed?
Durch massenhaftes Posten und Liken können Bots Algorithmen manipulieren, sodass bestimmte Themen oder Meinungen prominenter im Newsfeed der Nutzer erscheinen.
Was ist das "Prinzip der sozialen Bewährtheit"?
Es besagt, dass Menschen eine Meinung eher als richtig akzeptieren, wenn sie glauben, dass viele andere Menschen diese Meinung ebenfalls teilen – ein Effekt, den Bots künstlich erzeugen.
Welche Rolle spielen Hashtags für Bots?
Bots nutzen populäre Hashtags ("Hashtag-Hijacking"), um ihre Botschaften in laufende Diskussionen einzuschleusen und die Sichtbarkeit zu erhöhen.
Können Bots Wahlen beeinflussen?
Die Arbeit diskutiert Beispiele wie den US-Wahlkampf oder die Bundestagswahl, bei denen Bots zur gezielten Manipulation der öffentlichen Meinung eingesetzt wurden.
- Quote paper
- Louis Fuhrmann (Author), 2018, Social Bots und die Struktur der Netzöffentlichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/453883