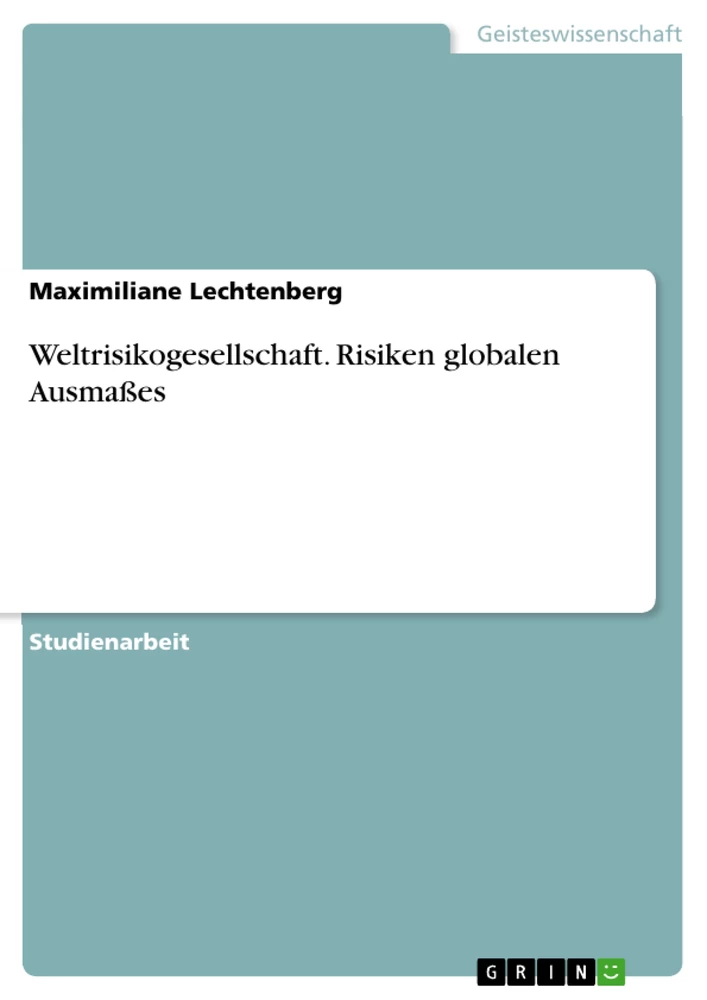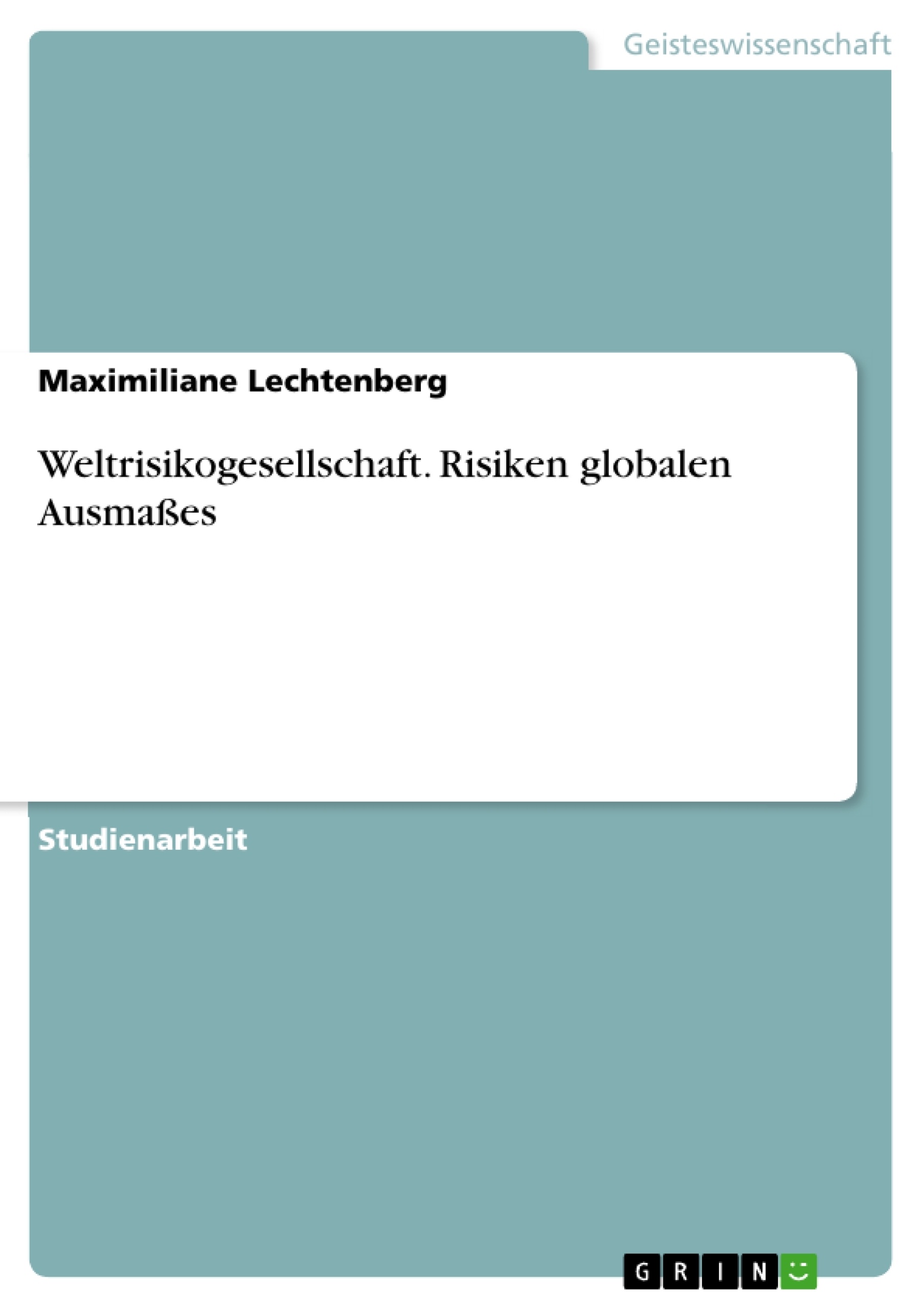Innerhalb dieser Hausarbeit soll das Konzept der Weltrisikogesellschaft erläutert werden, um dadurch zu zeigen, inwiefern es sich heute bereits um Risiken globalen Ausmaßes handelt. Um eine Aussage darüber treffen zu können, soll zunächst auf die Risikogesellschaft und die für sie typischen Risiken eingegangen werden.
In Abgrenzung dazu wird in Kapitel 3 die darauf aufbauende Weltrisikogesellschaft charakterisiert, wodurch die Perspektive globaler wird. Verschiedene Risikobegriffe, die von unterschiedlichen Soziologen verwendet werden, die sich ebenfalls dieser Diagnose widmen, werden in Kapitel 3.2 aufgeführt. Anschließend wendet sich der Blick auf den praktischen Umgang mit den behandelten globalen Risiken.
Zum Abschluss wird ein Fazit über die gewonnenen Erkenntnisse gezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Risikogesellschaft
- Diagnostik neuartiger Risiken
- Die Bedeutung der Risikowahrnehmung
- Weltrisikogesellschaft
- Abgrenzung zur Risikogesellschaft
- Risikobegriffe
- Umgang mit globalen Risiken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der Weltrisikogesellschaft und beleuchtet, inwieweit von globalen Risiken gesprochen werden kann. Ausgehend von Ulrich Becks Theorie der Risikogesellschaft wird die Weltrisikogesellschaft als Erweiterung und globale Perspektive betrachtet. Die Arbeit analysiert die Charakteristika beider Konzepte und deren praktische Relevanz.
- Charakterisierung der Risikogesellschaft und ihrer typischen Risiken
- Abgrenzung und Erweiterung zum Konzept der Weltrisikogesellschaft
- Analyse verschiedener Risikobegriffe innerhalb der soziologischen Diskussion
- Der Umgang mit globalen Risiken in der Praxis
- Die Rolle von Medien und Wirtschaft bei der Risikowahrnehmung und -gestaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Weltrisikogesellschaft ein und beschreibt den soziologischen Ansatz, die Gesellschaft anhand prägender Merkmale zu diagnostizieren. Sie stellt die Risikogesellschaft als Grundlage der Weltrisikogesellschaft vor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Charakteristika beider Konzepte beleuchtet und den Umgang mit globalen Risiken untersucht.
Die Risikogesellschaft: Dieses Kapitel beschreibt die von Ulrich Beck entwickelte Risikogesellschaft. Es analysiert die Entstehung neuartiger Risiken als Nebenfolgen des Modernisierungsprozesses, insbesondere durch die technisch-ökonomische Entwicklung. Ein Schwerpunkt liegt auf der beschränkten unmittelbaren Wahrnehmbarkeit dieser Risiken und den daraus resultierenden Interpretationsmöglichkeiten in Medien und Wirtschaft. Die veränderte Risikoverteilung, der sogenannte „Bumerang-Effekt“, der alle Gesellschaftsmitglieder gleichermaßen betrifft, wird ebenfalls erläutert. Schließlich wird der politische Aspekt beleuchtet, der sich in staatlichen Eingriffen zur Risikominderung zeigt, wie beispielsweise die EU-Verordnung zur Verminderung der CO²-Emissionen von Personenkraftwagen.
Schlüsselwörter
Weltrisikogesellschaft, Risikogesellschaft, globale Risiken, Modernisierung, Risikowahrnehmung, Ulrich Beck, technisch-ökonomische Entwicklung, Medien, Wirtschaft, Politik, CO²-Emissionen, Bumerang-Effekt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vorschau auf eine Arbeit über die Weltrisikogesellschaft
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Konzept der Weltrisikogesellschaft und analysiert, inwieweit von globalen Risiken gesprochen werden kann. Sie betrachtet die Weltrisikogesellschaft als Erweiterung und globale Perspektive der von Ulrich Beck entwickelten Risikogesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Charakterisierung der Risikogesellschaft und ihrer Risiken, die Abgrenzung und Erweiterung zum Konzept der Weltrisikogesellschaft, verschiedene Risikobegriffe in der soziologischen Diskussion, den Umgang mit globalen Risiken in der Praxis, sowie die Rolle von Medien und Wirtschaft bei der Risikowahrnehmung und -gestaltung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Risikogesellschaft, ein Kapitel zur Weltrisikogesellschaft und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den soziologischen Ansatz. Die Kapitel beleuchten die Charakteristika beider Konzepte und untersuchen den Umgang mit globalen Risiken.
Was wird im Kapitel "Die Risikogesellschaft" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt Becks Risikogesellschaft, analysiert neuartige Risiken als Nebenfolgen der Modernisierung, die beschränkte Wahrnehmbarkeit dieser Risiken und deren Interpretation in Medien und Wirtschaft. Es erläutert den „Bumerang-Effekt“ und den politischen Aspekt mit staatlichen Eingriffen zur Risikominderung (z.B. CO²-Emissionsverordnungen).
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Schlüsselbegriffe sind Weltrisikogesellschaft, Risikogesellschaft, globale Risiken, Modernisierung, Risikowahrnehmung, Ulrich Beck, technisch-ökonomische Entwicklung, Medien, Wirtschaft, Politik, CO²-Emissionen und Bumerang-Effekt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept der Weltrisikogesellschaft zu untersuchen und zu beleuchten, inwieweit von globalen Risiken gesprochen werden kann. Sie analysiert die Charakteristika beider Konzepte (Risikogesellschaft und Weltrisikogesellschaft) und deren praktische Relevanz.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Risikogesellschaft mit Unterkapiteln zur Diagnostik neuartiger Risiken und zur Bedeutung der Risikowahrnehmung, ein Kapitel zur Weltrisikogesellschaft mit Unterkapiteln zur Abgrenzung zur Risikogesellschaft, zu Risikobegriffen und zum Umgang mit globalen Risiken, sowie ein Fazit.
- Citar trabajo
- Maximiliane Lechtenberg (Autor), 2016, Weltrisikogesellschaft. Risiken globalen Ausmaßes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/454794