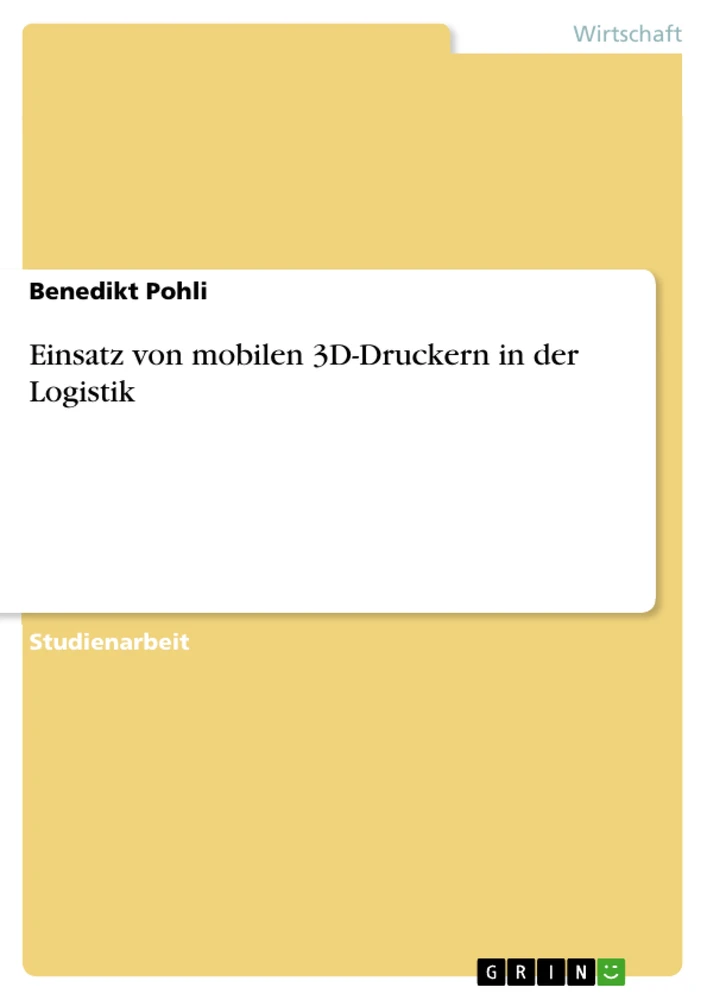Ziel dieser Arbeit ist es, diese Einsatzmöglichkeiten von mobilen 3D-Druckern in der Logistik nach ihren Nutzen, sowie den damit einhergehenden Herausforderungen darzustellen und zu evaluieren. Im weiteren Verlauf soll der Einsatz anhand eines Fallbeispiels dargestellt und auf Nutzen und Herausforderungen für den Logistikdienstleister betrachtet werden.
Unter der Überschrift „Industrie 4.0“, welche von der deutschen Bundesregierung mit der Zielsetzung zur Sicherung des Standortes und des Wohlstandes initiiert wurde, spielt die Vernetzung von Wertschöpfungsketten zwischen Produktion und Logistik eine zentrale Rolle.
Diese digitale Transformation der Wertschöpfungskette in der Logistikbranche gepaart mit der technologischen Weiterentwicklung von additiven Fertigungsverfahren wie dem 3D-Druckverfahren führt zu einer Vielzahl von Anwendungsgebieten von mobilen 3D-Druckern im Bereich der Logistik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau und Vorgehensweise
- Begriffsdefinition
- Logistik
- Mobile 3D-Drucker
- Grundlagen mobiler additiver Fertigungsverfahren
- Funktionsweise
- Einteilung AM-Maschinen
- Mobilitätsbewertung
- Logistik
- Einteilung
- Einsparmöglichkeiten
- Herausforderungen
- Fallbeispiel On-Demand-3D-Printing-Truck
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von mobilen 3D-Druckern im Logistikbereich. Ziel ist es, die Vorteile, Herausforderungen und Anwendungsgebiete dieser Technologie in der Logistik aufzuzeigen und zu analysieren. Im weiteren Verlauf wird ein Fallbeispiel genutzt, um die praktische Implementierung dieser Technologie und die Auswirkungen auf Logistikdienstleister zu beleuchten.
- Vorteile und Chancen von mobilen 3D-Druckern in der Logistik
- Herausforderungen und Risiken bei der Integration von mobilen 3D-Druckern
- Anwendungsgebiete von mobilen 3D-Druckern in der Logistik
- Optimierung von Logistikprozessen durch den Einsatz mobiler 3D-Druckverfahren
- Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Mehrwertdienstleistungen im Bereich der Logistik durch mobile 3D-Drucktechnologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der mobilen 3D-Drucktechnologie im Kontext der Logistik ein. Es beleuchtet die Problemstellung, die durch die digitale Transformation in der Wertschöpfungskette und die Weiterentwicklung von 3D-Druckverfahren entsteht. Weiterhin werden die Zielsetzung und der Aufbau der Arbeit vorgestellt.
- Begriffsdefinition: Dieses Kapitel definiert die wichtigsten Fachbegriffe aus den Bereichen Logistik und additive Fertigung. Es erläutert die zentralen Konzepte und gibt einen Überblick über die verschiedenen Arten von 3D-Druckern und deren Einsatz in der Logistik.
- Grundlagen mobiler additiver Fertigungsverfahren: Dieses Kapitel befasst sich mit den technischen Grundlagen und der Funktionsweise mobiler 3D-Druckverfahren. Es beleuchtet die verschiedenen Arten von 3D-Druckmaschinen und diskutiert deren Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen.
- Logistik: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von 3D-Druck auf die Logistik. Es befasst sich mit den verschiedenen Aspekten der Logistik, wie z.B. der Einteilung, den Einsparmöglichkeiten und den Herausforderungen. Darüber hinaus wird ein Fallbeispiel eines On-Demand-3D-Printing-Trucks vorgestellt.
Schlüsselwörter
Mobile 3D-Druck, Logistik, additive Fertigung, Industrie 4.0, digitale Transformation, Wertschöpfungskette, Mehrwertdienstleistungen, On-Demand-Produktion, Geschäftsmodelle, Herausforderungen, Fallbeispiel.
Häufig gestellte Fragen
Welche Vorteile bieten mobile 3D-Drucker für die Logistik?
Mobile 3D-Drucker ermöglichen die On-Demand-Produktion von Ersatzteilen oder Produkten direkt beim Kunden oder während des Transports, was Lagerkosten spart und Lieferzeiten verkürzt.
Was bedeutet „Industrie 4.0“ in diesem Zusammenhang?
Industrie 4.0 bezeichnet die intelligente Vernetzung von Wertschöpfungsketten. In der Logistik führt dies zur Verschmelzung von Produktion und Transport durch Technologien wie den 3D-Druck.
Was ist ein „On-Demand-3D-Printing-Truck“?
Dies ist ein Fallbeispiel für ein mobiles Labor oder einen LKW, der mit 3D-Druckern ausgestattet ist und Bauteile exakt dann und dort fertigt, wo sie benötigt werden.
Welche Herausforderungen gibt es bei mobilen additiven Fertigungsverfahren?
Zu den Herausforderungen gehören die technische Stabilität der Drucker während der Fahrt, die Qualitätssicherung der gedruckten Teile sowie rechtliche Fragen des Urheberrechts.
Wie verändert der mobile 3D-Druck die Rolle von Logistikdienstleistern?
Logistikdienstleister entwickeln sich zu Mehrwertdienstleistern, die nicht mehr nur Waren transportieren, sondern diese bei Bedarf auch selbst herstellen oder veredeln.
- Citation du texte
- Benedikt Pohli (Auteur), 2018, Einsatz von mobilen 3D-Druckern in der Logistik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455029