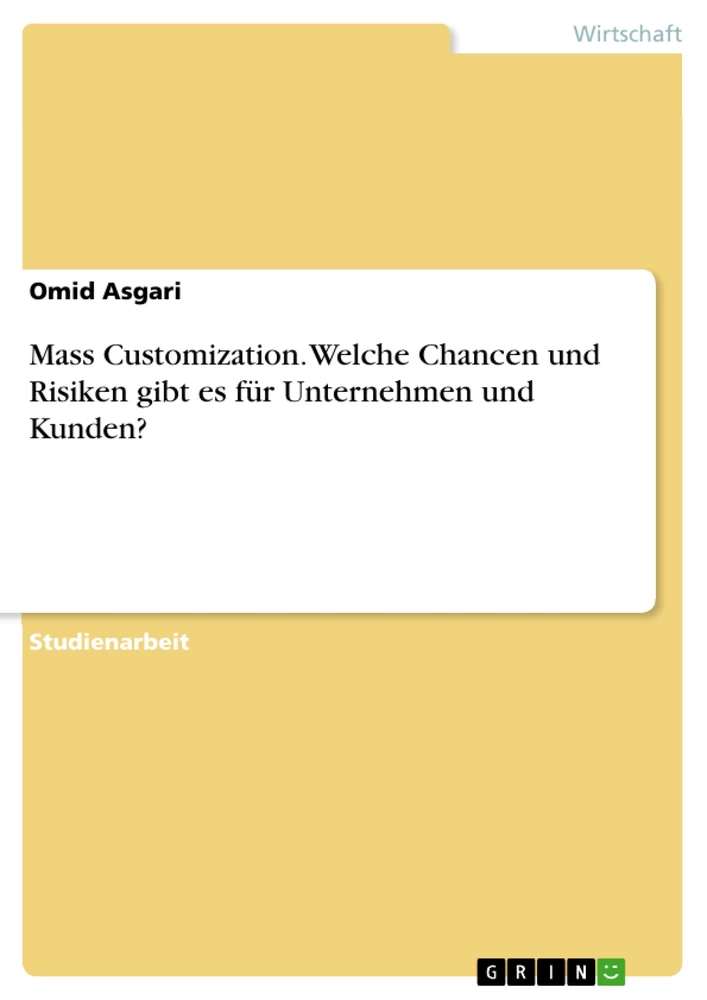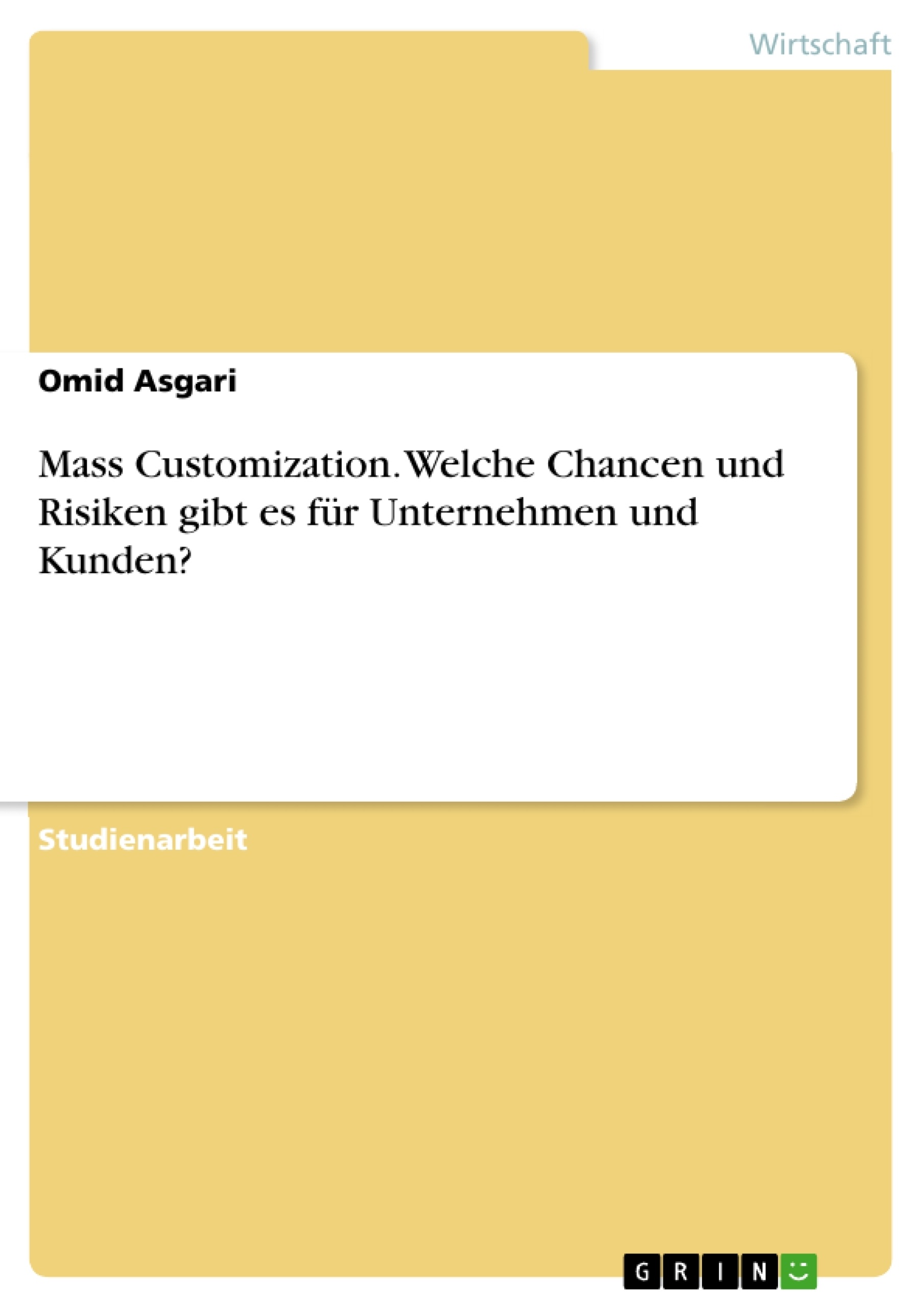Das Ziel dieser Seminararbeit ist es, die Erfolgsfaktoren der Unternehmen zu verdeutlichen, die sich "Mass Customization" als Ziel gesetzt haben, um auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig bleiben zu können. Aber auch Risiken und bestehende Grenzen und Herausforderungen, die mit dieser Strategie einhergehen, sollen aufgezeigt werden.
Um die Risiken und Chancen in einem Mass Customization deutlicher machen zu können, werden Praxisbeispiele der Porsche AG und der Firma Mymuesli, sowie diverse weitere Firmen herangezogen. Es wird die Frage geklärt, ob durch Mass Customization schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft entstehen und ob der Risikofaktor der Kundenunsicherheit, ein individuelles Produkt zu erwerben, von Unternehmen gezielt verringert werden kann. Haben Unternehmen durch die Chancen von Mass Customization einen Wettbewerbsvorteil erlangt?
Diejenigen, die eine klare Abgrenzung von Mass Production und Customization sehen, ähnelt die Verschmelzung durch Mass Customization einem paradoxes Wortspiel. Ist das Wort "Mass Customization", oder im Deutschen "kundenindividuelle Massenfertigung", nicht ein Widerspruch in sich? Wie ist es möglich, etwas in Masse zu produzieren und gleichzeitig ein Unikat zu sein? Weshalb brauchen wir überhaupt Mass Customization?
Die ersten ausführlichen Konzepte, die auf Mass Customization beruhen, wurden in Deutschland erst Mitte der neunziger Jahre durchgeführt, wohingegen andere Länder dieses Konzept schon deutlich früher betrachteten. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, so dass Deutschland die führende Kraft ist. In der heutigen Zeit wird immer häufiger von den individuellen Kundenwünschen gesprochen. Der weltweit wachsende wirtschaftliche Druck und der Trend hin zu Individualisierung, durch den Kunden, zwingt die Unternehmen sich dem wirtschaftlichen Wandel anzupassen, zu antizipieren und zu reagieren.
Bis vor einigen Jahren kam die Industrie noch damit aus, sich entweder über ein besonderes Produkt zu differenzieren, die Strategie des Kostenführers oder die Schwerpunktkonzentration zu verfolgen. Denken Sie an den Fordismus entwickelt von Herrn H. Ford. Ausschlaggebend für die enorme Veränderung ist der Konsument, der immer stärker auf das Preis-Nutzen-Verhältnis. Bei der Verfolgung der Kundenbedürfnisse und den stetig veränderten Marktbedingungen, kommt es nicht selten zu Problematiken bzw. falschen Entscheidungen, die zu Risiken führen
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung & Zielsetzung
- 1.2. Gang der Untersuchung
- 2. Individualisierungstrend
- 2.1. Eine ganz besondere Strategiekombination & seine Prinzipien
- 2.2. Herausforderungen
- 2.3. Abgrenzung zur klassischen Wertschöpfungskette
- 2.4. Abgrenzung von der Varianten- und Einzelfertigung
- 2.5. Arten der Umsetzungsmöglichkeiten
- 3. Chancen & Risiken
- 3.1. Chancen aus der Unternehmenssicht
- 3.2. Risiken aus der Unternehmenssicht
- 3.3. Kostenverlauf eines Unternehmens bei Umstellung auf MC
- 3.4. Chancen aus der Kundensicht
- 3.5. Risiken aus der Kundensicht
- 4. Wertschöpfungskette - Ergänzungen und seine Risiken
- 5. Zusammenfassung & Zukunftsausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Chancen und Risiken von Mass Customization (kundenindividuelle Massenfertigung) für Unternehmen. Ziel ist es, die Erfolgsfaktoren, aber auch die Grenzen und Herausforderungen dieser Strategie aufzuzeigen und anhand von Praxisbeispielen zu beleuchten. Dabei wird die Frage nach den wirtschaftlichen Folgen von Mass Customization und der Möglichkeit, Kundenunsicherheiten zu minimieren, erörtert.
- Entwicklung vom Fordismus zur Individualisierung
- Chancen und Risiken von Mass Customization aus Unternehmens- und Kundensicht
- Analyse der Wertschöpfungskette im Kontext von Mass Customization
- Kostenverlauf bei der Umstellung auf Mass Customization
- Wettbewerbsvorteile durch Mass Customization
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, dass Mass Customization als scheinbarer Widerspruch zwischen Massenproduktion und Individualität erscheint. Sie beleuchtet den wachsenden Druck durch Individualisierungswünsche der Kunden und den damit verbundenen Anpassungsbedarf der Unternehmen. Das Ziel der Arbeit ist die Darstellung der Erfolgsfaktoren und Risiken von Mass Customization sowie die Beantwortung der Frage nach Wettbewerbsvorteilen.
2. Individualisierungstrend: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung vom Fordismus zur Individualisierung, untermauert durch Statistiken und den Bezug auf Porters Wettbewerbsstrategie. Es erläutert verschiedene Formen von Mass Customization, deren Prinzipien und die Abgrenzung zur klassischen Wertschöpfungskette sowie anderen kundenorientierten Produktionsmethoden. Die Herausforderungen (interne und externe Komplexitäten) werden dargelegt, um die Basis für die Analyse der Chancen und Risiken in Kapitel 3 zu schaffen. Es werden verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten beleuchtet.
3. Chancen & Risiken: Dieser Hauptteil der Arbeit deckt die Chancen und Risiken von Mass Customization aus Unternehmens- und Kundensicht auf. Es werden Potentiale, Anforderungen und Herausforderungen analysiert, unterstützt durch Praxisbeispiele. Der Kostenverlauf bei der Umstellung von klassischer Massenproduktion zu kundenindividueller Massenproduktion wird dargestellt.
4. Wertschöpfungskette - Ergänzungen und seine Risiken: Aufbauend auf den in Kapitel 3 ermittelten Chancen und Risiken wird in diesem Kapitel die Wertschöpfungskette im Kontext von Mass Customization genauer betrachtet und Risiken analysiert.
Schlüsselwörter
Mass Customization, kundenindividuelle Massenfertigung, Individualisierungstrend, Wettbewerbsstrategie, Wertschöpfungskette, Chancen, Risiken, Fordismus, Kostenverlauf, Kundenorientierung, Praxisbeispiele, Porsche AG, Mymuesli.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Mass Customization
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Chancen und Risiken von Mass Customization (kundenindividueller Massenfertigung) für Unternehmen. Sie analysiert die Erfolgsfaktoren, Grenzen und Herausforderungen dieser Strategie und beleuchtet diese anhand von Praxisbeispielen. Ein Schwerpunkt liegt auf den wirtschaftlichen Folgen von Mass Customization und der Minimierung von Kundenunsicherheiten.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung vom Fordismus zur Individualisierung, Chancen und Risiken von Mass Customization aus Unternehmens- und Kundensicht, die Analyse der Wertschöpfungskette im Kontext von Mass Customization, den Kostenverlauf bei der Umstellung auf Mass Customization und die Wettbewerbsvorteile durch Mass Customization.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (Problemstellung und Zielsetzung, Gang der Untersuchung), Individualisierungstrend (Strategiekombination, Herausforderungen, Abgrenzung zu anderen Fertigungsmethoden, Umsetzungsmöglichkeiten), Chancen & Risiken (aus Unternehmens- und Kundensicht, Kostenverlauf), Wertschöpfungskette - Ergänzungen und seine Risiken und Zusammenfassung & Zukunftsausblick.
Was ist die Zielsetzung der Seminararbeit?
Die Zielsetzung ist es, die Erfolgsfaktoren und Risiken von Mass Customization aufzuzeigen und anhand von Praxisbeispielen zu beleuchten. Die Arbeit beantwortet die Frage nach den wirtschaftlichen Folgen von Mass Customization und der Möglichkeit, Kundenunsicherheiten zu minimieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Mass Customization, kundenindividuelle Massenfertigung, Individualisierungstrend, Wettbewerbsstrategie, Wertschöpfungskette, Chancen, Risiken, Fordismus, Kostenverlauf, Kundenorientierung, Praxisbeispiele, Porsche AG, Mymuesli.
Wie wird der Individualisierungstrend in der Arbeit behandelt?
Das Kapitel zum Individualisierungstrend beschreibt die Entwicklung vom Fordismus zur Individualisierung, erläutert verschiedene Formen von Mass Customization und deren Prinzipien, grenzt diese von der klassischen Wertschöpfungskette und anderen Produktionsmethoden ab und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen (interne und externe Komplexitäten).
Wie werden Chancen und Risiken von Mass Customization betrachtet?
Die Chancen und Risiken werden aus Unternehmens- und Kundensicht analysiert. Der Abschnitt beinhaltet die Darstellung von Potentialen, Anforderungen und Herausforderungen, unterstützt durch Praxisbeispiele. Der Kostenverlauf bei der Umstellung auf Mass Customization wird ebenfalls dargestellt.
Wie wird die Wertschöpfungskette im Kontext von Mass Customization behandelt?
Aufbauend auf den in Kapitel 3 ermittelten Chancen und Risiken wird die Wertschöpfungskette im Kontext von Mass Customization genauer betrachtet und die damit verbundenen Risiken analysiert.
- Quote paper
- Omid Asgari (Author), 2018, Mass Customization. Welche Chancen und Risiken gibt es für Unternehmen und Kunden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455082