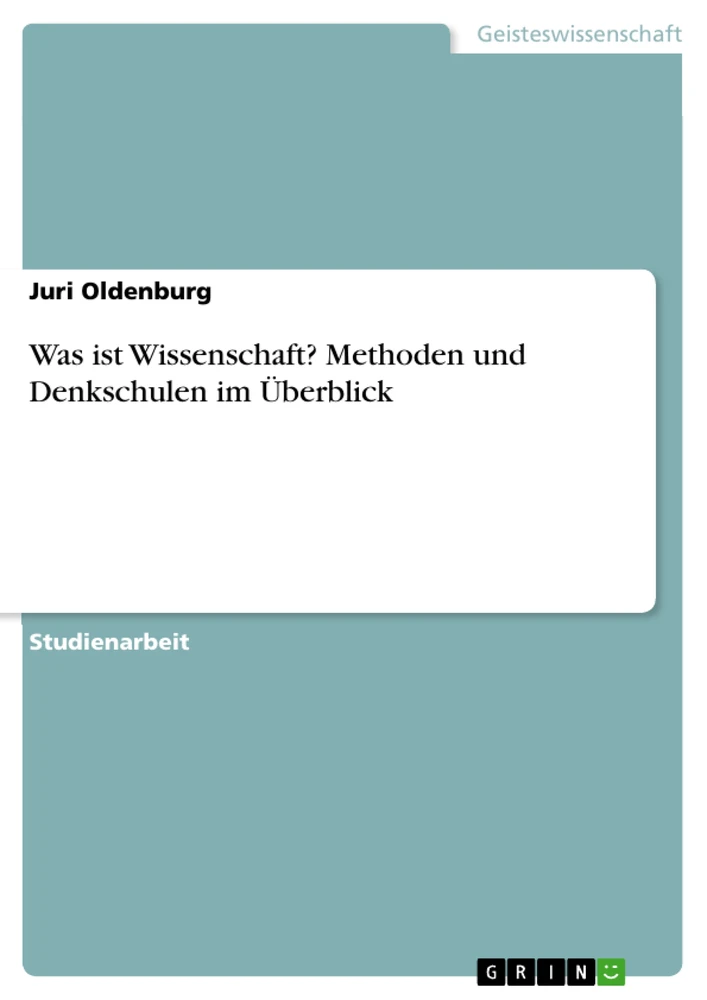Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage „Was ist Wissenschaft?“. Auch wenn es dem Leser einiges an Spannung nimmt, eine klare Antwort auf diese so unscheinbare Frage gibt es bis heute noch nicht. Doch wie ist das möglich? Um das zu verstehen, wird die vorliegende Arbeit versuchen etwas mehr Licht auf das Thema zu werfen.
Dazu wird die vorhandene Literatur gesichtet. Zu Beginn wird versucht den Begriff der „Wissenschaft“ zu definieren. Darüber hinaus wird unter anderem das Wesen der Wissenschaft betrachtet und erläutert, wieso es nicht „die eine Wissenschaft“ gibt. Es wird auf die beiden Denkschulen, die zum Positivismusstreit geführt haben näher eingegangen. Zusätzlich werden auch einige Grenzen, die im Bereich der Wissenschaft liegen dargestellt. Abschließend wird ein Ausblick über die möglichen Entwicklungen im Bereich der Wissenschaft gegeben. Anzumerken sei noch, dass bei der Fülle an Literatur, die zu diesem Thema vorhanden ist, es noch nicht einmal ansatzweise möglich ist, alle vorliegenden Ansätze dabei zu berücksichtigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abbildungsverzeichnis
- 1 Problemstellung – Was ist Wissenschaft?
- 1.1 Definition: Wissenschaft
- 1.2 Wissen – Das was wir meinen zu glauben?
- 2 Das Wesen der Wissenschaft
- 2.1 Einteilung der Wissenschaften
- 2.2 Methoden der Wissenschaft
- 2.2.1 Quantitative Methoden
- 2.2.2 Qualitative Methoden
- 3 Denkschulen der Wissenschaft
- 3.1 Kritischer Rationalismus von Karl Popper
- 3.2 Kritische Theorie der Frankfurter Schule
- 3.3 Positivismusstreit
- 4 Wissenschaftsstreit
- 5 Grenzen der Wissenschaft – Was können wir wissen?
- 6 Fazit und Ausblick
- III. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der grundlegenden Frage „Was ist Wissenschaft?“. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen und Ansätze, die in der Vergangenheit und bis heute existieren, sowie die zentralen Merkmale und Herausforderungen der wissenschaftlichen Forschung. Die Arbeit analysiert das Wesen der Wissenschaft, ihre verschiedenen Disziplinen und Methoden, und zeigt auf, wie Denkschulen und wissenschaftliche Streitigkeiten die Entwicklung des Wissens beeinflussen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Wissenschaft“
- Das Wesen der Wissenschaft, inklusive ihrer Kriterien und Ansprüche
- Die Einteilung der Wissenschaften und die unterschiedlichen Methoden
- Einfluss von Denkschulen und wissenschaftlichen Streitigkeiten auf das Erkenntnisgewinn
- Die Grenzen der Wissenschaft und das Verhältnis von Wissen und Nichtwissen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Definition von „Wissenschaft“ und zeigt auf, dass eine eindeutige Festlegung bis heute schwierig ist. Kapitel 2 analysiert das Wesen der Wissenschaft, ihre methodischen Ansprüche und die Einteilung in verschiedene Disziplinen. Kapitel 3 beleuchtet Denkschulen wie den Kritischen Rationalismus und die Kritische Theorie der Frankfurter Schule sowie den Positivismusstreit, der sich aus ihren unterschiedlichen Ansätzen ergab. Kapitel 4 untersucht den aktuellen Streit über die Genschere CRISPR-Cas9, der ethische und gesellschaftliche Fragen aufwirft. Kapitel 5 befasst sich mit den Grenzen der Wissenschaft, dem Verhältnis von Wissen und Nichtwissen sowie dem fortschreitenden Wissenshorizont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen wie: Wissenschaft, Wissen, Erkenntnisgewinnung, wissenschaftliche Methode, Objektivität, Reliabilität, Validität, Denkschulen, Positivismusstreit, Genschere, CRISPR-Cas9, Wissenshorizont, Nichtwissen.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine eindeutige Definition für den Begriff "Wissenschaft"?
Nein, eine allgemeingültige Definition existiert bis heute nicht, da verschiedene Denkschulen und Disziplinen unterschiedliche Ansprüche an Erkenntnisgewinn und Methodik stellen.
Was war der sogenannte "Positivismusstreit"?
Ein Konflikt zwischen dem Kritischen Rationalismus (Popper) und der Kritischen Theorie (Adorno/Habermas) über die richtige Methodik und die gesellschaftliche Rolle der Sozialwissenschaften.
Was ist der Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Methoden?
Quantitative Methoden setzen auf Messbarkeit und Statistik, während qualitative Methoden darauf abzielen, tiefere Sinnzusammenhänge und individuelle Perspektiven zu verstehen.
Was besagt der Kritische Rationalismus von Karl Popper?
Er besagt, dass wissenschaftliche Theorien niemals endgültig bewiesen, sondern nur durch Falsifikation (Widerlegung) überprüft werden können.
Welche Kriterien kennzeichnen wissenschaftliches Arbeiten?
Zentrale Kriterien sind Objektivität (Unabhängigkeit), Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Validität (Gültigkeit der Messung).
- Quote paper
- Juri Oldenburg (Author), 2018, Was ist Wissenschaft? Methoden und Denkschulen im Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455088