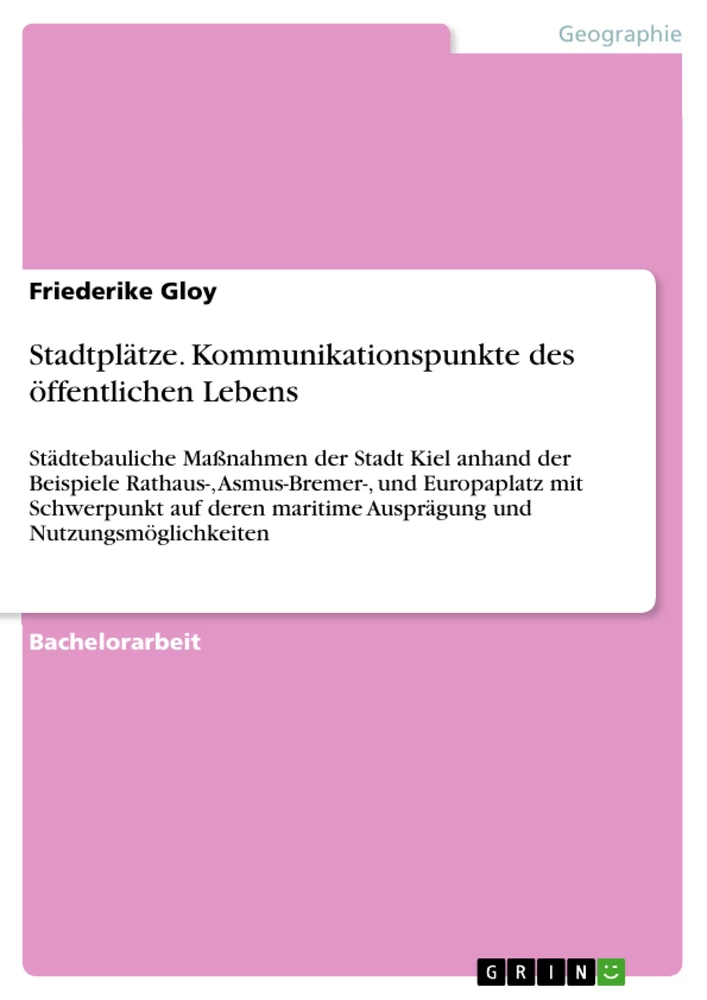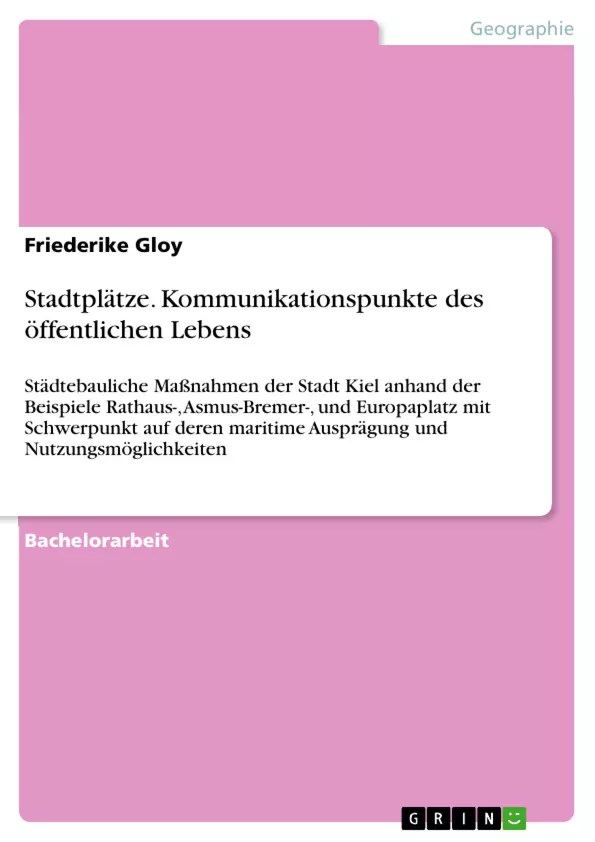Die Frage, inwiefern die Stadt Kiel versucht dem beschriebenen „Platzflucht-Verhalten“ entgegenzuwirken, soll im Folgenden anhand der Beispiele Rathaus-, Asmus-Bremer- und Europaplatz analytisch untersucht und erörtert werden. Aktuell wird im Gestaltungsrahmen des Stadtbauamtes Kiel über eine Ausbildung der „Platztriangel“, die sich aus diesen Plätzen bildet, sowie über eine Optimierung dieser diskutiert.
„In jüngster Zeit ist eine nervöse Krankheit konstatiert worden: die ,Platzscheu’“, stellte Camillo Sitte bereits 1909 fest. Er beschreibt das Unbehagen, welches manche Menschen beim Betreten und Überqueren großer, leerer Plätze empfinden. Schon zu damaliger Zeit bemängelte er, dass sich das Leben zunehmend in geschlossenen Räumen abspiele und weniger auf der Straße, im öffentlichen Raum und eben auf Stadtplätzen.
Und heute? Den häufig menschenleeren Freiräumen vor Repräsentationsbauten nach zu urteilen hat auch uns die „Platzscheu“ erfasst. Man unterscheidet heutzutage zwischen mehreren Arten von Plätzen, welche für Märkte, zum Parken oder oft lediglich als Vorplätze wichtiger Bauten dienen und somit zur Abkürzung für Fußgänger werden, die von A nach B gelangen, aber sicher nicht auf einem solchen Präsentierteller auch noch verweilen möchten. Eine ständig wechselnde „Bespielung“ gibt es kaum noch. Marktsituationen müssen nicht mehr unmittelbar in den Stadtraum integriert sein, lieber werden diese in den Außenraum verlagert (Citti-Park) und dort dankend angenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Analyse der Stadtplätze und Erörterung der herausgearbeiteten Schwerpunkte
- Rathausplatz
- Raumanalyse
- Verschiebung des Schwerpunkts?
- Asmus-Bremer-Platz
- Raumanalyse
- Maritime Zeichen
- Europaplatz
- Raumanalyse
- Gefäß der Möglichkeiten oder Einschränkung dieser?
- Braucht Kiel also einen solch omnipotenten Platz gar nicht?
- In Bewegung bleiben
- Rathausplatz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie die Stadt Kiel dem Phänomen der „Platzscheu“ entgegenwirkt. Anhand der Beispiele Rathausplatz, Asmus-Bremer-Platz und Europaplatz wird analysiert, wie städtebauliche Maßnahmen die Nutzung und die maritime Ausprägung dieser Plätze beeinflussen.
- Analyse der räumlichen Gestaltung von Stadtplätzen in Kiel
- Bewertung der Funktionalität und Nutzung der ausgewählten Plätze
- Untersuchung der maritimen Einflüsse auf die Gestaltung und Nutzung
- Erörterung der städtebaulichen Strategien zur Belebung der Plätze
- Diskussion über die zukünftige Entwicklung und Optimierung der Plätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Worte: Die Einleitung stellt das Problem der „Platzscheu“ vor, ein Phänomen, das bereits Camillo Sitte 1909 beobachtete. Sie beschreibt die zunehmende Verlagerung des öffentlichen Lebens in geschlossene Räume und die Herausforderung für Städte, attraktive und frequentierte öffentliche Plätze zu schaffen. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse von drei Plätzen in Kiel und deren Bemühungen, diesem Trend entgegenzuwirken, im Kontext des aktuellen Gestaltungsrahmens des Stadtbauamtes Kiel.
Analyse der Stadtplätze und Erörterung der herausgearbeiteten Schwerpunkte: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des Rathausplatzes, des Asmus-Bremer-Platzes und des Europaplatzes in Kiel. Es untersucht die Raumanalyse jedes Platzes, einschließlich der Architektur der umliegenden Gebäude, ihrer Anordnung und des Einflusses auf die Platzgestaltung. Es werden die maritimen Aspekte und die jeweiligen Nutzungsmöglichkeiten jedes Platzes erörtert, unter Berücksichtigung historischer und aktueller Entwicklungen. Der Fokus liegt auf der Erarbeitung von Schwerpunkten, die sich durch die Analyse der einzelnen Plätze ergeben und in Bezug auf die übergeordnete Fragestellung der „Platzscheu“ und städtebauliche Strategien in Kiel diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Platzscheu, Stadtplätze, Kiel, Rathausplatz, Asmus-Bremer-Platz, Europaplatz, Raumanalyse, Maritime Ausprägung, Städtebau, Stadtentwicklung, Nutzungsmöglichkeiten, Gestaltungsrahmen, Öffentlicher Raum.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Stadtplätze in Kiel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert, wie die Stadt Kiel dem Phänomen der „Platzscheu“ entgegenwirkt. Sie untersucht anhand der Beispiele Rathausplatz, Asmus-Bremer-Platz und Europaplatz, wie städtebauliche Maßnahmen die Nutzung und die maritime Ausprägung dieser Plätze beeinflussen.
Welche Plätze werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf drei zentrale Plätze in Kiel: den Rathausplatz, den Asmus-Bremer-Platz und den Europaplatz.
Welche Aspekte der Plätze werden analysiert?
Die Analyse umfasst die räumliche Gestaltung, die Funktionalität und Nutzung, die maritimen Einflüsse auf Gestaltung und Nutzung, die städtebaulichen Strategien zur Belebung und die zukünftige Entwicklung und Optimierung der Plätze.
Was ist „Platzscheu“?
„Platzscheu“ beschreibt ein Phänomen, das bereits Camillo Sitte 1909 beobachtete: die zunehmende Verlagerung des öffentlichen Lebens in geschlossene Räume und die damit verbundene Herausforderung für Städte, attraktive und frequentierte öffentliche Plätze zu schaffen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Analyse der drei ausgewählten Plätze mit Raumanalysen und Erörterung der jeweiligen Schwerpunkte, und ein Fazit. Zusätzlich werden die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse des Rathausplatzes?
Die Analyse des Rathausplatzes beinhaltet eine Raumanalyse und die Erörterung einer möglichen Verschiebung des Schwerpunktes. Konkrete Ergebnisse sind im Detail in der Arbeit beschrieben.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse des Asmus-Bremer-Platzes?
Die Analyse des Asmus-Bremer-Platzes beinhaltet eine Raumanalyse und die Erörterung maritimer Zeichen. Konkrete Ergebnisse sind im Detail in der Arbeit beschrieben.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse des Europaplatzes?
Die Analyse des Europaplatzes beinhaltet eine Raumanalyse und die Erörterung der Frage, ob der Platz als „Gefäß der Möglichkeiten“ oder als Einschränkung dieser funktioniert. Es wird auch die Frage diskutiert, ob Kiel einen solch omnipotenten Platz überhaupt braucht und wie die Dynamik des Platzes aufrechterhalten werden kann. Konkrete Ergebnisse sind im Detail in der Arbeit beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Platzscheu, Stadtplätze, Kiel, Rathausplatz, Asmus-Bremer-Platz, Europaplatz, Raumanalyse, Maritime Ausprägung, Städtebau, Stadtentwicklung, Nutzungsmöglichkeiten, Gestaltungsrahmen, Öffentlicher Raum.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die räumliche Gestaltung von Stadtplätzen in Kiel, bewertet deren Funktionalität und Nutzung, untersucht maritime Einflüsse, erörtert städtebauliche Strategien zur Belebung und diskutiert die zukünftige Entwicklung und Optimierung der Plätze.
- Citar trabajo
- Friederike Gloy (Autor), 2010, Stadtplätze. Kommunikationspunkte des öffentlichen Lebens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455114