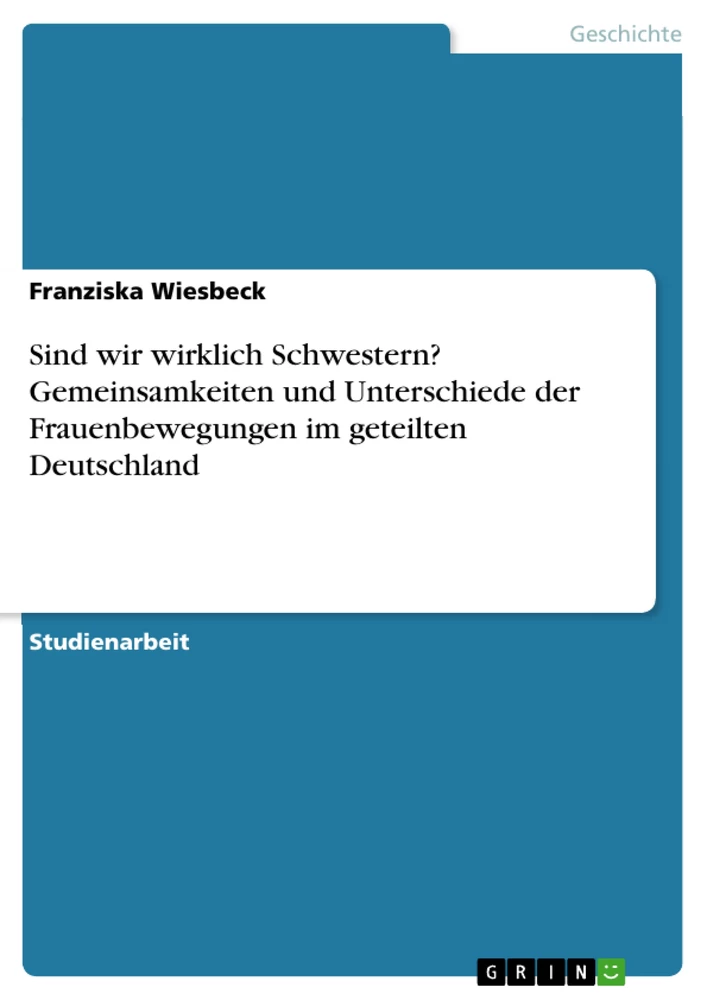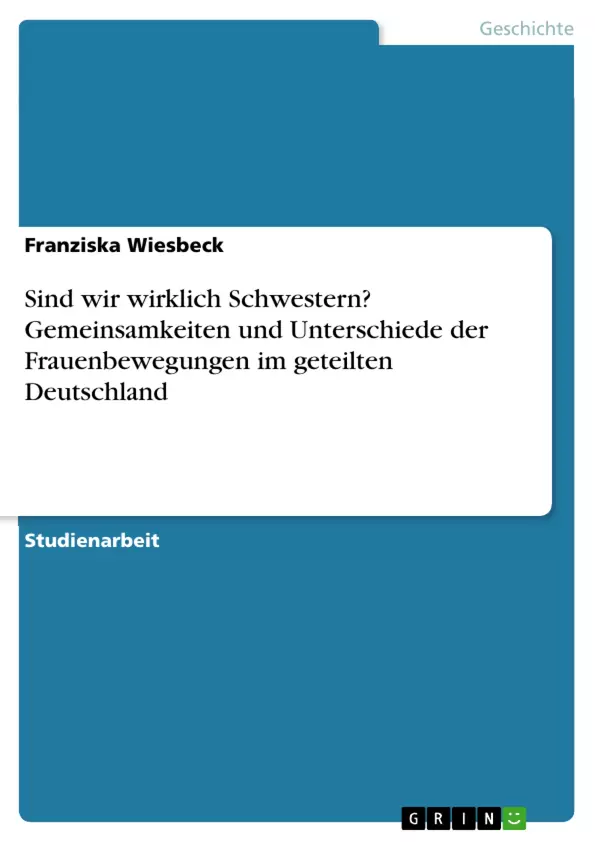Diese Arbeit befasst sich mit der zweiten Welle der Frauenbewegung, die ihren Beginn im Deutschland der 60er Jahre hatte. In beiden Teilen Deutschlands begannen die Frauen sich für ihre Rechte stark zu machen, einmal in der demokratischen Bundesrepublik, zum anderen in der sozialistischen Diktatur der DDR.
Im Folgenden werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Bewegungen herausgearbeitet, die am Beispiel der beiden Feministinnen Alice Schwarzer (BRD) und Irmtraud Morgner (DDR) verdeutlicht werden. Zudem liegt das Augenmerk auf der Frage, inwieweit der Staat, in dem eine Bewegung agiert, Einfluss auf diese hat und sie teilweise auch mitformt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Was ist eigentlich Feminismus? Eine kleine Einführung inklusive Literaturüberblick
- 2. Frauenbewegung in Ost und West – ein Vergleich
- 2.1 Die Lage der Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2.1.1 In Westdeutschland
- 2.1.2 In Ostdeutschland
- 2.2 Die Entwicklung der Frauenbewegung von 1968 bis 1990
- 2.2.1 In Westdeutschland
- 2.2.2 In Ostdeutschland
- 2.3 Lauter Protest gegen leise Literatur – ein Vergleich der Autorinnen Alice Schwarzer und Irmtraud Morgner
- 2.3.1 Biographien beider
- 2.3.2 Werk und Beziehung zum Staat und zur Öffentlichkeit
- 2.4 Wenn man Verstärkung erwartet und nur neue Probleme erntet – die Probleme beider Frauenbewegungen nach der Wende 1989
- 3. Frauenpolitik als Propagandamittel des Kalten Krieges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der zweiten Welle der Frauenbewegung in Ost- und Westdeutschland, untersucht deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede und beleuchtet den Einfluss des jeweiligen Staates auf die Bewegungen. Die Arbeit fokussiert auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und vergleicht die Entwicklungen bis zum Fall der Mauer 1989. Darüber hinaus wird der Einfluss der beiden prominenten Autorinnen Alice Schwarzer (BRD) und Irmtraud Morgner (DDR) auf die Frauenbewegung in ihren jeweiligen Gesellschaften analysiert.
- Vergleich der Frauenbewegungen in Ost- und Westdeutschland
- Die Lage der Frauen in Ost- und Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Entwicklung der Frauenbewegungen in Ost- und Westdeutschland von 1968 bis 1990
- Der Einfluss des Staates auf die Frauenbewegungen
- Der Vergleich der beiden Autorinnen Alice Schwarzer und Irmtraud Morgner
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in den Begriff „Feminismus“ und liefert einen Überblick über die erste Welle der Frauenbewegung, um den Kontext der zweiten Welle, die im Mittelpunkt der Arbeit steht, zu verstehen. Die Arbeit fokussiert auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der die Frauen in Ost- und Westdeutschland ähnliche Herausforderungen, aber auch unterschiedliche Entwicklungen durchlebten. Kapitel zwei vergleicht die Situation der Frauen in beiden Teilen Deutschlands nach dem Krieg. Dabei werden die Auswirkungen der Nachkriegszeit, die politische und gesellschaftliche Situation und die Rolle des Staates in Bezug auf die Frauenarbeit analysiert. Kapitel drei untersucht die Entwicklung der Frauenbewegung in Ost- und Westdeutschland von 1968 bis 1990, beleuchtet die verschiedenen Ziele und Methoden der Bewegungen und untersucht den Einfluss des Staates auf die Bewegungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Feminismus, Frauenbewegung, Ost-West Beziehungen, Kalter Krieg, Deutschland, Gleichstellung, Geschichte, Politik, Kultur, Alice Schwarzer, Irmtraud Morgner, DDR, BRD.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet die Frauenbewegung in der BRD von der in der DDR?
In der BRD agierte die Bewegung in einer Demokratie mit lautem Protest, während sie in der DDR innerhalb einer sozialistischen Diktatur oft subtiler und über Literatur stattfand.
Wer sind Alice Schwarzer und Irmtraud Morgner?
Alice Schwarzer ist die bekannteste Feministin der BRD, Irmtraud Morgner war eine bedeutende Schriftstellerin in der DDR, die feministische Themen literarisch verarbeitete.
Welche Rolle spielte der Staat für die Frauenbewegungen?
In der DDR war Frauenemanzipation staatlich verordnet (Arbeitsmarktintegration), während sie in der BRD gegen staatliche Strukturen erkämpft werden musste.
Was geschah mit den Bewegungen nach der Wende 1989?
Nach 1989 trafen zwei unterschiedliche Konzepte von Weiblichkeit aufeinander, was zu neuen Problemen und Missverständnissen zwischen Ost- und West-Feministinnen führte.
Inwiefern war Frauenpolitik ein Mittel des Kalten Krieges?
Beide deutsche Staaten nutzten den Status der Frau, um die Überlegenheit ihres jeweiligen politischen Systems (Kapitalismus vs. Sozialismus) zu demonstrieren.
- Quote paper
- Franziska Wiesbeck (Author), 2010, Sind wir wirklich Schwestern? Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Frauenbewegungen im geteilten Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455262