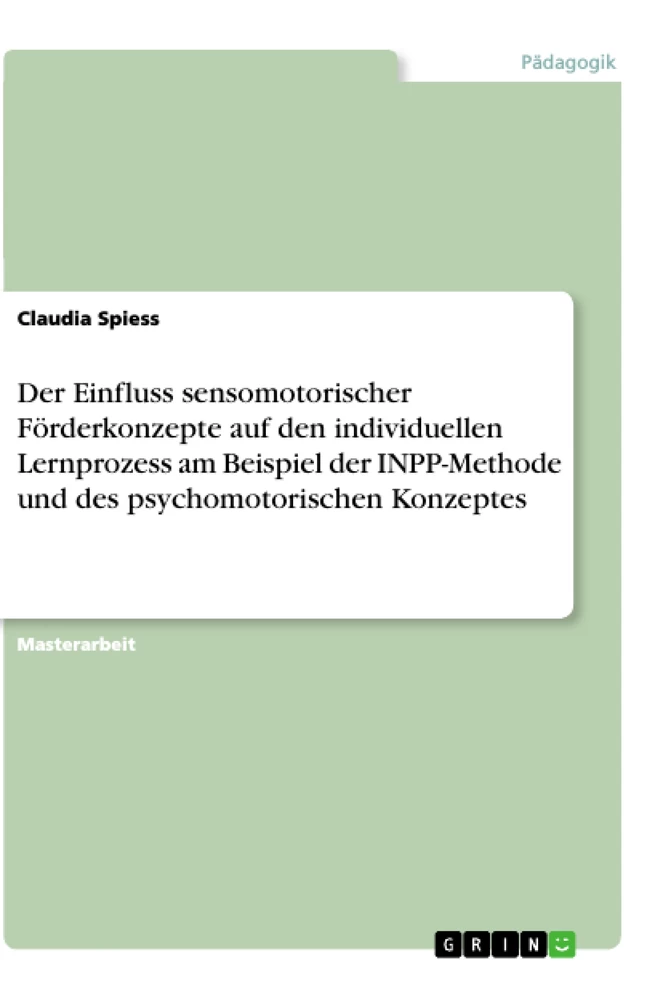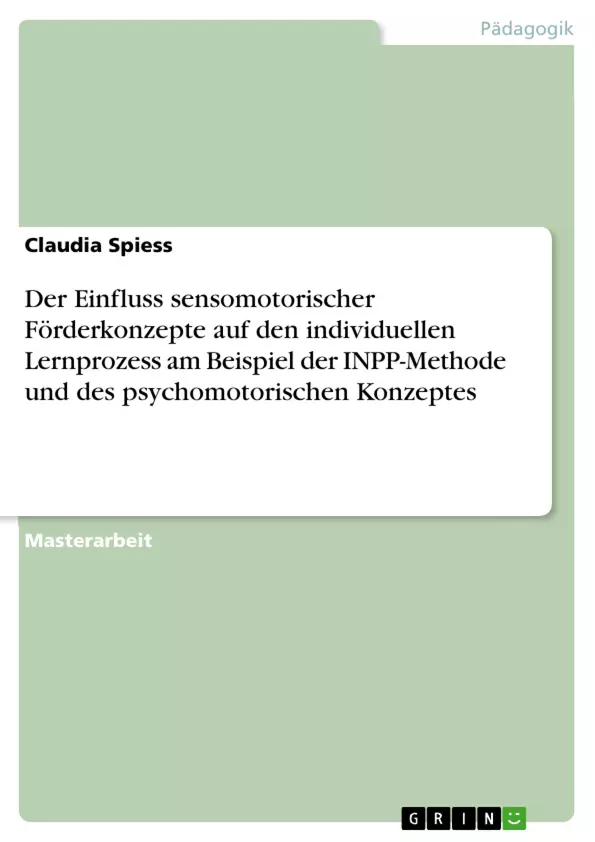In dieser Arbeit sollen zwei recht konträr anmutende Behandlungskonzepte untersucht werden: Das psychomotorische Konzept sowie die Methode des Instituts für neurophysiologische Psychologie (INPP). Diese Arbeit soll von der Frage geleitet werden, wie sich die beiden Behandlungsansätze im Hinblick auf die Förderung individueller Lernprozesse positionieren.
Um den Ablauf sensomotorischer Prozesse nachvollziehbar zu machen, erfolgt zunächst die Darstellung relevanter neurophysiologischer Grundlagen, indem der Aufbau des Nervensystems, die Funktion der Sinnesorgane sowie abschließend das sensomotorische Zusammenwirken erörtert wird. Im nächsten Kapitel werden neurophysiologische Grundlagen des Lernvorgangs dargestellt und es wird der Begriff „Lernen“ aus kognitiv-konstruktivistischer Perspektive erläutert. Darauf aufbauend wird ein Lernmodell vorgestellt, das individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens aufzeigt, um den schulischen Lernprozess als Teil der Bezugsgrundlage für die Analyse der Förderkonzepte darzulegen. In einem kurzen Exkurs wird die Schwierigkeit einer prägnanten Definition und Klassifikation des vielschichtigen Phänomens „Lernstörung“ aufgezeigt, da die Zuweisung der „Ressource Förderung“ zumeist auf der Basis einer festgeschriebenen Symptomatik beruht. In einem nächsten Schritt werden das Förderkonzept nach der INPP-Methode sowie das Psychomotorik-Konzept vorgestellt, wobei zunächst auf theoretische Grundlagen eingegangen wird, um in einem nächsten Schritt das Behandlungskonzept zu erörtern. In einer vergleichenden Analyse erfolgt daraufhin die differenzierte Betrachtung der Konzepte mit dem Ziel, den jeweiligen Einfluss auf den individuellen Lernprozess herauszustellen. In der abschließenden Diskussion werden die erarbeiteten Ergebnisse kritisch betrachtet und es wird ein Bezug zur sonderpädagogischen Förderpraxis hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stand der Forschung
- Methodisches Vorgehen
- Neurophysiologische Grundlagen
- Aufbau des Nervensystems
- Sinneswahrnehmungen
- Sensomotorisches Zusammenwirken
- Lernen
- Neurophysiologische Prozesse
- Der Lernvorgang aus kognitiv-konstruktivistischer Perspektive
- Schlussfolgerung: Definition von Lernen
- Komponenten des individuellen Lernprozesses: Das INVO-Model
- Exkurs: Lernstörungen
- Definition
- Klassifikation
- Ursachen
- Bedeutung für die Praxis
- Darstellung der Förderkonzepte
- Institut für neurophysiologische Psychologie (INPP)
- Psychomotorik
- Vergleich der Konzepte
- Diskussion
- Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht den Einfluss sensomotorischer Förderkonzepte auf den individuellen Lernprozess. Im Mittelpunkt stehen die INPP-Methode und das psychomotorische Konzept. Die Arbeit analysiert die neurophysiologischen Grundlagen des sensomotorischen Zusammenspiels und deren Bedeutung für den Lernprozess, beleuchtet verschiedene Lernstörungen und deren Ursachen, und vergleicht die beiden Förderkonzepte hinsichtlich ihrer theoretischen Ansätze und praktischen Anwendung.
- Neurophysiologische Grundlagen des Lernens
- Zusammenhang zwischen sensomotorischen Fähigkeiten und Lernprozessen
- Vergleich der INPP-Methode und des psychomotorischen Konzepts
- Analyse von Lernstörungen und deren Ursachen
- Bewertung der Wirksamkeit sensomotorischer Förderkonzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Zusammenhang zwischen sensomotorischen Kompetenzen und schulischem Lernverhalten. Sie verdeutlicht die Relevanz der Arbeit, indem sie auf die KMK-Empfehlungen zum Förderschwerpunkt Lernen verweist, die den Zusammenhang zwischen sensomotorischen Defiziten und Beeinträchtigungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen hervorheben. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, den Einfluss sensomotorischer Förderkonzepte auf den individuellen Lernprozess zu untersuchen.
Stand der Forschung: (Kapitelzusammenfassung fehlt in der Vorlage)
Methodisches Vorgehen: (Kapitelzusammenfassung fehlt in der Vorlage)
Neurophysiologische Grundlagen: Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des Nervensystems, beginnend mit der neuronalen Ebene (Neuron, Gliazellen) über das periphere und zentrale Nervensystem bis hin zum vegetativen Nervensystem. Es erläutert die verschiedenen Sinneswahrnehmungen (Sehen, Hören, Berührung, Gleichgewicht, Propriozeption) und deren sensomotorisches Zusammenwirken, als Grundlage für das Verständnis der Lernprozesse. Die detaillierte Darstellung der neuronalen Strukturen und Funktionen bildet die Basis für die spätere Analyse der Förderkonzepte.
Lernen: Dieses Kapitel behandelt den Lernvorgang aus neurophysiologischer und kognitiv-konstruktivistischer Perspektive. Es beschreibt neurophysiologische Prozesse wie Synaptogenese und neuronale Plastizität und erläutert das INVO-Modell, welches die Komponenten des individuellen Lernprozesses (selektive Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Vorwissen, Lernstrategien, Motivation, Volition und Emotionen) beschreibt. Die verschiedenen Aspekte des Lernens werden detailliert analysiert, um später den Einfluss sensomotorischer Förderung besser zu verstehen.
Exkurs: Lernstörungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition, Klassifikation und den Ursachen von Lernstörungen. Es beleuchtet die Bedeutung dieses Themenkomplexes für die Praxis und liefert damit den Kontext für die spätere Analyse der Förderkonzepte. Die unterschiedlichen Aspekte von Lernstörungen werden detailliert erörtert, um die Relevanz der sensomotorischen Förderung im Umgang mit diesen Schwierigkeiten zu verdeutlichen.
Darstellung der Förderkonzepte: Dieses Kapitel beschreibt die INPP-Methode und das psychomotorische Konzept. Für jedes Konzept werden die theoretischen Grundlagen, das Behandlungskonzept (inkl. Ausbildung der Therapeuten, diagnostischer Prozess und Interventionen) detailliert dargestellt. Die Gegenüberstellung der beiden Konzepte ermöglicht einen späteren Vergleich.
Vergleich der Konzepte: (Kapitelzusammenfassung fehlt in der Vorlage)
Diskussion: (Kapitelzusammenfassung fehlt in der Vorlage)
Schlüsselwörter
Sensomotorik, Lernprozess, INPP-Methode, Psychomotorik, Lernstörungen, Neurophysiologie, Kognitive Entwicklung, Förderkonzepte, Neuronale Plastizität, Individuelle Förderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Einfluss sensomotorischer Förderkonzepte auf den individuellen Lernprozess
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht den Einfluss von sensomotorischen Förderkonzept auf den individuellen Lernprozess. Im Fokus stehen die INPP-Methode und das psychomotorische Konzept. Analysiert werden die neurophysiologischen Grundlagen des sensomotorischen Zusammenspiels und deren Bedeutung für das Lernen, verschiedene Lernstörungen und deren Ursachen, sowie ein Vergleich der beiden Förderkonzepte hinsichtlich ihrer theoretischen Ansätze und praktischen Anwendung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Neurophysiologische Grundlagen des Lernens, den Zusammenhang zwischen sensomotorischen Fähigkeiten und Lernprozessen, einen Vergleich der INPP-Methode und des psychomotorischen Konzepts, die Analyse von Lernstörungen und deren Ursachen, sowie die Bewertung der Wirksamkeit sensomotorischer Förderkonzepte. Die Arbeit beinhaltet auch eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus des Nervensystems, verschiedener Sinneswahrnehmungen und deren Zusammenspiel, sowie eine Erläuterung des Lernvorgangs aus neurophysiologischer und kognitiv-konstruktivistischer Sicht.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die genaue Methodik ist in der vorliegenden Vorschau nicht vollständig beschrieben. Die Zusammenfassung des Kapitels "Methodisches Vorgehen" fehlt. Jedoch wird deutlich, dass die Arbeit auf einer fundierten Analyse neurophysiologischer Grundlagen und bestehender Förderkonzepte basiert.
Welche Förderkonzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die INPP-Methode (Institut für neurophysiologische Psychologie) und das psychomotorische Konzept. Für jedes Konzept werden die theoretischen Grundlagen und das Behandlungskonzept (inkl. Ausbildung der Therapeuten, diagnostischer Prozess und Interventionen) detailliert dargestellt.
Welche Lernstörungen werden behandelt?
Das Kapitel "Exkurs: Lernstörungen" befasst sich mit der Definition, Klassifikation und den Ursachen von Lernstörungen. Die Bedeutung dieses Themas für die Praxis und die Relevanz der sensomotorischen Förderung im Umgang mit diesen Schwierigkeiten werden erörtert. Die konkreten Arten von Lernstörungen, die detailliert behandelt werden, sind in der Vorschau nicht explizit genannt.
Welche neurophysiologischen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt den Aufbau des Nervensystems von der neuronalen Ebene bis zum vegetativen Nervensystem. Es werden verschiedene Sinneswahrnehmungen (Sehen, Hören, Berührung, Gleichgewicht, Propriozeption) und deren sensomotorisches Zusammenwirken erläutert, um die Lernprozesse besser zu verstehen. Die detaillierte Darstellung neuronaler Strukturen und Funktionen bildet die Basis für die Analyse der Förderkonzepte.
Wie wird der Lernprozess definiert?
Der Lernprozess wird aus neurophysiologischer und kognitiv-konstruktivistischer Perspektive betrachtet. Neurophysiologische Prozesse wie Synaptogenese und neuronale Plastizität werden beschrieben. Das INVO-Modell, welches die Komponenten des individuellen Lernprozesses (selektive Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Vorwissen, Lernstrategien, Motivation, Volition und Emotionen) beschreibt, wird ebenfalls erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sensomotorik, Lernprozess, INPP-Methode, Psychomotorik, Lernstörungen, Neurophysiologie, Kognitive Entwicklung, Förderkonzepte, Neuronale Plastizität, Individuelle Förderung.
- Quote paper
- Claudia Spiess (Author), 2013, Der Einfluss sensomotorischer Förderkonzepte auf den individuellen Lernprozess am Beispiel der INPP-Methode und des psychomotorischen Konzeptes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455332