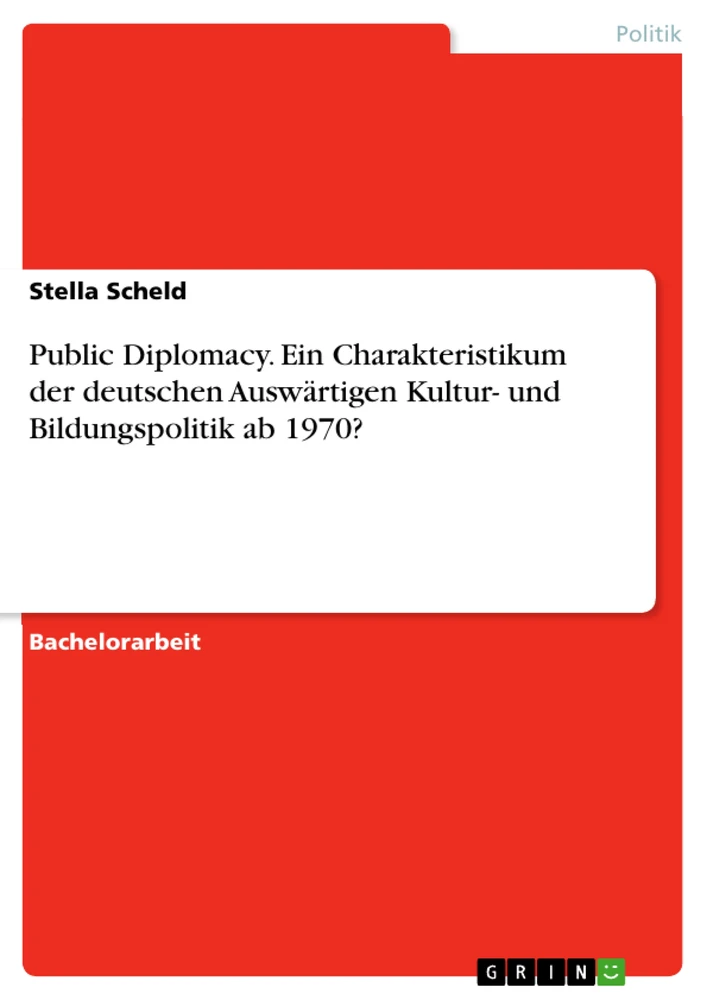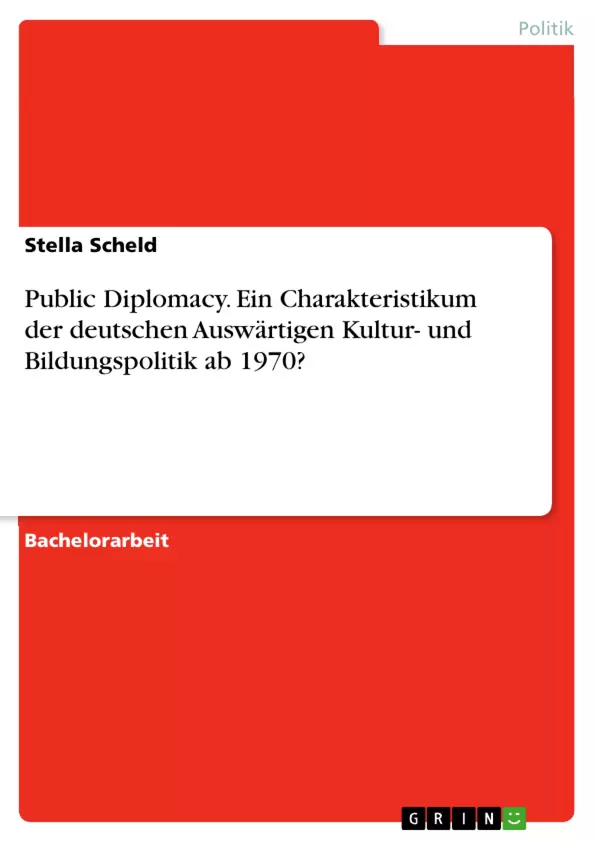"Auswärtige Kulturpolitik [...] gehört zum Fundament der Außenpolitik" - Aussagen wie die des ehemaligen Generalsekretärs des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa), Kurt-Jürgen Maaß (1998-2008), spiegeln den Wandel wider, den das Politikfeld der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in den letzten vierzig Jahren durchlaufen hat.
Diese Arbeit wird zunächst einen Überblick über die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik geben. Dazu gehören ihre Definition und Aufgaben, ihre historische Entwicklung und ihre Organisation in Deutschland. Im nächsten Kapitel werden die Theorien ausgeführt. Das sind zum einen die Verständnisse der „Public Diplomacy“ und die damit verbundene „Dachtheorie“ der „soft power“ nach Joseph Nye, die Begrifflichkeit des Nationenimages und die Strategien für eine erfolgreiche „Public Diplomacy“. Das nachfolgende Kapitel setzt sich mit der Analyse verschiedener auseinander. Ein Fazit fasst die zentralen Ergebnisse zusammen und formuliert weiterführende Forschungsfragen.
Die Auswahl der Quellen wurde auf drei Dokumente beschränkt: Die „Leitsätze für die auswärtige Kulturpolitik“ von 1970, die die erste konzeptionelle Grundlage der Bundesregierung bilden. Einen weiteren Meilenstein bildet die „Konzeption 2000“ durch ihre inhaltliche Neuausrichtung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Als letztes und aktuellstes Dokument veranschaulicht der „18. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 2013/14“ das „neue Gewicht“ dieses Politikfeldes. Die „Konzeption 2011“, die an die „Konzeption 2000“ anknüpft, ist - trotz ihres konzeptionellen Charakters - aufgrund ihrer fehlenden praktischen Auswirkungen nicht Bestandteil dieser Analyse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik
- 2.1 Definition und Aufgaben
- 2.2 Entstehung und Entwicklung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
- 2.2.1 Von der Entstehung bis 1945
- 2.2.2 Neubeginn nach 1945
- 2.2.2.1 Erste Phase: Nach dem zweiten Weltkrieg
- 2.2.2.2 Zweite Phase: Reformen in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
- 2.2.2.3 Dritte Phase: Nach der deutschen Einheit
- 2.2.2.4 Gegenwart: Konzeption 2000 und danach
- 2.2.3 Zwischenfazit
- 2.3 Organisation der deutschen Auswärtigen Kultur-und Bildungspolitik
- 2.3.1 Das Auswärtige Amt
- 2.3.2 Die Mittlerorganisationen und weitere beteiligte Akteure
- 3. Theorie
- 3.1 Einführung
- 3.2 „Soft power“ – „hard power“
- 3.3 „Public Diplomacy“
- 3.4 Image
- 3.5 Nationenimages
- 3.6 „Public Diplomacy“ Strategien
- 3.6.1 Glaubwürdigkeit
- 3.6.2 Ganzheitliche Ausrichtung
- 3.6.3 Netzwerk & Dialog
- 3.6.4 Langfristigkeit und Nachhaltigkeit
- 3.6.5 „Side attacks“
- 3.6.6 Staatsferne
- 4. Analyse
- 4.1 Einführung und Vorgehen
- 4.2 Analyse: „Leitsätze für die auswärtige Kulturpolitik“ von 1970
- 4.3 Analyse: „Konzeption 2000“
- 4.4 Analyse: „18. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 2013/14. Grenzen überbrücken – Werte teilen – Wissen schaffen – die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik in globaler Verantwortung“
- 4.5 Zwischenfazit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert die Entwicklung der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik seit 1970 anhand des Konzepts der „Public Diplomacy“. Die Arbeit befasst sich mit drei unterschiedlichen Verständnissen von „Public Diplomacy“ und untersucht, welches dieser Verständnisse der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in den Jahren 1970, 2000 und 2013/14 zugrunde lag.
- Entwicklung und Veränderung der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik seit 1970
- Theoretische Konzepte der „Public Diplomacy“
- Anwendung von „Public Diplomacy“ Strategien in der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
- Analyse von Schlüsseldokumenten der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
- Bedeutung von „Public Diplomacy“ für die deutsche Außenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand der Forschung zur deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sowie das Forschungsdefizit im Bereich der „Public Diplomacy“ beleuchtet. Es folgt eine umfassende Darstellung der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, einschließlich ihrer Definition, Aufgaben, historischen Entwicklung und Organisation.
Das nächste Kapitel widmet sich der theoretischen Einordnung des Konzepts der „Public Diplomacy“. Dabei werden verschiedene Verständnisse von „Public Diplomacy“ sowie die damit verbundenen „soft power“-Theorien von Joseph Nye und die Thematik des Nationenimages erläutert. Daraufhin werden zentrale Strategien für eine erfolgreiche „Public Diplomacy“ vorgestellt.
Im anschließenden Kapitel werden die „Leitsätze für die auswärtige Kulturpolitik“ von 1970, die „Konzeption 2000“ und der „18. Bericht der Bundesregierung zur Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik 2013/14“ analysiert, um die Anwendung der „Public Diplomacy“ Strategien in den verschiedenen Zeitpunkten zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, „Public Diplomacy“, „Soft Power“, Nationenimages, Glaubwürdigkeit, Ganzheitliche Ausrichtung, Netzwerk & Dialog, Langfristigkeit und Nachhaltigkeit, „Side attacks“, Staatsferne und qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Public Diplomacy?
Public Diplomacy bezeichnet die staatliche Kommunikation mit der ausländischen Öffentlichkeit, um das eigene Nationenimage positiv zu beeinflussen.
Welche Rolle spielt 'Soft Power' in der Außenpolitik?
Soft Power ist die Fähigkeit, Ziele durch Attraktivität und Überzeugung (Kultur, Werte) statt durch Zwang (Militär, Geld) zu erreichen.
Was sind die 'Leitsätze für die auswärtige Kulturpolitik' von 1970?
Sie bilden die erste konzeptionelle Grundlage der Bundesregierung für diesen Politikbereich.
Wie hat sich die Auswärtige Kulturpolitik seit 2000 verändert?
Es gab eine inhaltliche Neuausrichtung hin zu globaler Verantwortung, Dialog auf Augenhöhe und verstärkter Netzwerkbildung.
Welche Organisationen setzen Public Diplomacy in Deutschland um?
Primär das Auswärtige Amt sowie Mittlerorganisationen wie das Goethe-Institut oder der DAAD.
Was sind wichtige Strategien für erfolgreiche Public Diplomacy?
Glaubwürdigkeit, Langfristigkeit, Staatsferne und der Aufbau von nachhaltigen Dialognetzwerken.
- Citation du texte
- Stella Scheld (Auteur), 2018, Public Diplomacy. Ein Charakteristikum der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ab 1970?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455365