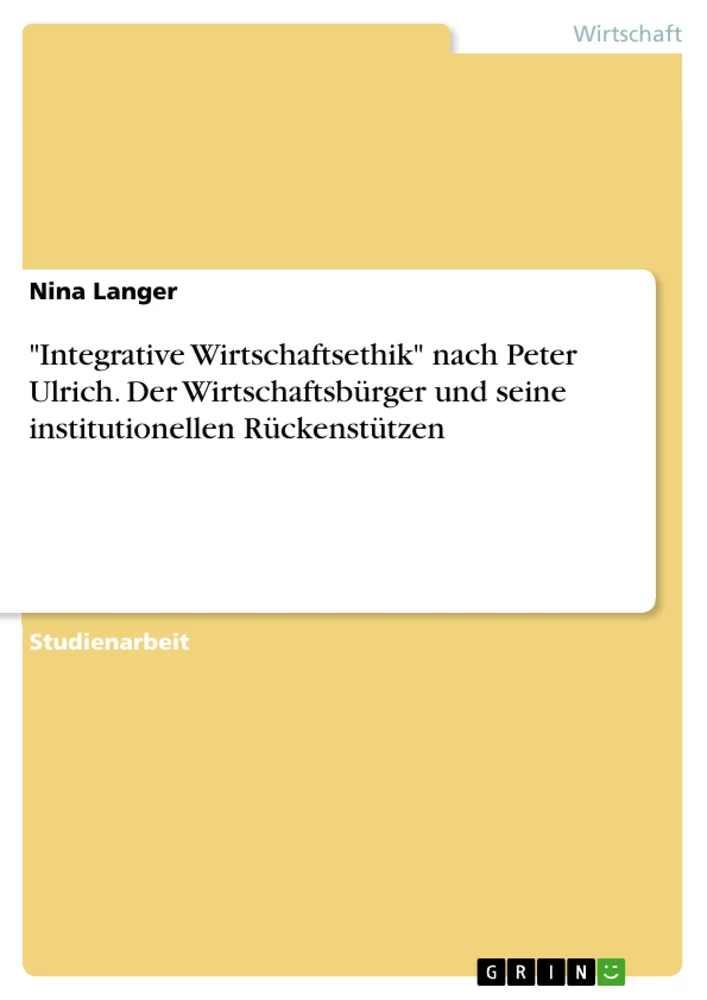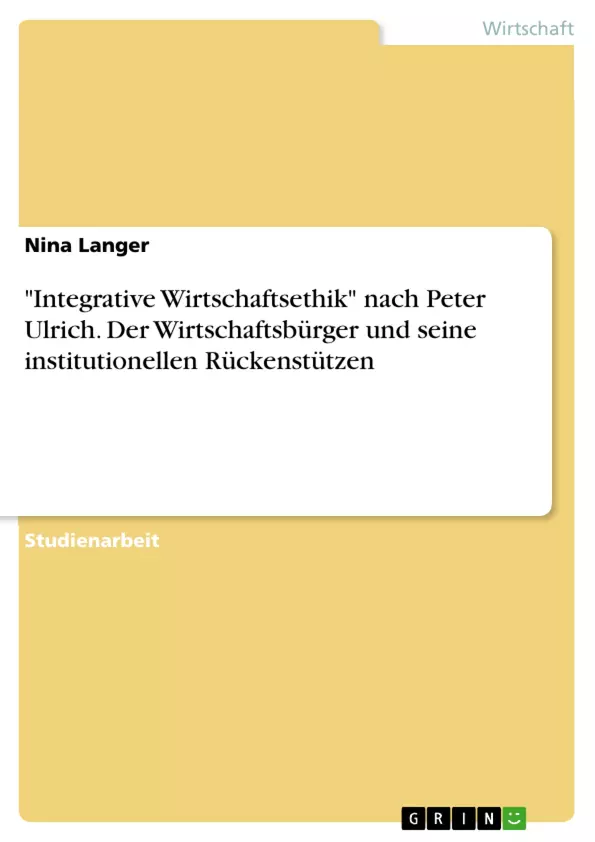Während Merkel sich 2015 mit dem Ausruf „Wir schaffen das!“ gegenüber einer offenen Zuwanderungspolitik optimistisch zeigte, wurden aufgrund des politischen Rechtsdrucks im Laufe ihrer Wahlperiode die Migrationsbewegungen nach Europa partiell eingedämmt. Den Höhepunkt bildete 2016 die Ausweitung des Prinzips des „sicheren Herkunftstaates“, worunter alle Länder eingestuft werden, in denen die Menschenrechtssituation so sicher ist, „nicht nach Leben oder Freiheit getrachtet“ wird, dass Personen aus solchen Herkunftsländern keinen Schutz in Deutschland benötigen. Derartige Rückschritte auf globaler Ebene deuten auf eine voranschreitende Auseinanderentwicklung von Ethik und Wirtschaft
Zunächst setzen die ersten beiden Kapitel als kritische Grundlagenreflexion der normativen Voraussetzungen der ökonomischen Vernunft an. Aufbauend auf der Kritik der vermeintlich „wertfreien“ ökonomischen Sachlogik und ihrer normativen Überhöhung zum Ökonomismus, wird im Anschluss eine ethisch fundierte regulative Idee ökonomischer Vernunft dargelegt. Unter den Kriterien teleologischer Lebensdienlichkeit und deontologischer Legitimität soll Wirtschaft und sein Verständnis von ökonomischer Effizienz im Rahmen des größeren Ganzen des guten Lebens und gerechten Zusammenlebens einer voll entfalteten Bürgergesellschaft eingebettet werden. Entlang der Trennlinie zwischen dem Ethos als subjektives Moralbewusstsein und der Ethik als deren normativ-kritischer Reflexion wird gemäß prägnanter philosophischer
Ansätze ein universelles Moralkonzept konzipiert, an dem der persönliche Lebensentwurf auszurichten ist. Herausgearbeitet wird ein Menschenbild fernab des egozentrischen „Homo oeconomicus“.
Im letzten Kapitel der Arbeit werden die praxisnahen „Orte“ wirtschaftsethischer Verantwortung bestimmt. Entsprechend des Titels „Der Wirtschaftsbürger und seine institutionellen Rückenstützen“ werden im Hinblick auf die dialektische Verschränkung der Individualethik- und der Institutionenethik einerseits der Wirtschaftsbürger in seinem öffentlichen und privatwirtschaftlichen Handeln und andererseits die rechtsstaatlich gesetzte Rahmenordnung des Marktes in nationaler sowie umrisshaft in transnationaler Hinsicht diskutiert. Den praktischen Bezugspunkt bildet der Wirtschaftsbürger als kritisch-reflektierender Konsument, in dessen Rolle exemplarisch dargelegt wird, wie wirtschaftliche Selbstbegrenzung umzusetzen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einführung
- 1. Die Kritik der „reinen“ ökonomischen Vernunft
- 1.1 Sachzwangdenken: Die Entfesselung des Marktes
- 1.2 Gemeinwohlfiktion: Die Moral des Marktes
- 2. Die Klärung einer ethisch-gehaltvollen, lebensdienlichen Ökonomie
- 2.1 Sinnfrage: Die Wirtschaft und das gute Leben
- 2.2 Legitimationsfrage: Die Wirtschaft und das gerechte Zusammenleben
- 3. Die Bestimmung der „Orte“ der Moral des Wirtschaftens
- 3.1 Wirtschaftsbürgerethik: Der deliberative, integre Wirtschaftsbürger
- 3.2 Ordnungsethik: Die deliberative, vitalpolitische Ordnungspolitik
- 3.3 Der Konsument in seiner Verantwortung zur ökonomischen Selbstbegrenzung
- 4. Kritische Würdigung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Integrativen Wirtschaftsethik nach Peter Ulrich und untersucht, wie die Ökonomie stärker an den Lebenserfordernissen des Menschen auszurichten ist. Die Arbeit fokussiert auf die Regulierung der Wirtschaft durch ethische Prinzipien und zeigt auf, wie eine lebensdienliche Ökonomie im Sinne einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft gestaltet werden kann.
- Kritik der „reinen“ ökonomischen Vernunft
- Klärung einer ethisch-gehaltvollen, lebensdienlichen Ökonomie
- Bestimmung der „Orte“ der Moral des Wirtschaftens
- Der Wirtschaftsbürger und seine institutionellen Rückenstützen
- Die Rolle der Ordnungspolitik und des Konsumenten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer kritischen Analyse der „reinen“ ökonomischen Vernunft. Sie zeigt auf, wie die Entfesselung des Marktes zu einer Vernachlässigung ethischer Prinzipien und zu einer moralischen Verfehlung führen kann. Im Anschluss wird die Notwendigkeit einer ethisch fundierten, lebensdienlichen Ökonomie hervorgehoben, die auf den Prinzipien der Teleologie und Deontologie basiert. Dabei werden die Sinnfrage und die Legitimationsfrage des Wirtschaftens im Kontext des Guten Lebens und des Gerechten Zusammenlebens thematisiert. Im dritten Kapitel werden die „Orte“ der Moral des Wirtschaftens beleuchtet, wie z.B. die Wirtschaftsbürgerethik, die Ordnungspolitik und die Verantwortung des Konsumenten.
Schlüsselwörter
Integrative Wirtschaftsethik, Peter Ulrich, Wirtschaftsbürger, Lebensdienlichkeit, Gerechtes Zusammenleben, Ordnungspolitik, Konsument, Ökonomismus, Moral, Ethik, Ökonomie
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "Integrative Wirtschaftsethik" nach Peter Ulrich?
Es ist ein Ansatz, der die Wirtschaft nicht als wertfreien Raum sieht, sondern sie in ethische Prinzipien der Lebensdienlichkeit und Gerechtigkeit einbetten will.
Was wird am "Ökonomismus" kritisiert?
Kritisiert wird die normative Überhöhung der ökonomischen Sachlogik, die menschliche Werte und ethische Fragen oft dem Profit unterordnet.
Wer ist der "Wirtschaftsbürger"?
Der Wirtschaftsbürger ist ein kritisch-reflektierender Akteur, der sowohl als Produzent als auch als Konsument Verantwortung für gerechtes Zusammenleben übernimmt.
Welche Rolle spielt die Ordnungspolitik?
Sie bildet die "institutionelle Rückenstütze", die durch rechtsstaatliche Rahmenbedingungen einen ethisch vertretbaren Wettbewerb erst ermöglicht.
Wie kann ein Konsument wirtschaftsethisch handeln?
Durch bewusste Kaufentscheidungen und ökonomische Selbstbegrenzung kann der Konsument Druck auf Unternehmen ausüben und ethische Standards fördern.
- Quote paper
- Nina Langer (Author), 2017, "Integrative Wirtschaftsethik" nach Peter Ulrich. Der Wirtschaftsbürger und seine institutionellen Rückenstützen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455370