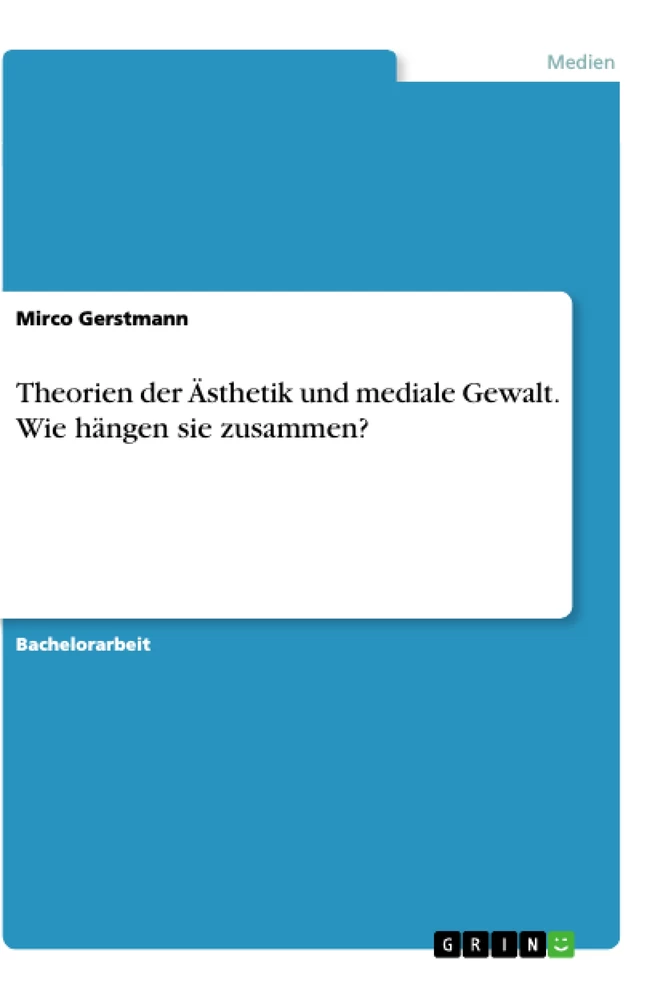In dieser Arbeit wird zunächst ein philosophisches Verständnis von Ästhetik dargelegt. In Bezug auf die Kommunikationswissenschaft stellen sich hier Fragen wie „Welche Erkenntnis ist schön?“ oder „Wann ist das Gewinnen von Erkenntnissen ‚schön‘?“. Im Anschluss daran soll ein Einblick in Nelson Goodmans semiotisch-analytische Betrachtungen von Ästhetik gegeben werden. Das philosophische Kapitel wird eine integrative Auseinandersetzung von Gabór Paál abschließen, der philosophische Überlegungen mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen verbindet.
Auf die Frage warum Menschen mediale Gewalt konsumieren, liefert die einschlägige Literatur unterschiedliche Antworten. Eine dieser Antworten befasst sich mit der ästhetischen Motivation zum Konsum von Gewalt in den Medien. Möchte man wissen, was Ästhetik in diesem Zusammenhang bedeutet, trifft man auf eine Fülle von Autoren und Disziplinen, die jeweils ein anderes Verständnis dieses Begriffes an den Tag legen.
Je nach Autor werden dem Begriff der Ästhetik unterschiedliche griechische Ausdrücke zugrunde gelegt und gedeutet. So stammt das Wort „Ästhetik“ laut Schmidt aus dem griechischen „Aistánesthai“, was so viel wie „wahrnehmen“ meint. Die Evolutionsbiologen Heerwagen und Orians leiten dieses „wahrnehmen“ vom griechischen Verb „aisthanomai“ ab. Scheer hingegen entlehnt „Ästhetik“ der „aisthesis“, wessen Bedeutung „Wahrnehmung“, „Gefühl“ oder „Verständnis“ sein kann.
Dieser kurze Abriss der semantischen Bedeutung von Ästhetik lässt erahnen, wie facettenreich dieser Begriff betrachtet werden kann. Grundsätzlich spielt in allen Definitionen der Ausdruck der Wahrnehmung eine wichtige Rolle. Es wäre aber falsch zu behaupten, dass „Wahrnehmen“ von allen gleich verstanden wird. Es wird in den folgenden Abschnitten nicht die Hauptaufgabe sein, Ästhetik zu definieren. Vielmehr geht es darum, unterschiedliche wissenschaftliche Ansichten über das Thema aufzuzeigen. Aufgrund der vielfältigen Literatur, die es zu diesem Thema gibt, bietet es sich an, lediglich einen ausgewählten Überblick aus verschiedenen Wissenschaften zu geben
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ästhetik in den unterschiedlichen Disziplinen
- Ästhetik in den Kunst- und Geisteswissenschaften
- Die Ästhetik Baumgartens
- Die Semiotische Perspektive Nelson Goodmans
- Gabór Paáls integrativer Ansatz
- Kunstphilosophie oder Kunsttheorie
- Rasa als indische Ästhetik
- Ästhetik in den Naturwissenschaften
- Evolutionsästhetik
- Experimentelle Ästhetik
- Neuroästhetik
- Zusammenfassung
- Ästhetik in den Kunst- und Geisteswissenschaften
- Gewalt
- Mediale Gewalt
- Ästhetik des Hässlichen
- Zusammenfassung
- Ästhetik und mediale Gewalt
- Ästhetik der Gewalt
- Ästhetik des Horrors
- Ästhetik der Zerstörung
- Ästhetisierung von Gewalt
- Zusammenfassung und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der ästhetischen Motivation zum Konsum von medialer Gewalt. Die Arbeit untersucht verschiedene wissenschaftliche Ansätze zum Verständnis von Ästhetik und deren Anwendung auf den Bereich der medialen Gewalt. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die Rezeption von Gewalt in den Medien gelegt.
- Das Konzept von Ästhetik in verschiedenen Disziplinen, wie Philosophie, Kunsttheorie und Naturwissenschaften.
- Die unterschiedlichen Formen der Gewalt, insbesondere die mediale Gewalt.
- Ästhetische Theorien zur medialen Gewalt, einschließlich der Ästhetik von Gewalt, Horror und Zerstörung.
- Die Ästhetisierung von Gewalt in den Medien.
- Ein Vergleich von verschiedenen Mediennutzungstheorien.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung und führt den Leser in die Thematik der ästhetischen Motivation zum Konsum von medialer Gewalt ein. Es wird die Vielschichtigkeit des Begriffs "Ästhetik" aufgezeigt und die Bedeutung der Wahrnehmung in verschiedenen Definitionen hervorgehoben.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Verständnis von Ästhetik in verschiedenen Disziplinen. Es werden unterschiedliche philosophische und naturwissenschaftliche Ansätze beleuchtet, die Einblicke in die Entstehung und Entwicklung der Ästhetikforschung liefern. Das Kapitel untersucht die semiotische Perspektive von Nelson Goodman und den integrativen Ansatz von Gabór Paál. Es werden auch die Kunstphilosophie, die indische Ästhetik sowie die Evolutionsästhetik und die Neuroästhetik beleuchtet.
Kapitel 3 behandelt das Thema Gewalt und fokussiert auf mediale Gewalt. Es werden unterschiedliche Formen von Gewalt untersucht, und die Ästhetik des Hässlichen wird im Zusammenhang mit medialer Gewalt betrachtet.
Das vierte Kapitel widmet sich der Verbindung von Ästhetik und medialer Gewalt. Es werden ästhetische Theorien zur medialen Gewalt analysiert, wobei die Ästhetik von Gewalt, Horror und Zerstörung im Vordergrund stehen. Der Fokus liegt auf der visuellen Ästhetik von Gewalt, wobei auch die Literatur in die Betrachtung einbezogen wird. Die Ästhetisierung von Gewalt in den Medien wird ebenfalls untersucht.
Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Erkenntnisse und einen Ausblick auf mögliche empirische Zugänge. Es werden Gemeinsamkeiten mit anderen Mediennutzungstheorien herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Ästhetik, Gewalt, mediale Gewalt, Rezeptionsästhetik, Semiotik, Kunstphilosophie, Evolutionsästhetik, Neuroästhetik und Ästhetisierung von Gewalt.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Ästhetik“ im Kontext medialer Gewalt?
Ästhetik bezieht sich hier auf die sinnliche Wahrnehmung und die formale Gestaltung von Gewaltdarstellungen, die beim Zuschauer Interesse oder Faszination auslösen können.
Warum konsumieren Menschen mediale Gewalt?
Die Arbeit untersucht die ästhetische Motivation, bei der die visuelle Gestaltung von Horror, Zerstörung oder Action einen Reiz ausübt, der über den reinen Inhalt hinausgeht.
Was ist die „Ästhetik des Hässlichen“?
Es ist ein Konzept, das beschreibt, wie abstoßende oder grausame Motive durch künstlerische oder mediale Aufbereitung eine eigene ästhetische Qualität gewinnen können.
Welche Rolle spielt die Evolutionsästhetik?
Die Evolutionsästhetik untersucht, ob unsere Wahrnehmung von Schönheit oder Gefahr biologisch verankert ist und wie dies die Rezeption von Medieninhalten beeinflusst.
Wie hängen Neuroästhetik und Gewaltrezeption zusammen?
Die Neuroästhetik erforscht die Gehirnaktivitäten bei der Wahrnehmung ästhetischer Reize und kann erklären, warum bestimmte Gewaltdarstellungen starke emotionale Reaktionen hervorrufen.
- Quote paper
- Mirco Gerstmann (Author), 2013, Theorien der Ästhetik und mediale Gewalt. Wie hängen sie zusammen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455382