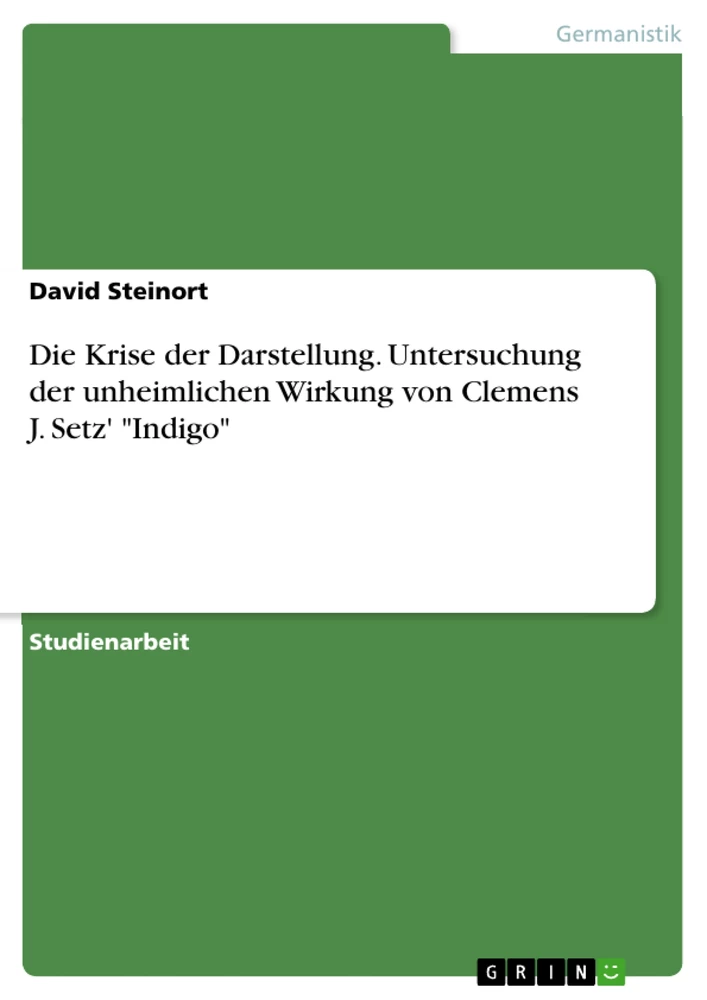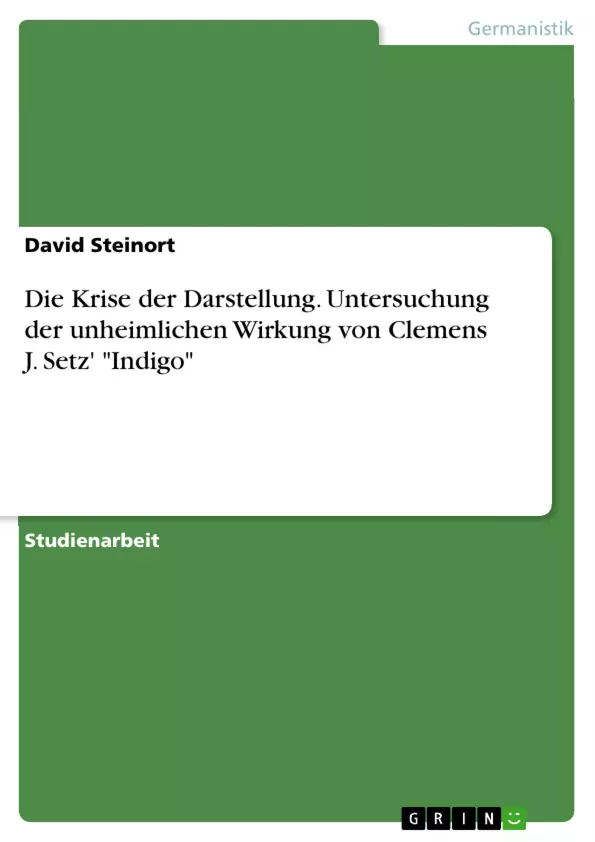Diese Hausarbeit untersucht das Phänomen des Unheimlichen in Clemens J. Setz' Roman und versucht seiner unheimlichen Wirkung auf die Spur zu kommen.
Als „dialog- und abwechslungsreich, amüsant und anekdotisch, aber auch brutal und abgründig“, in der Lektüre „nicht immer leicht, manchmal abschreckend, gelegentlich zum Verrücktlachen“, als „ein schrilles Vexierkabinett, vollgestopft mit Verweisen auf alles Abseitige und Grausame“ – so beschreiben Stimmen des Feuilletons Clemens J. Setz' 2012 erschienenen Roman Indigo. Die Kritik des Werkes bewegt sich dabei zwischen der Anerkennung des Buches als „unheimliches Meisterwerk“ und einer Charakterisierung als „Luftnummer“ und „Mumpitz“.
Durchgängig scheint jedoch die Beobachtung eines (angestrebten) Effekts beim Leser zu sein, der von Verwirrung bis zu Gefühlen des Schauderns reicht. So beschreibt beispielsweise Jens Jessens in seinem Artikel Kinder zum Kotzen eine „unheimliche[n] Expressivität“ des Textes, durch welche letztlich „der kognitive Prozess der Lektüre in eine physische Reaktion umschlägt“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychoanalytische Deutung des Unheimlichen
- Etymologische Untersuchung
- Überprüfung und Ergebnis Freuds
- Rezeption und Erweiterung des freudschen Ansatzes
- Das Unheimliche als Struktur
- Das Doppelgänger-Motiv
- Exkurs: Das Groteske
- Das Unheimliche in Indigo
- Das Indigo-Syndrom
- Das Doppelgänger-Motiv in Indigo
- Diegetische Ebene
- Ebene der Erzählstruktur
- Metaisierende Selbstreflexivität
- Die Krise der Darstellung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert den Roman "Indigo" von Clemens J. Setz im Hinblick auf seine unheimliche Wirkung. Ziel ist es, herauszufinden, ob und inwiefern der Roman als unheimlich angesehen werden kann und welche textlichen Elemente diese Wirkung hervorrufen. Die Analyse wird sich auf die psychoanalytische Perspektive des Unheimlichen nach Sigmund Freud stützen, die in einem ersten Schritt vorgestellt und im Hinblick auf die literarische Umsetzung im Roman "Indigo" untersucht wird.
- Das Unheimliche als literarisches Motiv und dessen Rezeption in der Literatur
- Die psychoanalytische Definition des Unheimlichen nach Freud
- Die Bedeutung von Doppelgängermotiven in der Konstruktion des Unheimlichen
- Metafiktion und Selbstreflexivität als Mittel zur Steigerung der unheimlichen Wirkung
- Die "Krise der Darstellung" als zentrales Thema im Roman "Indigo"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der unheimlichen Wirkung in der Literatur ein und stellt den Roman "Indigo" von Clemens J. Setz als Untersuchungsobjekt vor. Sie verweist auf unterschiedliche Rezeptionen des Romans, die von Bewunderung bis Ablehnung reichen, und zeigt, dass der Text beim Leser ein breites Spektrum an emotionalen Reaktionen hervorruft, die von Verwirrung bis zum Schaudern reichen.
Das zweite Kapitel widmet sich der psychoanalytischen Definition des Unheimlichen nach Sigmund Freud. Die etymologische Entwicklung des Begriffs "unheimlich" wird untersucht, um den spezifischen Charakter des Gefühls des Unheimlichen zu ergründen.
Im dritten Kapitel werden die Rezeption und Erweiterung des Freudschen Ansatzes in der Literaturwissenschaft beleuchtet. Dabei werden verschiedene Ansätze betrachtet, die das Unheimliche als Struktur, als Motiv und als literarisches Phänomen beschreiben.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Analyse des Romans "Indigo" im Hinblick auf seine unheimliche Wirkung. Die Analyse konzentriert sich dabei auf die metafiktionalen Elemente des Textes, die durch die Verwendung von Doppelgängermotiven und Selbstreflexivität eine unheimliche Atmosphäre erzeugen.
Schlüsselwörter
Das Unheimliche, Psychoanalyse, Sigmund Freud, Literaturwissenschaft, Metafiktion, Doppelgänger, Selbstreflexivität, "Indigo", Clemens J. Setz, Krise der Darstellung
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Clemens J. Setz' Roman "Indigo"?
Der Roman thematisiert das "Indigo-Syndrom" und erzeugt beim Leser eine unheimliche Wirkung, die zwischen Verwirrung und Schaudern schwankt.
Wie definiert Sigmund Freud das "Unheimliche"?
Freud beschreibt das Unheimliche als etwas ehemals Vertrautes, das durch Verdrängung fremd und beängstigend geworden ist.
Welche Rolle spielt das Doppelgänger-Motiv in "Indigo"?
Das Motiv wird auf verschiedenen Ebenen (diegetisch, erzählstrukturell) genutzt, um die Identität der Figuren zu destabilisieren und Unbehagen zu stiften.
Was bedeutet "Krise der Darstellung" in diesem Kontext?
Es beschreibt die Schwierigkeit, die Grenze zwischen Realität und Fiktion im Roman klar zu ziehen, was die unheimliche Atmosphäre verstärkt.
Wie reagierte das Feuilleton auf den Roman?
Die Kritiken reichten von "unheimliches Meisterwerk" bis hin zu "Mumpitz", wobei die physische Reaktion beim Lesen oft betont wurde.
- Arbeit zitieren
- David Steinort (Autor:in), 2015, Die Krise der Darstellung. Untersuchung der unheimlichen Wirkung von Clemens J. Setz' "Indigo", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455414