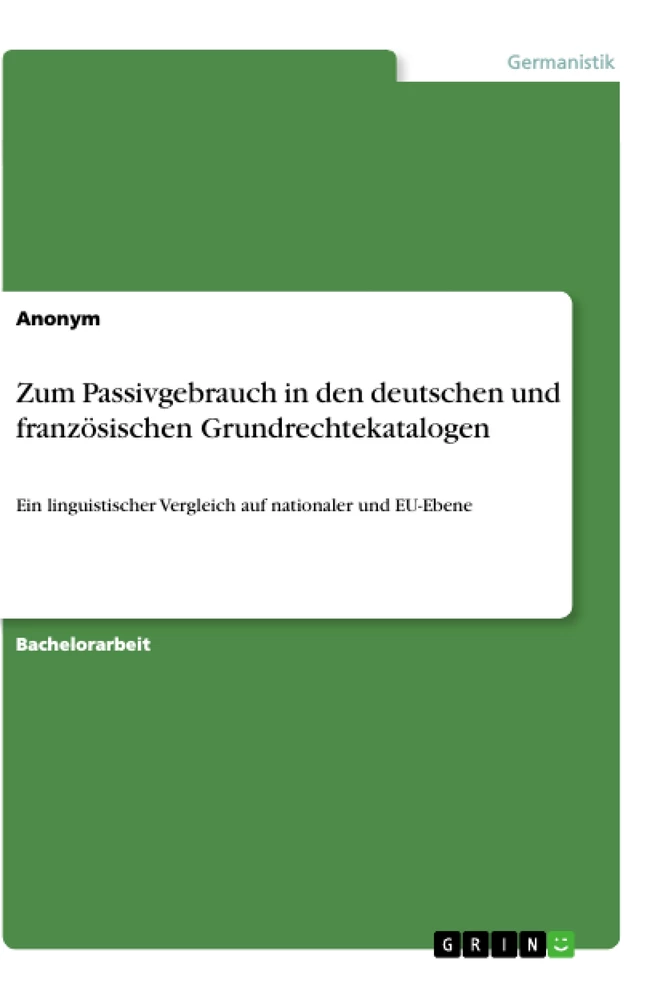Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Thema Passivgebrauch in der Gesetzessprache. Speziell wird hierzu das Passiv im Deutschen und Französischen untersucht. Als Korpusgrundlage dienen die Grundrechtekataloge der deutschen und französischen Verfassungen sowie die Grundrechte-Charta der Europäischen Union. Dies stellt bereits die erste Schwierigkeit für die Analyse dar. Die Arbeit als rechtslinguistische Untersuchung soll interdisziplinäre Erkenntnisse der Sprach- und Rechtswissenschaft liefern. So beinhaltet sie rechts- und sprachvergleichende Erwägungen.
Im einleitenden Teil erfolgt die Heranführung an das Thema, die die Notwendigkeit der vorliegenden Analyse unterstreichen soll. Es wird auf die Rolle der französischen und deutschen Sprache in der EU hingewiesen, da die hier verwendete Untersuchungsgrundlage in jenen Sprachen abgefasst ist. Zur weiteren Rechtfertigung des gewählten Forschungsthemas mit seinem konkreten Korpus werden rechtswissenschaftliche Hintergrundinformationen vermittelt, die die Bedeutsamkeit von Gesetzen mit Verfassungsrang hervorheben. Daran schließt sich ein theoretischer Teil an, der eine sprachwissenschaftliche Betrachtung des Passivs in beiden Sprachen liefert. Die Funktionen des Passivs allgemein sowie speziell in der Rechtssprache werden mithilfe von Beispielen erläutert. Im empirischen Teil dieser Arbeit erfolgt eine quantitative Analyse der Passivfrequenz des Korpus. Die qualitative Analyse beinhaltet den eigentlichen interlingualen Vergleich. Einzelne aussagekräftige Passivfügungen der verschiedensprachigen Rechtsquellen werden extrahiert und einander gegenübergestellt. Schließlich werden die Ergebnisse der Analyse ausgewertet und in einem Fazit zusammengetragen.
Die Anfänge des Forschungsgebiets der Rechtslinguistik sind nicht eindeutig zu datieren, jedoch taucht der Begriff selbst seit 1970 immer häufiger auf. Dies ist nicht verwunderlich, da man sich schon seit mehreren Jahrhunderten mit der Verknüpfung von Sprache und Recht befasst. So ist die Rechtsfindung in den europäischen Rechtssystemen an schriftlich gesicherte Normen gebunden, deren sprachliche Unmissverständlichkeit von fundamentaler Bedeutung ist. Die Schwierigkeit bei rechtslinguistischen Arbeiten ist es folglich, in beiden Disziplinen einen wissenschaftlichen Tiefgang zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Passiv
- 2.1 Das Passiv im Deutschen
- 2.1.1 Grundformen
- 2.1.2 Passivperiphrasen
- 2.1.3 Unpersönliches Passiv
- 2.1.4 Funktionen
- 2.2 Passiv im Französischen
- 2.2.1 Grundform
- 2.2.2 Passivperiphrasen
- 2.1 Das Passiv im Deutschen
- 3. Analyse
- 3.1 Quantitative Analyse
- 3.2 Qualitative Analyse
- 4. Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Passivgebrauch in der deutschen und französischen Gesetzessprache, insbesondere in den Grundrechtekatalogen auf nationaler und EU-Ebene. Ziel ist es, interdisziplinäre Erkenntnisse aus Sprach- und Rechtswissenschaft zu gewinnen und einen sprach- und rechtsvergleichenden Einblick zu liefern. Die Arbeit beleuchtet die Funktionen des Passivs in beiden Sprachen und analysiert dessen Häufigkeit und Verwendung im gewählten Korpus.
- Der Passivgebrauch in der deutschen und französischen Gesetzessprache
- Vergleichende Analyse des Passivs in deutschen und französischen Grundrechtekatalogen
- Quantitative und qualitative Analyse der Passivfrequenz
- Interlinguale Analyse von Passivkonstruktionen
- Bedeutung des Passivs für die sprachliche Klarheit und Prägnanz in Rechtstexten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Passivgebrauch in der Gesetzessprache ein und begründet die Wahl des Korpus (deutsche und französische Grundrechtekataloge sowie die Grundrechtecharta der EU). Sie betont die interdisziplinäre Natur der Arbeit und die Herausforderungen bei der Verbindung von sprachwissenschaftlicher und rechtswissenschaftlicher Perspektive. Die Einleitung verortet die Arbeit im Kontext der Rechtslinguistik und zeigt die Bedeutung der sprachlichen Klarheit in Rechtstexten auf, unter Berücksichtigung der Rolle von Deutsch und Französisch in der EU.
2. Das Passiv: Dieses Kapitel bietet eine sprachwissenschaftliche Betrachtung des Passivs im Deutschen und Französischen. Es beschreibt die Grundformen, Passivperiphrasen und das unpersönliche Passiv in beiden Sprachen, analysiert deren Funktionen und beleuchtet spezifische Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Der Fokus liegt auf der Darstellung der grammatikalischen Strukturen und ihrer Verwendung in der Rechtssprache. Beispiele verdeutlichen die Anwendung der verschiedenen Passivkonstruktionen.
3. Analyse: Das Kapitel "Analyse" gliedert sich in eine quantitative und eine qualitative Analyse. Die quantitative Analyse untersucht die Häufigkeit des Passivgebrauchs im Korpus. Die qualitative Analyse vergleicht die Verwendung des Passivs in den verschiedenen Sprachen und Rechtstexten. Sie extrahiert aussagekräftige Passivkonstruktionen aus den deutschen und französischen Quellen und stellt diese gegenüber, um Ähnlichkeiten und Unterschiede zu untersuchen und zu interpretieren. Dieser Vergleich dient der Identifizierung von Besonderheiten der sprachlichen Kodifizierung des Rechts in den untersuchten Sprachen.
Schlüsselwörter
Passiv, Gesetzessprache, Rechtslinguistik, Deutsch, Französisch, Grundrechte, Grundrechtekataloge, EU, quantitative Analyse, qualitative Analyse, interlingualer Vergleich, sprachliche Kodifizierung des Rechts, Verfassungsrecht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse des Passivgebrauchs in der deutschen und französischen Gesetzessprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Gebrauch des Passivs in der deutschen und französischen Gesetzessprache, insbesondere in den Grundrechtekatalogen auf nationaler und EU-Ebene. Sie verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der Sprach- und Rechtswissenschaft verbindet.
Welche Ziele werden verfolgt?
Das Ziel ist ein sprach- und rechtsvergleichender Einblick in die Funktionen, die Häufigkeit und die Verwendung des Passivs in den ausgewählten Textkorpora. Die Arbeit analysiert quantitative und qualitative Aspekte des Passivgebrauchs und untersucht dessen Bedeutung für die sprachliche Klarheit und Prägnanz in Rechtstexten.
Welche Sprachen werden verglichen?
Der Vergleich konzentriert sich auf Deutsch und Französisch, unter Berücksichtigung der Bedeutung dieser Sprachen im Kontext der EU und ihrer jeweiligen Gesetzessprachen.
Welche Textsorten werden analysiert?
Die Analyse basiert auf Grundrechtekatalogen auf nationaler Ebene (Deutschland, Frankreich) sowie der Grundrechtecharta der EU.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Passiv (mit Unterkapiteln zu Deutsch und Französisch), ein Analysekapitel (mit quantitativer und qualitativer Analyse) und eine Schlussfolgerung. Ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Was wird im Kapitel "Das Passiv" behandelt?
Dieses Kapitel bietet eine sprachwissenschaftliche Beschreibung des Passivs in Deutsch und Französisch. Es behandelt Grundformen, Passivperiphrasen, das unpersönliche Passiv und die Funktionen des Passivs in beiden Sprachen. Es werden grammatikalische Strukturen und deren Verwendung in der Rechtssprache erläutert und mit Beispielen veranschaulicht.
Wie wird die Analyse durchgeführt?
Das Analysekapitel beinhaltet eine quantitative Analyse der Passivhäufigkeit im Korpus und eine qualitative Analyse, die den Gebrauch des Passivs in den verschiedenen Sprachen und Texten vergleicht. Aussagekräftige Passivkonstruktionen werden extrahiert, gegenübergestellt und interpretiert, um Ähnlichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und Besonderheiten der sprachlichen Kodifizierung des Rechts zu identifizieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Passiv, Gesetzessprache, Rechtslinguistik, Deutsch, Französisch, Grundrechte, Grundrechtekataloge, EU, quantitative Analyse, qualitative Analyse, interlingualer Vergleich, sprachliche Kodifizierung des Rechts, Verfassungsrecht.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen der Sprachwissenschaft, Rechtswissenschaft und Rechtslinguistik, sowie für alle, die sich für den Vergleich von Gesetzessprachen und die sprachliche Gestaltung von Rechtstexten interessieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Zum Passivgebrauch in den deutschen und französischen Grundrechtekatalogen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455428