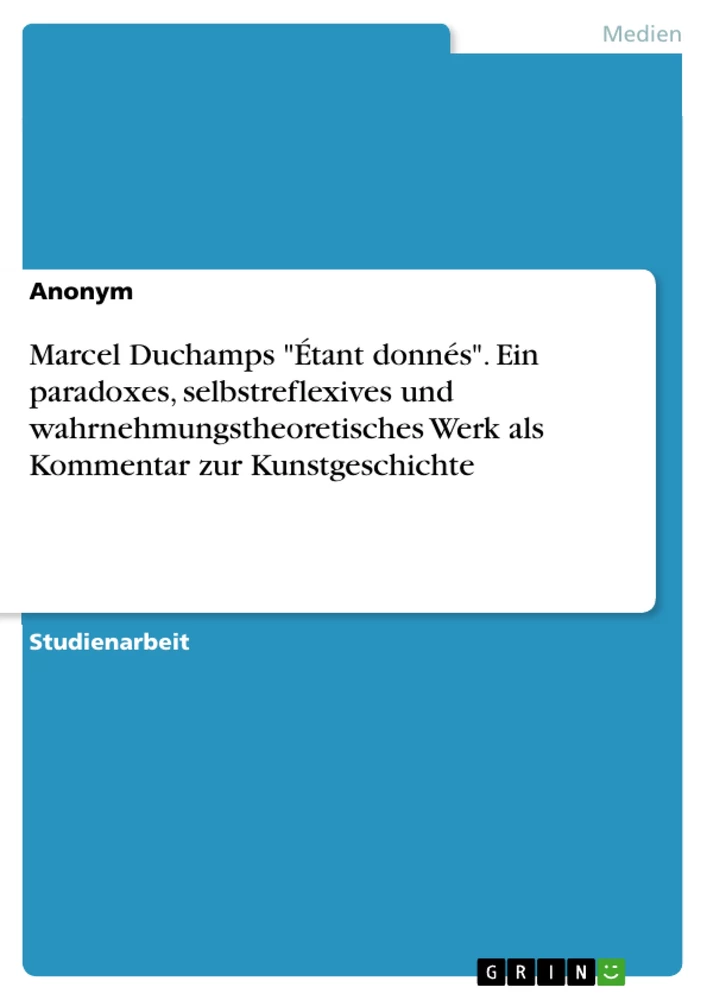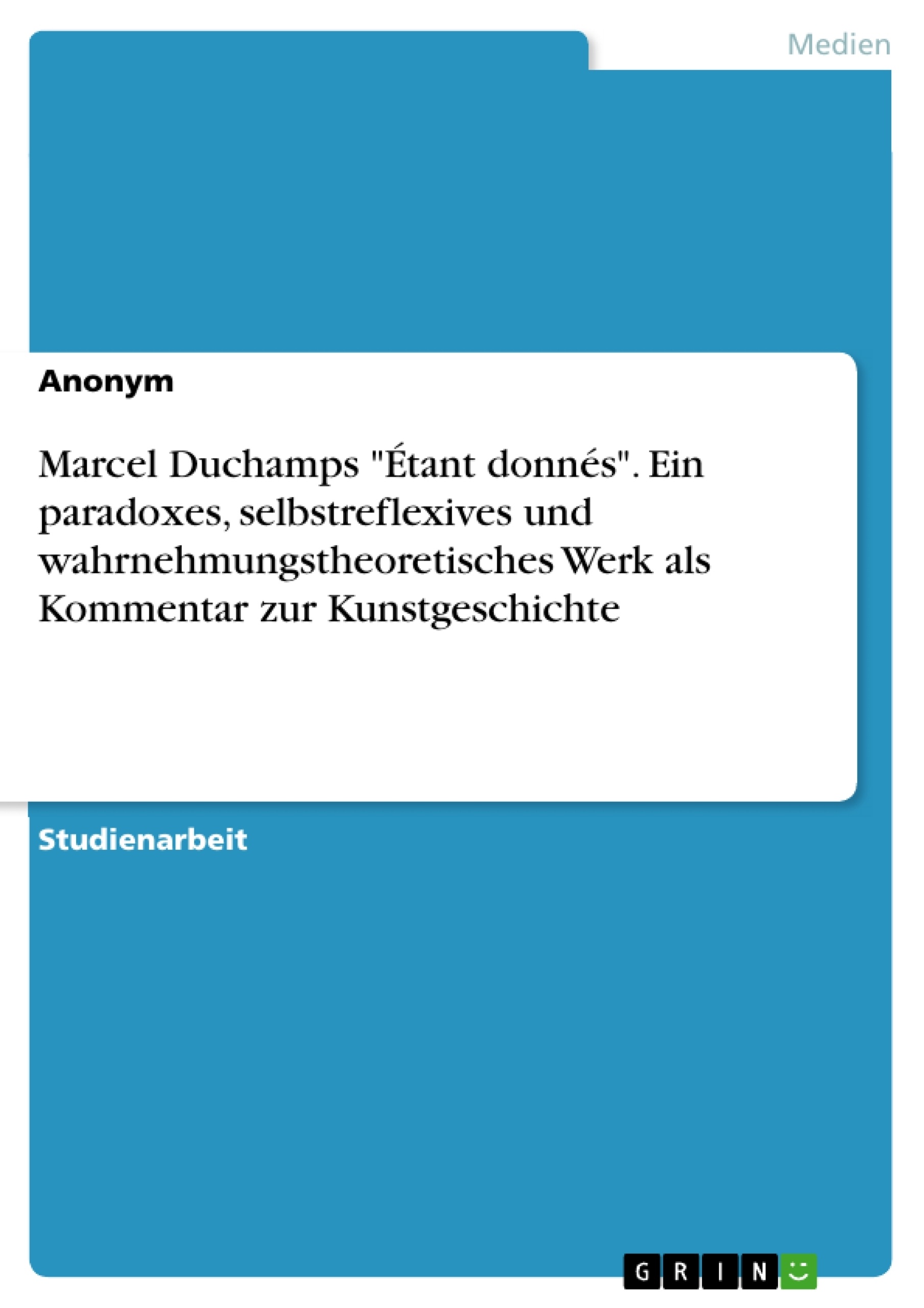In ihrer zentralen Frage beschäftigt sich die Arbeit mit der grundsätzlichen Intention des Künstlers, also mit Fragen zu den Aussagen des Werkes und mit der Frage, ob das Werk als ein Kommentar auf die Kunstgeschichte an sich gesehen werden kann. Um die übergeordnete These, dass Duchamps Étant donnés das System der Kunstgeschichte in mehreren Ebenen (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) infrage stellt, zu beweisen, werden unterschiedliche Deutungsansätze vorgestellt, unter denen vor allem die Punkte zur Ikonografie, zur Perspektive, zur Wahrnehmungstheorie und zur Metakunst entscheidend sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Marcel Duchamps Étant donnés
- Beschreibung
- Einordnung in die Objektkunst
- Ein wahrnehmungstheoretisches und selbstreflexives Werk
- Entstehungsgeschichte und Material
- Historische, zeitgeschichtliche und ikonografische Einordnung
- Ikonografische Quellen
- Perspektive
- Kriminologie und der Black Dahlia Murder
- Weiblicher Körper, Sexualität und Pornografie
- Betrachterrolle und Wahrnehmungsästhetik
- Rätselhaftigkeit
- Öffnen und Schließen bei Étant donnés
- Dekonstruktion und Metakunst
- Étant donnés als Kommentar zur Kunstgeschichte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Marcel Duchamps Werk „Étant donnés“ als Kommentar zur Kunstgeschichte. Die Zielsetzung besteht darin, die Intention des Künstlers zu ergründen und zu analysieren, inwiefern das Werk das System der Kunstgeschichte auf verschiedenen Ebenen hinterfragt. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Deutungsansätze und untersucht die Bedeutung von Ikonografie, Perspektive, Wahrnehmungstheorie und Metakunst für das Verständnis des Werkes.
- Die Bedeutung von „Étant donnés“ im Kontext von Duchamps Gesamtwerk
- Die Rolle der Ikonografie und die Verwendung historischer und ikonografischer Quellen
- Die Perspektive des Betrachters und die Wahrnehmungsästhetik des Werkes
- Die selbstreflexive und metakünstlerische Natur von „Étant donnés“
- „Étant donnés“ als Dekonstruktion traditioneller Bildaufbauten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale These auf, dass Duchamps „Étant donnés“ das System der Kunstgeschichte auf mehreren Ebenen hinterfragt. Sie erläutert die Bedeutung des Werkes im Kontext von Duchamps Gesamtwerk und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der verschiedene Deutungsansätze und Interpretationsmöglichkeiten beleuchtet. Die Einleitung benennt die Leitfragen, die im Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen, und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit.
Marcel Duchamps Étant donnés: Dieses Kapitel bietet eine Beschreibung des Werkes selbst, wobei die Schwierigkeiten einer objektiven Beschreibung aufgrund der komplexen Struktur betont werden. Es wird auf die Entstehungsgeschichte eingegangen, die als zentrale Grundlage für die Interpretation des Werkes dient. Die Beschreibung umfasst sowohl den visuellen Eindruck als auch die verwendeten Materialien und Techniken. Dieser Abschnitt legt den Grundstein für die folgenden Kapitel, die tiefere Interpretationsebenen erschließen.
Ein wahrnehmungstheoretisches und selbstreflexives Werk: Dieses Kapitel präsentiert und diskutiert verschiedene Deutungsansätze von Wissenschaftler*innen zu „Étant donnés“. Es werden ikonografische Quellen analysiert, Vergleiche mit Gemälden früherer Künstler gezogen und die Zusammenhänge zwischen der Geschichte und Theorie der Perspektive und dem Werk erörtert. Der Einfluss des „Black Dahlia Murder“ als mögliche Inspirationsquelle wird ebenfalls beleuchtet. Die Auswirkungen des Werkes auf den Betrachter werden im Detail untersucht, wobei Aspekte der Weiblichkeit, Sexualität und Pornografie unter Berücksichtigung des Voyeurismus eine zentrale Rolle spielen. Schließlich werden die Aspekte des „Öffnens und Schließens“ und die Dekonstruktion traditioneller Bildaufbauten analysiert, bevor das Werk als selbstreflexives Kunstwerk der Metakunst charakterisiert wird.
Étant donnés als Kommentar zur Kunstgeschichte: Dieses Kapitel soll die zentrale These der Arbeit weiter ausbauen und vertiefen, indem es die verschiedenen im vorherigen Kapitel vorgestellten Interpretationen zusammenführt und deren Bedeutung für die Kunstgeschichte beleuchtet. Es soll die verschiedenen Ebenen der Infragestellung des Systems der Kunstgeschichte durch Duchamps Werk analysieren und die Relevanz von „Étant donnés“ im Kontext der Kunstgeschichte herausstellen. Der Fokus liegt auf der Synthese der vorherigen Kapitel und der daraus resultierenden Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Stellung des Werkes in der Kunstgeschichte.
Schlüsselwörter
Marcel Duchamp, Étant donnés, Objektkunst, Wahrnehmungstheorie, Metakunst, Ikonografie, Perspektive, Dekonstruktion, Kunstgeschichte, Betrachterrolle, Sexualität, Pornografie, Rätselhaftigkeit, Öffnung und Schließung.
Marcel Duchamps "Étant donnés": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Marcel Duchamps Werk „Étant donnés“ und untersucht dessen Bedeutung als Kommentar zur Kunstgeschichte. Sie erforscht die Intention des Künstlers und analysiert, wie das Werk das System der Kunstgeschichte auf verschiedenen Ebenen hinterfragt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Deutungsansätze und untersucht die Bedeutung von Ikonografie, Perspektive, Wahrnehmungstheorie und Metakunst für das Verständnis von „Étant donnés“. Sie betrachtet die Rolle der Ikonografie und historischer Quellen, die Perspektive des Betrachters und die Wahrnehmungsästhetik, die selbstreflexive und metakünstlerische Natur des Werks, sowie dessen Dekonstruktion traditioneller Bildaufbauten. Zusätzlich werden Aspekte wie Weiblichkeit, Sexualität, Pornografie und Voyeurismus im Kontext des Werkes diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Beschreibung von „Étant donnés“, ein Kapitel zur Wahrnehmungstheorie und Selbstreflexivität des Werks, ein Kapitel zur Einordnung des Werkes in die Kunstgeschichte und ein Fazit. Das Kapitel zu „Étant donnés“ beinhaltet detaillierte Beschreibungen, die Entstehungsgeschichte, ikonografische Analysen und die Erörterung von Perspektiven. Das Kapitel zur Wahrnehmungstheorie und Selbstreflexivität erörtert verschiedene Interpretationen und beleuchtet den Einfluss des „Black Dahlia Murder“ sowie den Aspekt des „Öffnens und Schließens“. Das Kapitel zur Kunstgeschichte fasst die vorherigen Interpretationen zusammen und analysiert die Infragestellung des Systems der Kunstgeschichte durch Duchamps Werk.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Intention Duchamps bei der Schaffung von „Étant donnés“ zu ergründen und zu analysieren, inwiefern das Werk das System der Kunstgeschichte hinterfragt. Sie will verschiedene Deutungsansätze präsentieren und die Bedeutung verschiedener Aspekte für das Verständnis des Werkes beleuchten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Marcel Duchamp, Étant donnés, Objektkunst, Wahrnehmungstheorie, Metakunst, Ikonografie, Perspektive, Dekonstruktion, Kunstgeschichte, Betrachterrolle, Sexualität, Pornografie, Rätselhaftigkeit, Öffnung und Schließung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und den methodischen Ansatz erläutert. Es folgen Kapitel, die das Werk selbst beschreiben, verschiedene Interpretationen diskutieren und seine Bedeutung im Kontext der Kunstgeschichte analysieren. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf wissenschaftliche Deutungsansätze von Wissenschaftler*innen zu „Étant donnés“ und analysiert ikonografische Quellen. Es werden Vergleiche mit Gemälden früherer Künstler gezogen und die Zusammenhänge zwischen der Geschichte und Theorie der Perspektive und dem Werk erörtert. Die Arbeit bezieht sich auch auf den "Black Dahlia Murder" als mögliche Inspirationsquelle.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Personen bestimmt, die sich akademisch mit Marcel Duchamps Werk „Étant donnés“, der Kunstgeschichte, Wahrnehmungstheorie und Metakunst auseinandersetzen möchten. Sie ist für ein akademisches Publikum konzipiert.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2017, Marcel Duchamps "Étant donnés". Ein paradoxes, selbstreflexives und wahrnehmungstheoretisches Werk als Kommentar zur Kunstgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455458