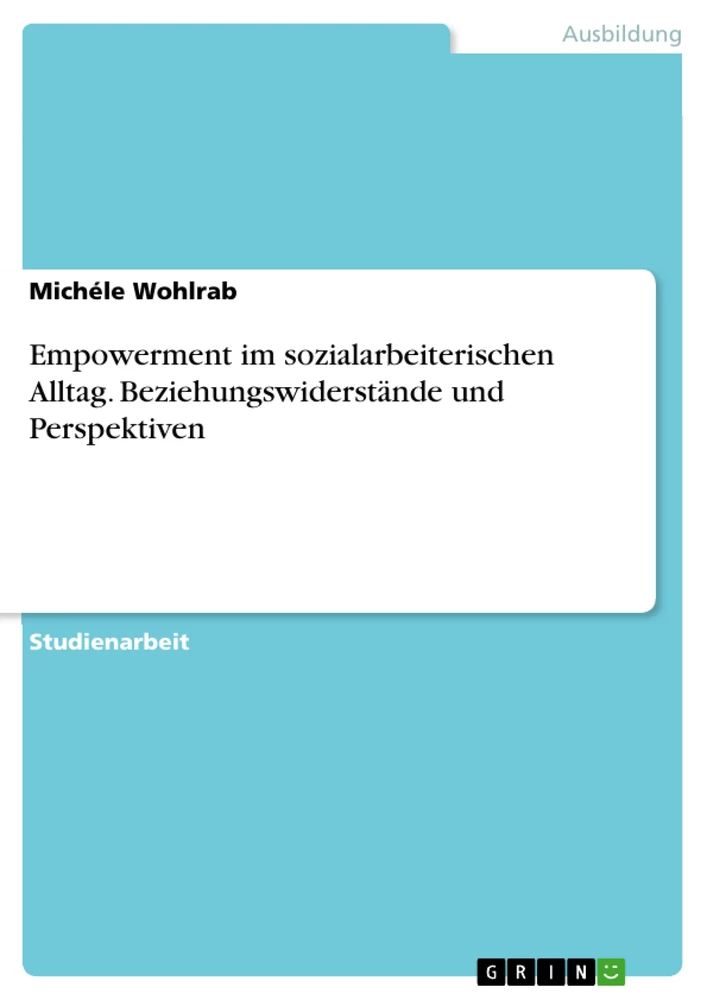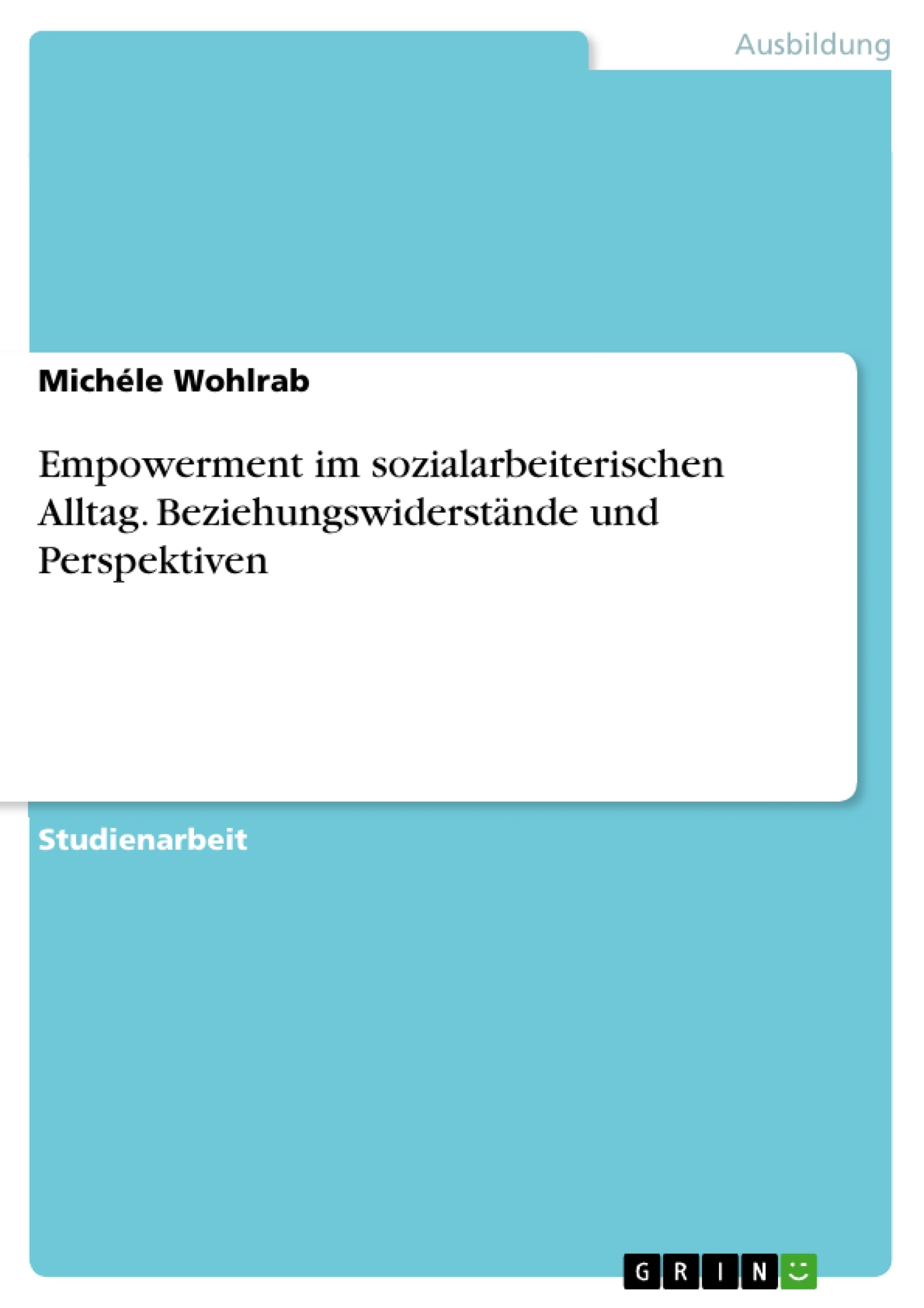Diese Arbeit widmet sich den Beziehungswiderständen bei der Umsetzung der Methode des Empowerments im sozialarbeiterischen Alltag. Diesbezüglich soll vor allem die Frage geklärt werden, wie sich Beziehungswiderstände auf die Umsetzung von Empowerment-Perspektiven auswirken und welche Schwierigkeiten sich für Klient und Sozialarbeiterhinter diesem Konzept der Sozialarbeit verbergen.
Empowerment ist eine Strategie, die oftmals in der sozialen Arbeit angewandt wird. Sie legt ihren Fokus auf Selbstbefähigung, Selbstbemächtigung und Stärkung der Eigenmacht, sowie auf Autonomie und Selbstverfügung. Es ist der Versuch, den Blickwinkel auf die Schwächen der Individuen zu ersetzen durch eine Orientierung an den Stärken und Kompetenzen.
Wichtig für diese Methode ist, dass man als professioneller Sozialarbeiter die Enteignung von Macht auf ein Minimum beschränkt und so die Unabhängigkeit und Kompetenz des Klienten fördert. Dieser Vorgang kann einige Widerstände auf der Beziehungsebene hervorrufen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung verursachen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von „Empowerment“
- 3. Empowerment als Chance für den Beziehungsaufbau zwischen Sozialarbeiter und Klient
- 3.1 Allgemeine Definition von Beziehung
- 3.2 Die helfende und professionelle Beziehung in Bezug auf Empowerment
- 4. Die Empowerment-Beziehung als Partnerschaft (,,Sharing Power“)
- 5. Beziehungsstörungen der Empowerment-Perspektiven
- 5.1 Empowerment als Gefahr der Überforderung für den Klienten
- 5.2 Der Klient in der Position der Fügsamkeit und Abhängigkeit
- 5.3 Legitimität der Expertenmacht
- 6. Der Eigensinn des Klienten
- 6.1 Psychische Belastung des Sozialarbeiters
- 6.2 Beispiel
- 7. Die Grenzen der Empowerment-Arbeit
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Beziehungswiderstände bei der Umsetzung von Empowerment-Perspektiven im sozialarbeiterischen Alltag. Sie klärt die Frage, wie sich diese Widerstände auf die Umsetzung von Empowerment auswirken und welche Schwierigkeiten für Klienten und Sozialarbeiter damit verbunden sind.
- Definition von Empowerment und dessen geschichtliche Wurzeln
- Empowerment als Chance für den Beziehungsaufbau zwischen Sozialarbeiter und Klient
- Die Empowerment-Beziehung als Partnerschaft und Herausforderungen daraus resultierend
- Beziehungsstörungen und die Rolle der Expertenmacht
- Grenzen der Empowerment-Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein und beschreibt die Methode des Empowerments als Ansatz in der professionellen Sozialarbeit. Sie definiert Empowerment als Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung und betont die Bedeutung der Fokussierung auf die Stärken und Kompetenzen des Klienten. Die Einleitung formuliert die zentrale Forschungsfrage der Arbeit und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel, welche die verschiedenen Aspekte der Beziehungswiderstände bei der Umsetzung von Empowerment-Perspektiven im sozialarbeiterischen Alltag behandeln werden.
2. Definition von „Empowerment“: Dieses Kapitel beleuchtet die vielschichtigen Ursprünge des Empowerment-Konzepts, die in der Pädagogik der Unterdrückten, dem Feminismus und der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung sowie der Selbsthilfebewegung liegen. Es definiert Empowerment als Unterstützung und Förderung individueller Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit durch professionelle Akteure. Im Fokus steht die Vermeidung von Defizitzuschreibungen und die Stärkung der Ressourcen des Klienten zur Aktivierung seiner Selbstwirksamkeit.
3. Empowerment als Chance für den Beziehungsaufbau zwischen Sozialarbeiter und Klient: Dieses Kapitel untersucht Empowerment als Chance für den Aufbau einer positiven Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klient. Es beginnt mit einer allgemeinen Definition von Beziehung und beleuchtet die Besonderheiten der helfenden und professionellen Beziehung im Kontext von Empowerment. Es betont die Bedeutung von Vertrauen und der Vermeidung von Bevormundung, um die Selbstbestimmung des Klienten zu fördern.
4. Die Empowerment-Beziehung als Partnerschaft (,,Sharing Power“): Dieses Kapitel analysiert die Empowerment-Beziehung als partnerschaftliches Verhältnis, wobei die Macht geteilt wird ("Sharing Power"). Es fokussiert auf die Dynamiken dieser Partnerschaft und die damit verbundenen Herausforderungen und Konflikte, die sowohl für den Klienten als auch den Sozialarbeiter entstehen können.
5. Beziehungsstörungen der Empowerment-Perspektiven: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Beziehungsstörungen, die die Umsetzung von Empowerment behindern können. Es thematisiert die Gefahr der Überforderung des Klienten, die Möglichkeit, dass der Klient in eine Position der Fügsamkeit und Abhängigkeit gerät und die Problematik der Legitimität der Expertenmacht. Die jeweiligen Aspekte werden in ihren Auswirkungen auf den Klienten und den Arbeitsablauf detailliert erklärt.
6. Der Eigensinn des Klienten: Dieses Kapitel befasst sich mit dem "Eigensinn" des Klienten als mögliche Quelle von Beziehungswiderständen. Es analysiert die psychische Belastung, die dieser Eigensinn für den Sozialarbeiter mit sich bringen kann und veranschaulicht dies anhand eines konkreten Beispiels. Die damit verbundenen Herausforderungen für die professionelle Praxis werden diskutiert.
7. Die Grenzen der Empowerment-Arbeit: Das siebte Kapitel beleuchtet die Grenzen des Empowerment-Ansatzes, die aus den zuvor diskutierten Punkten resultieren. Es setzt sich kritisch mit den Herausforderungen und potenziellen Schwierigkeiten auseinander, die im Umgang mit dem Empowerment-Konzept auftreten können.
Schlüsselwörter
Empowerment, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Beziehungsgestaltung, Sozialarbeit, Klient, Sozialarbeiter, Beziehungswiderstände, Expertenmacht, Überforderung, Abhängigkeit, Eigensinn, Grenzen der Empowerment-Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Beziehungswiderstände bei der Umsetzung von Empowerment-Perspektiven in der Sozialarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Herausforderungen und Widerstände, die bei der Umsetzung von Empowerment-Ansätzen in der Sozialarbeit im Alltag auftreten. Sie fokussiert sich auf die Auswirkungen dieser Widerstände auf die Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klient und die damit verbundenen Schwierigkeiten für beide Seiten.
Was wird unter „Empowerment“ verstanden?
Die Arbeit definiert Empowerment als Prozess der Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung. Sie betont die Stärkung der Ressourcen und Kompetenzen des Klienten, um seine Selbstwirksamkeit zu fördern und Defizitzuschreibungen zu vermeiden. Die historischen Wurzeln des Konzepts werden in der Pädagogik der Unterdrückten, dem Feminismus, der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und der Selbsthilfebewegung verortet.
Wie wird Empowerment als Chance für den Beziehungsaufbau dargestellt?
Die Arbeit beschreibt Empowerment als Möglichkeit, eine positive und partnerschaftliche Beziehung zwischen Sozialarbeiter und Klient aufzubauen. Dabei wird die Bedeutung von Vertrauen, gegenseitiger Achtung und der Vermeidung von Bevormundung hervorgehoben, um die Selbstbestimmung des Klienten zu gewährleisten. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Merkmale einer helfenden und professionellen Beziehung im Kontext von Empowerment.
Welche Herausforderungen und Konflikte entstehen in einer Empowerment-Partnerschaft?
Die Seminararbeit analysiert die Dynamik einer partnerschaftlichen Empowerment-Beziehung („Sharing Power“) und die damit verbundenen Herausforderungen und Konflikte. Sie betrachtet die Schwierigkeiten, die sowohl für den Klienten (z.B. Überforderung) als auch für den Sozialarbeiter entstehen können.
Welche Beziehungsstörungen können die Umsetzung von Empowerment behindern?
Die Arbeit identifiziert verschiedene Beziehungsstörungen, die die erfolgreiche Umsetzung von Empowerment gefährden können. Dazu gehören die Überforderung des Klienten, die Gefahr der Abhängigkeit und Fügsamkeit des Klienten, sowie die Problematik der Legitimität der Expertenmacht des Sozialarbeiters und deren Einfluss auf die Beziehung.
Wie wird der „Eigensinn“ des Klienten betrachtet?
Die Seminararbeit untersucht den „Eigensinn“ des Klienten als potenzielle Quelle von Beziehungswiderständen. Sie analysiert die damit verbundene psychische Belastung für den Sozialarbeiter und illustriert dies anhand eines Beispiels. Die Herausforderungen für die professionelle Praxis im Umgang mit dem Eigensinn des Klienten werden diskutiert.
Welche Grenzen der Empowerment-Arbeit werden aufgezeigt?
Die Arbeit beleuchtet die Grenzen des Empowerment-Ansatzes und setzt sich kritisch mit den Herausforderungen und potenziellen Schwierigkeiten auseinander, die bei der Umsetzung des Konzepts im Praxisalltag auftreten können. Diese Grenzen resultieren aus den zuvor diskutierten Punkten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Empowerment, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Beziehungsgestaltung, Sozialarbeit, Klient, Sozialarbeiter, Beziehungswiderstände, Expertenmacht, Überforderung, Abhängigkeit, Eigensinn, Grenzen der Empowerment-Arbeit.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit ist gegliedert in Kapitel zu Einleitung, Definition von Empowerment, Empowerment als Chance für den Beziehungsaufbau, Empowerment-Beziehung als Partnerschaft, Beziehungsstörungen, Eigensinn des Klienten, Grenzen der Empowerment-Arbeit und Fazit.
Wo finde ich den vollständigen Inhalt der Seminararbeit?
Der vollständige Inhalt der Seminararbeit, inklusive detaillierter Kapitelzusammenfassungen, ist im bereitgestellten HTML-Dokument enthalten.
- Arbeit zitieren
- Michéle Wohlrab (Autor:in), 2018, Empowerment im sozialarbeiterischen Alltag. Beziehungswiderstände und Perspektiven, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455576