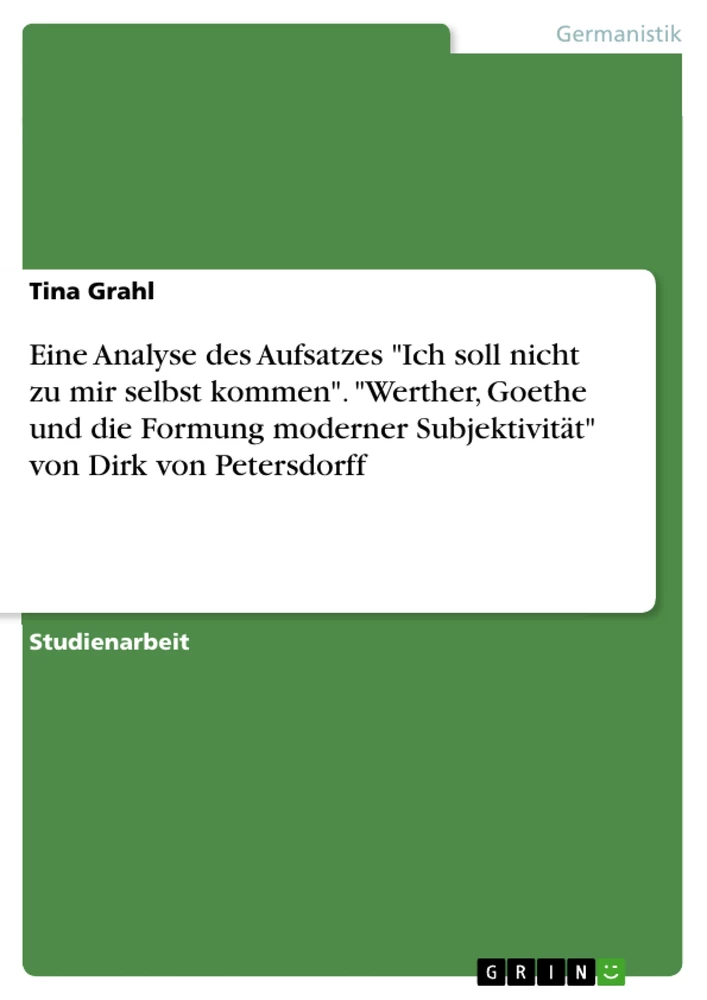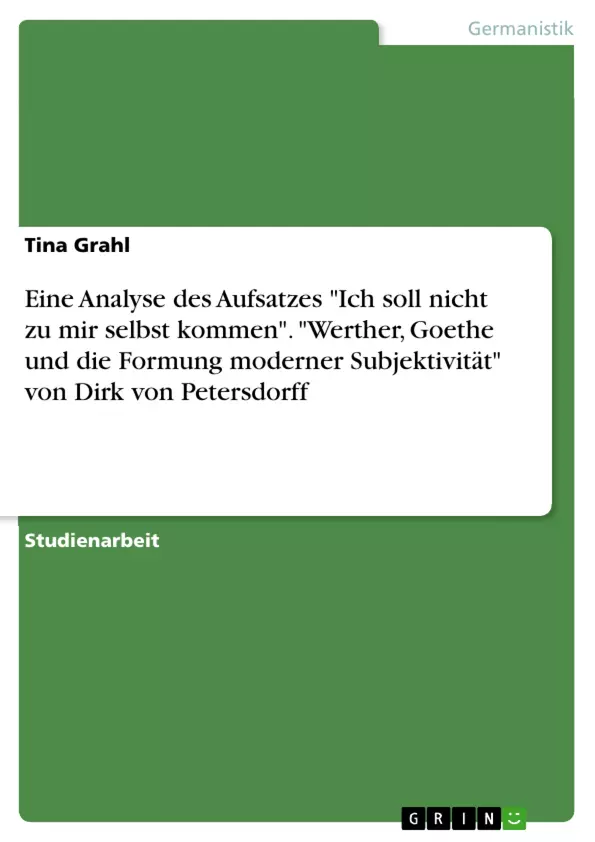Dirk von Petersdorff thematisiert in seinem Aufsatz „Ich soll nicht zu mir selbst kommen“. Werther, Goethe und die Formung moderner Subjektivität, der im Goethe-Jahrbuch 2006 erschienen ist, die gesellschaftlichen Veränderungen des 18. Jahrhunderts und führt diese mit dem Beispiel des Werthers und mit der Biographie des Autors Johann Wolfgang Goethes eng. Konkret benennt er dabei das 18. Jahrhundert als Beginn der Moderne, greift damit also auf den weit gefassten Moderne-Begriff zurück.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Werther und die Formung moderner Subjektivität
- Natur (I)
- Liebe (II)
- Gesellschaft (III)
- Systemtheoretische Literaturwissenschaft
- Dirk von Petersdorff: „Ich soll nicht zu mir selbst kommen“
- Natur (I)
- Liebe (II)
- Gesellschaft (III)
- Rekonstruktion und Kritik des Aufsatzes
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz analysiert die Identitätsproblematik in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ im Kontext der gesellschaftlichen Veränderungen des 18. Jahrhunderts. Der Autor Dirk von Petersdorff interpretiert Werther als Identitätsexperiment, das die Suche des modernen Subjekts nach einer Einheit im Angesicht der sich pluralisierenden Lebenswelt widerspiegelt.
- Die Herausforderungen der Identitätsfindung und -festigung in der frühen Moderne
- Werthers Suche nach einer Identität durch die drei Systeme Natur, Liebe und Gesellschaft
- Die Bedeutung der systemtheoretischen Literaturwissenschaft für die Analyse von literarischen Texten
- Goethes eigenes Identitätsexperiment und die Gestaltung seiner Persönlichkeit
- Die Anwendung der systemtheoretischen Ansätze auf Goethes „Die Leiden des jungen Werther“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die Hauptthese des Aufsatzes, die auf die Herausforderungen der Identitätsbildung in der frühen Moderne und deren Auswirkungen auf das moderne Subjekt fokussiert. Der Aufsatz verfolgt die These, dass Werther als Identitäts-Experiment Goethes gelesen werden kann, der versucht, sein pluralisiertes Ich durch die drei Systeme Natur, Liebe und Gesellschaft zu integrieren.
Das Kapitel über das System Natur beleuchtet Werthers Versuch, in der Natur eine höhere Ordnung und eine ganzheitliche Erfahrung zu finden. Die Subjektivierung der Natur führt jedoch zu Instabilität und verhindert eine dauerhafte Identitätsbildung. Goethes Verhältnis zur Natur hingegen zeichnet sich durch eine Objektivierung und die Rezeption naturwissenschaftlicher Schriften aus.
Das Kapitel über das System Liebe analysiert Werthers idealisierte Vorstellung von Liebe als Lösung für die Identitätsproblematik. Die idealistische Liebe scheitert aber an der Realität und führt zu Werthers inneren Konflikt. Goethes Lebenskonzept hingegen lässt mehrere Liebesmodelle nebeneinander gelten.
Das Kapitel über das System Gesellschaft betrachtet die Herausforderungen der Identitätsfindung in einer ausdifferenzierten Gesellschaft. Werther ist nicht in der Lage, sich in die gesellschaftlichen Strukturen zu integrieren, was zu Isolation und Entfremdung führt. Goethes Antwort auf die Herausforderungen der Gesellschaft besteht in der Akzeptanz der Pluralität und der Anpassung seiner eigenen Lebenskonzepte.
Das Kapitel über die systemtheoretische Literaturwissenschaft erläutert die Methode, die von Petersdorff für seine Analyse verwendet. Die systemtheoretische Literaturwissenschaft betrachtet Literatur als ein soziales System und analysiert die Wechselwirkungen zwischen Text, Autor, Rezipient und gesellschaftlichem Kontext.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Aufsatzes umfassen: Identitätsfindung, Moderne, Subjektivität, Pluralisierung des Ichs, systemtheoretische Literaturwissenschaft, Natur, Liebe, Gesellschaft, „Die Leiden des jungen Werther“, Johann Wolfgang Goethe, Dirk von Petersdorff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptthese von Dirk von Petersdorffs Aufsatz?
Er interpretiert Goethes „Werther“ als ein Identitätsexperiment, das die Herausforderungen der Identitätsfindung im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung des 18. Jahrhunderts widerspiegelt.
Durch welche drei Systeme versucht Werther seine Identität zu festigen?
Werther sucht Einheit und Sinn in den Systemen Natur, Liebe und Gesellschaft, scheitert jedoch in allen drei Bereichen.
Was versteht man unter systemtheoretischer Literaturwissenschaft?
Es ist eine Methode, die Literatur als soziales System betrachtet und analysiert, wie Texte auf gesellschaftliche Differenzierungsprozesse reagieren.
Warum scheitert Werther am System der Natur?
Die Subjektivierung der Natur führt bei Werther zu Instabilität; er findet keine objektive Ordnung, sondern nur die Spiegelung seiner eigenen wechselhaften Gefühle.
Wie unterscheidet sich Goethes eigenes Lebenskonzept von dem Werthers?
Während Werther an der Pluralität verzweifelt, akzeptiert Goethe die Vielfalt der Identitätsmodelle und passt seine Lebensentwürfe flexibel an die moderne Welt an.
- Quote paper
- Tina Grahl (Author), 2010, Eine Analyse des Aufsatzes "Ich soll nicht zu mir selbst kommen". "Werther, Goethe und die Formung moderner Subjektivität" von Dirk von Petersdorff, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455583