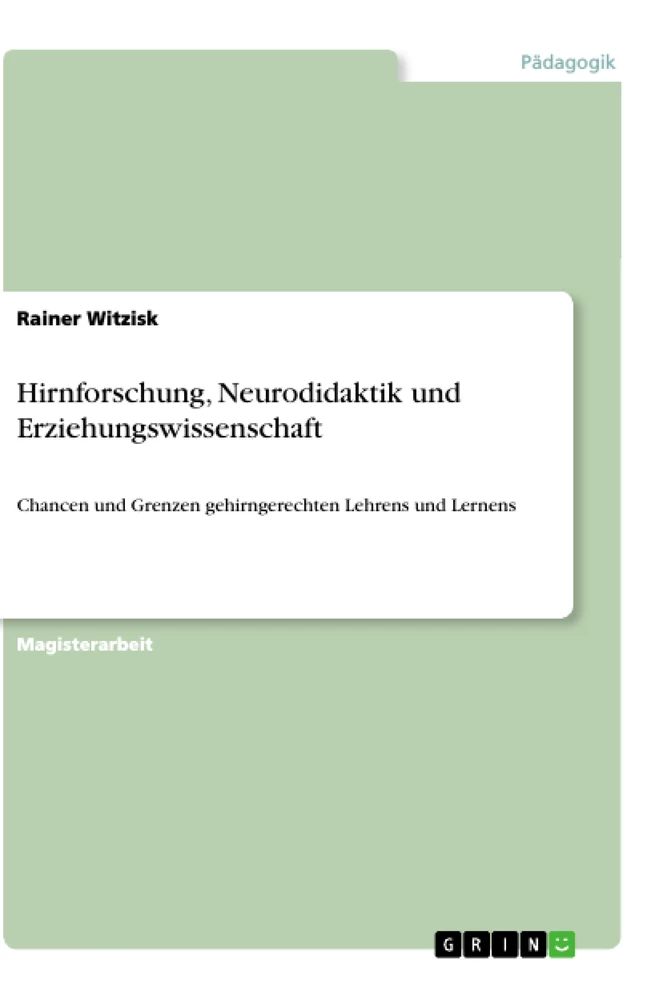Diese Arbeit setzt sich unter anderem mit der Frage auseinander, was uns denn neuronale Aktivitäten zu pädagogischem Handeln zu sagen haben? Dem schließt sich schnell die Frage an, was uns Gehirnfunktionen überhaupt sagen – und was sagen uns überhaupt Gehirnforscher? Dass beides nicht das Gleiche ist, wird sich noch zeigen. Welches Menschenbild entwerfen Hirnforscher, welches es für die Pädagogik und Erziehungswissenschaft unabdingbar macht, ihr Handeln und ihre theoretische Reflexion daran auszurichten? Kann eine von Hirnforschern entworfene biologische Anthropologie für pädagogische Praxis, speziell die Praxis des Unterrichtens, grundlegend sein, so dass diese sich ganz neu begründen muss?
Keine Frage, die Hirnforscher beherrschen zur Zeit den wissenschaftlichen Diskurs. Ihre Beiträge finden nicht nur Eingang in diversen wissenschaftlichen Zeitschriften und beherrschen nicht nur die Wissenschaftsseiten der gehobenen Qualitätspresse, sondern sind auch im Feuilleton angekommen. Seit 2002 gibt es mit „Gehirn&Geist“ eine eigene Zeitschrift für die Themen der Hirnforschung, die sich auf Anhieb auf dem Markt etabliert hat. Mittlerweile ist die Hirnforschung unter dem Etikett „Neurodidaktik“ auch in der Pädagogik angekommen. Dabei versteht sich nicht jeder, der sich für „gehirngerechtes“ Lehren- und Lernen ausspricht, explizit als Neurodidaktiker. Allen gemeinsam ist aber die Vorstellung, dass jeglicher Lehr- Lernprozess hirnforscherliche Erkenntnisse zu berücksichtigen hat. Mit anderen Worten: Wer vom Gehirn nichts versteht, versteht auch nichts vom Lernen.
Beginnt man nun das Unterfangen, Neurodidaktik als pädagogische Disziplin zu legitimieren, dann erkennt man recht bald, dass das Verhältnis von Neuro- und Didaktik ein äußerst problematisches ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- I. GEHIRN UND BEWUSSTSEIN
- 2. AUFGABEN UND PROBLEME EINER BIOLOGISCHEN THEORIE DES BEWUSSTSEINS.
- 2.1 Gehirn und Bewusstsein.....
- 2.2 Bewusstsein als emergente Eigenschaft des Gehirns.
- 3. FREIHEIT ODER DETERMINISMUS
- 3.1 Das Libet- Experiment........
- 3.2 Kritik am Libet- Experiment....
- 3.3 Das Bewusstsein in behavioristischer Perspektive...\n
- 3.4 Grundprobleme einer Philosophie des Geistes.
- 3.4.1 Der Epiphänomenalismus...\n
- 3.4.2 Der interaktionistische Dualismus..\n
- 3.4.3 Die Identitätstheorie
- 3.5 Von zerebralen und philosophischen Kategorienfehlern...\n
- 3.6 Resümee und Ausblick..\n
- II. NEURODIDAKTIK
- 4. EINLEITUNG UND DEFINITION DER NEURODIDAKTIK.
- 4.1 Allgemeine Grundlagen und Prämissen der Neurodidaktik..\n
- 4.2 Plastizität des Gehirns...\n
- 4.3 Die Neurobiologie des Lernens..\n
- 4.4 Konsequenzen für ein Lehr- Lernarrangement..\n
- 4.5 Bewusstes und unbewusstes Lernen.\n
- 4.6 Besser lernen mit Dopamin...\n
- 4.7 Konsequenzen für ein Lehr- Lernarrangement..\n
- 4.8 Die Amygdala......\n
- 4.9 Konsequenzen für ein Lehr- Lernarrangement.\n
- 4.10 Das Gedächtnis...\n
- 4.11 Der Hippokampus und das explizite Gedächtnis.\n
- 4.12 Konsequenzen für ein Lehr- Lernarrangement.\n
- 5. NEURODIDAKTIK UND FRÜHFÖRDERUNG.
- 5.1 Die Neurobiologie der kindlichen Gehirnentwicklung.\n
- 5.2 Der Einfluss von Umwelt und Genen auf die Gehirnentwicklung und...\ndas frühkindliche Lernen..\n
- 5.3 Kritische Phasen.\n
- 5.4 Gehirnreifung und Synapsendichten...\n
- 5.5 Kritische Anmerkungen zur Frühförderung.\n
- 5.6 Frühförderung - und dann?..\n
- 5.7 Resümee.\n
- 6. DIE THEORIE der NeuroDIDAKTIK IM LIChte einer Allgemeinen DidAKTIK.
- 6.1 Die semantische Blindheit einer neurobiologisch gewendeten Didaktik.\n
- 7. ZUM GUTEN Schluss: EINE BIOLOGISCHE ANTHROPOLOGIE FÜR EINE.\nPÄDAGOGISCHE DIDAKTIK..\n
- 7.1 Eine neue Grundlegung der Neurodidaktik durch.\nPerspektivenwechsel...\n
- Das Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein und die damit verbundenen Fragen nach Willensfreiheit und Determinismus.
- Die Anwendung neurobiologischer Erkenntnisse in der pädagogischen Praxis, insbesondere im Bereich der Neurodidaktik.
- Die Bedeutung von frühkindlicher Gehirnentwicklung und kritischen Phasen für die Pädagogik.
- Die kritische Analyse der Neurodidaktik und ihre Einordnung in das Gesamtgefüge der Allgemeinen Didaktik.
- Die Suche nach einer neuen Grundlegung der Neurodidaktik durch einen Perspektivenwechsel.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der Hirnforschung auf die Pädagogik, insbesondere im Kontext der Neurodidaktik. Sie untersucht die Möglichkeit, dass Erkenntnisse der Hirnforschung eine neue Grundlegung für das Lehren und Lernen durch eine biologische Anthropologie ermöglichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die Grundlage der Arbeit, indem es die aktuelle Relevanz der Hirnforschung im wissenschaftlichen Diskurs beleuchtet und den Anspruch der Neurodidaktik auf eine neurowissenschaftlich fundierte Pädagogik einführt.
Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Gehirn und Bewusstsein. Er untersucht die Theorien des Nobelpreisträgers Gerald Edelman, die das Bewusstsein kausal aus der Gehirntätigkeit erklären wollen, und beleuchtet die damit verbundenen Fragen nach Willensfreiheit und Determinismus.
Kapitel drei beschäftigt sich mit der Kritik am Libet-Experiment und diskutiert die Bedeutung des Bewusstseins in der behavioristischen Perspektive sowie die verschiedenen Theorien der Philosophie des Geistes.
Das vierte Kapitel führt in die Neurodidaktik ein und definiert ihre Grundlagen sowie Prämissen. Es beleuchtet die Plastizität des Gehirns, die Neurobiologie des Lernens und die Konsequenzen für Lehr-Lernarrangements.
Kapitel fünf behandelt die Neurodidaktik im Kontext der Frühförderung und untersucht die Neurobiologie der kindlichen Gehirnentwicklung, den Einfluss von Umwelt und Genen auf die Gehirnentwicklung und das frühkindliche Lernen, sowie die Bedeutung kritischer Phasen und Gehirnreifung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Neurodidaktik, Hirnforschung, Bewusstsein, Willensfreiheit, Determinismus, Frühförderung, kritische Phasen, Lernen, Lehren, pädagogische Praxis und biologische Anthropologie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Neurodidaktik?
Neurodidaktik ist eine Disziplin, die versucht, Erkenntnisse der Hirnforschung für pädagogische Lehr- und Lernprozesse nutzbar zu machen.
Was besagt das Libet-Experiment für die Pädagogik?
Das Experiment stellt die menschliche Willensfreiheit in Frage und diskutiert, ob Handlungen bereits neuronal determiniert sind, bevor wir sie bewusst entscheiden.
Warum ist die Plastizität des Gehirns wichtig für das Lernen?
Plastizität bedeutet, dass das Gehirn durch Erfahrung und Lernen strukturell veränderbar ist, was lebenslanges Lernen erst ermöglicht.
Welche Rolle spielen Dopamin und die Amygdala beim Lernen?
Dopamin wirkt als Belohnungssignal und steigert die Motivation, während die Amygdala Emotionen verarbeitet, die den Lernerfolg maßgeblich beeinflussen können.
Gibt es "kritische Phasen" in der Gehirnentwicklung?
Ja, es gibt Zeitfenster in der frühen Kindheit, in denen das Gehirn besonders empfänglich für bestimmte Reize (z. B. Sprache) ist. Die Arbeit hinterfragt jedoch auch kritisch die Übersteigerung der Frühförderung.
- Citar trabajo
- Rainer Witzisk (Autor), 2005, Hirnforschung, Neurodidaktik und Erziehungswissenschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455743