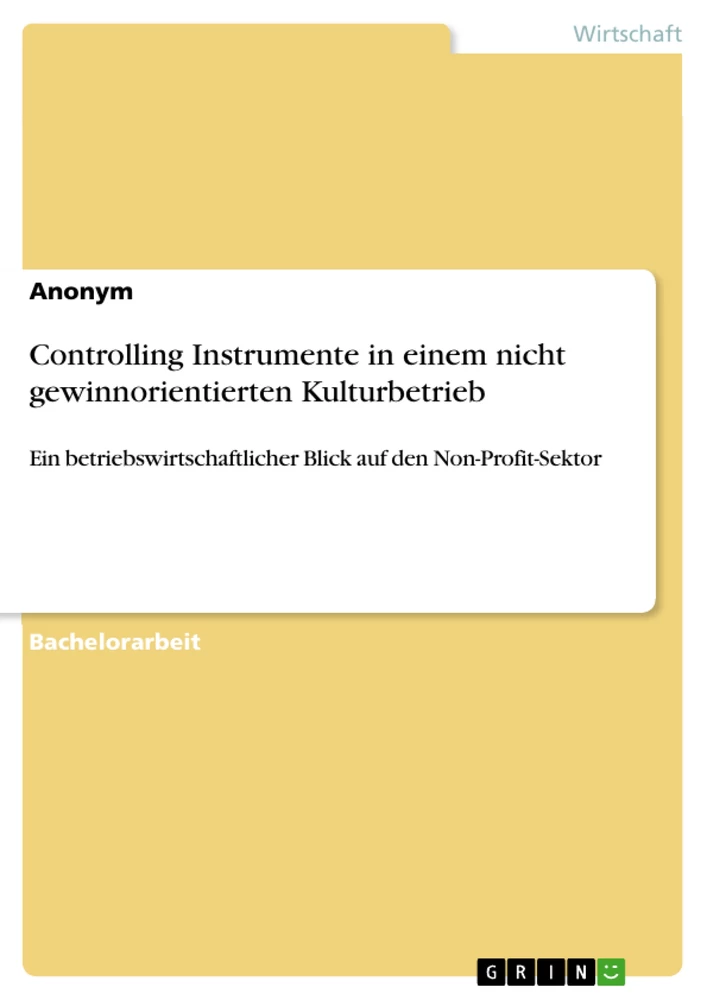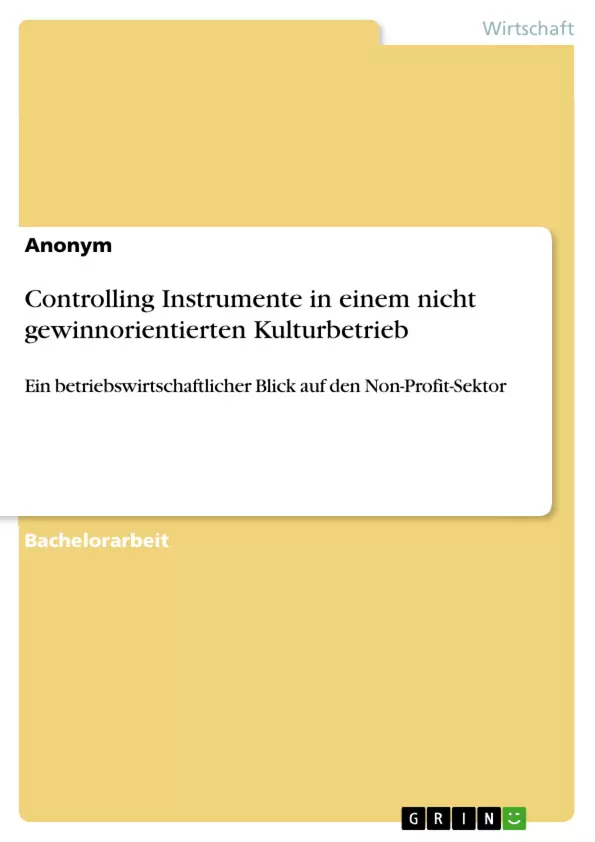In dieser Bachelorarbeit geht es darum, wie ein Kulturbetrieb, der einer Non-Profit-Organisation (NPO) unterliegt, Gewinne erzielt. Fokus der Arbeit liegt hierbei auf den Instrumenten, die im NPO Bereich angewandt werden können und welches sich an dieser Stelle am besten eignet. Die Balanced Scorecard spielt in dieser Arbeit eine der Hauptrollen. Sie zeigt auf, welche Möglichkeiten es speziell im nicht gewinnorientierten Bereich gibt. Es geht zum einen darum, die betriebswirtschaftliche Funktion auf der monetären Seite des Controllings zu erklären und zum anderen die nicht geldliche Funktion an Hand des Controlling Instruments der Balanced Scorecard zu beleuchten. Es soll auch deutlich werden, wie das Controlling im Gesamtkontext eines Kulturbetriebes positioniert ist. Darüber hinaus soll die Theorie auf das Praxisbeispiel der Kunstausstellung "documenta" projiziert werden und verdeutlichen, welche Besonderheiten mit einem nicht gewinnorientierten Kulturbetrieb einhergehen.
Jeder Mensch wird regelmäßig mit Non-Profit-Organisationen konfrontiert, da sie besonders im sozialen, politischen, kulturellen, ökologischen, religiösen oder medizinischen Bereich Anwendung finden. Jedoch macht sich kaum jemand Gedanken darüber, was diese Art von Organisation überhaupt so besonders macht. Denn wie der Name schon sagt, geht es nicht primär darum Profit zu generieren, was im ersten Moment auch noch kein Problem darstellt. Das Problem kommt erst mit der Zieldefinierung dieser Art von Organisationen. Denn nicht gewinnorientierte Unternehmen müssen ihre Ziele so wählen, dass sie messbar sind. Die meisten Ziele sind aber nun einmal monetär getrieben und damit auch vergleichbar und messbar.
Dritte-Sektor- oder Non-Profit-Organisationen werden meist mit bestimmten gesellschaftlichen Tätigkeitsfeldern, wie etwa mit dem Sport oder der Kultur, in Verbindung gebracht. Im Unterschied zu gewinnorientierten Unternehmen besteht ihre Zielsetzung eben nicht in der Gewinnmaximierung, sondern im Fokus steht die organisationsspezifische Sachzielorientierung, da sie dem so genannten nonprofit constraint unterliegen. Diese Art von Organisationen haben das Verbot der Gewinnausschüttungen, was bedeutet, dass Gewinne zwar erwirtschaftet werden, aber nicht an Mitglieder oder Mitarbeiter ausgeschüttet werden. Stattdessen müssen sie wieder in die Organisationen re-investiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziele der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Non-Profit-Organisationen
- Begriffserklärung
- Konstitutive Merkmale
- Die Kultur und Ihr Wirtschaftsfaktor
- Der Begriff Kultur
- Der Kulturbetrieb und sein Output
- Ziele und Funktionen eines Kulturbetriebs
- Das Controlling
- Controllingaufgaben und -funktionen
- Planung
- Steuerung
- Kontrolle
- Controlling-Instrumente
- Operative Instrumente
- Strategische Instrumente
- Die Balanced Scorecard
- Controlling in NPOs
- Unterschiede und Problematiken
- Controlling im Kulturbetrieb unter Anwendung der BSC
- Praxisbeispiel: documenta in Kassel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit mit dem Titel „Controlling Instrumente in einem nicht gewinnorientierten Kulturbetrieb“ befasst sich mit der Anwendung von Controlling-Instrumenten im Non-Profit-Sektor, insbesondere im Kontext von Kulturbetrieben. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten des Controllings in einem Umfeld, das keine monetären Zielgrößen im Vordergrund hat.
- Die Analyse der Besonderheiten von Non-Profit-Organisationen und ihrer Zielsetzung im Vergleich zu gewinnorientierten Unternehmen.
- Die Darstellung der spezifischen Aufgaben und Funktionen des Controllings in Kulturbetrieben.
- Die Erläuterung der Balanced Scorecard als ein geeignetes Controlling-Instrument für Kulturbetriebe und die Herausarbeitung ihrer spezifischen Anwendung.
- Die Untersuchung der Positionierung des Controllings im Gesamtkontext eines Kulturbetriebs und seine Integration in die strategische Planung.
- Die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse auf das Praxisbeispiel der documenta, um die Besonderheiten des Controllings in einem nicht gewinnorientierten Kulturbetrieb zu verdeutlichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Problemstellung, die Ziele und der Aufbau der Arbeit dargestellt werden. Anschließend werden die grundlegenden Begrifflichkeiten von Non-Profit-Organisationen erläutert, sowie die konstitutiven Merkmale dieser Organisationsform. Im Anschluss daran wird der Kulturbetrieb als Wirtschaftsfaktor in den Fokus gerückt, wobei der Begriff Kultur, der Output von Kulturbetrieben und die Ziele sowie Funktionen eines Kulturbetriebs beleuchtet werden. Das vierte Kapitel widmet sich dem Controlling und seinen Aufgaben und Funktionen, wobei die Bereiche Planung, Steuerung und Kontrolle ausführlich behandelt werden. Weiterhin werden verschiedene Controlling-Instrumente, darunter operative und strategische Instrumente sowie die Balanced Scorecard, vorgestellt. Kapitel fünf befasst sich mit den Besonderheiten des Controllings in Non-Profit-Organisationen, insbesondere im Hinblick auf Unterschiede und Problematiken. Es wird gezeigt, wie die Balanced Scorecard im Kontext von Kulturbetrieben angewandt werden kann. Das Praxisbeispiel der documenta in Kassel verdeutlicht schließlich die Anwendung des Controllings in einem konkreten Kulturbetrieb.
Schlüsselwörter
Controlling, Non-Profit-Organisationen, Kulturbetrieb, Balanced Scorecard, documenta, strategische Planung, Zielsetzung, Messgrößen, Performancemessung, Non-Profit-Management, Kulturmanagement.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Controlling Instrumente in einem nicht gewinnorientierten Kulturbetrieb, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456068