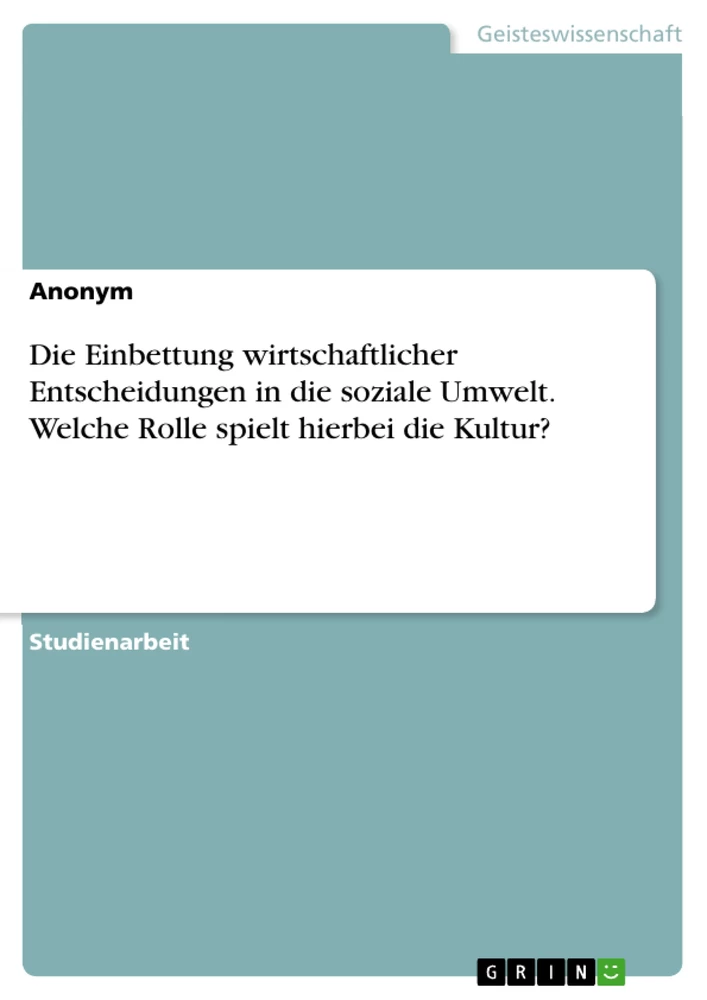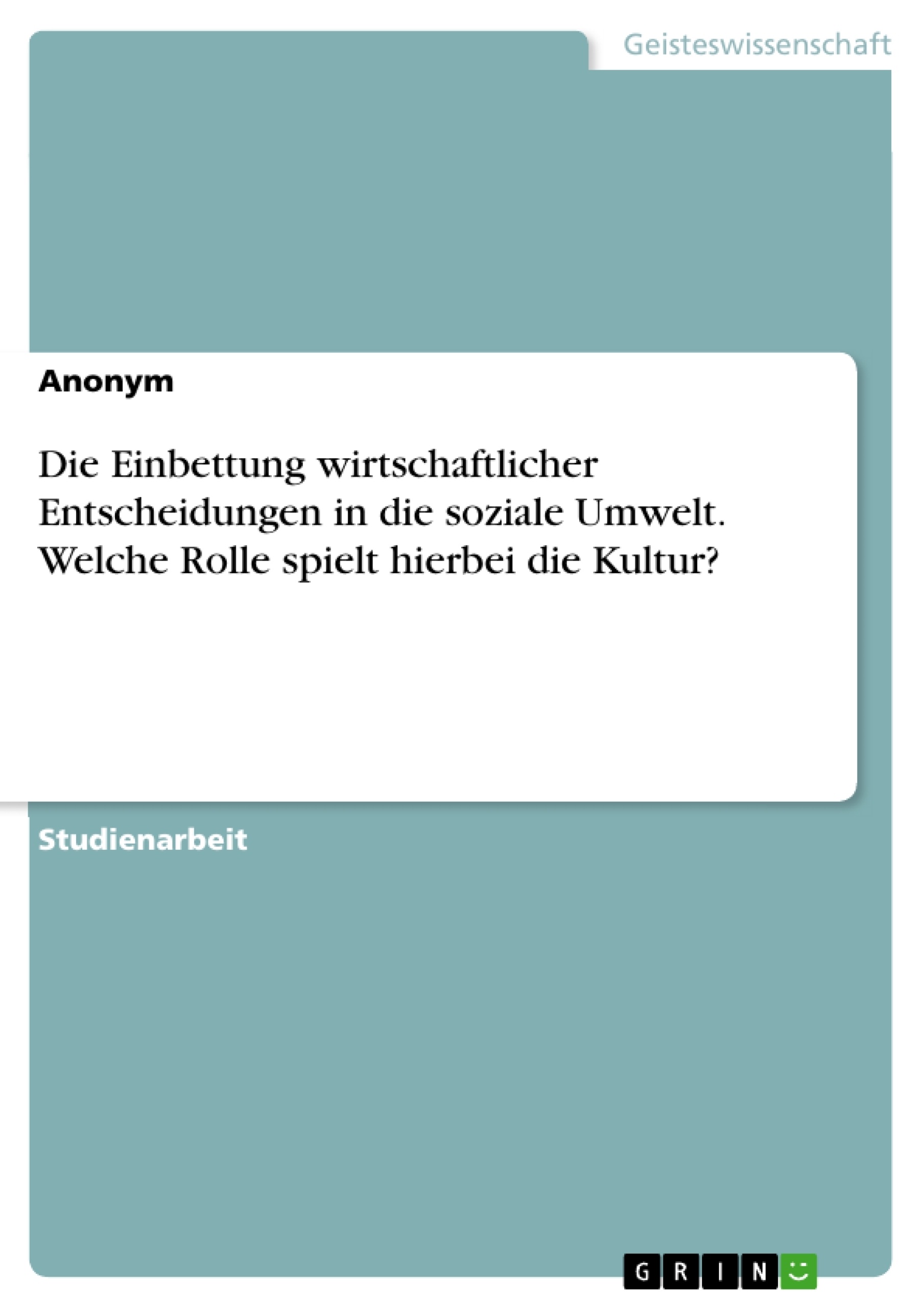Schon im Jahre 1930 legitimierte der Soziologe und Volkswirt Werner Sombart in seinem Werk Nationalökonomie und Soziologie die Erforschung der Ökonomie aus sozialwissenschaftlicher Sicht, wenn er sagt, dass Wirtschaft (…) ein Teil der menschlichen Gesellschaft [ist] (Sombart, 1930). Daran knüpft ein Teilgebiet der Soziologie an- die Wirtschaftssoziologie. Inwiefern wirtschaftliches Handeln in soziale Strukturen eingebettet ist, beschreibt Mark Granovetter 1985 in seinem Aufsatz Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, welcher als das Leitbild in dieser Debatte gilt und Raum für weitere Untersuchung bietet.
In dieser Hausarbeit soll geprüft werden, welche Rolle die Kultur bei der Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen in die soziale Umwelt spielt. Daher wird nun zunächst die Theorie der Einbettung nach Granovetter beschrieben sowie überblickshalber verschiedene Dimensionen der Einbettung dargestellt. Die Dimension der Kultur ist schließlich relevant für diese Arbeit, weshalb anschließend eine Annäherung an den Kulturbegriff vorgenommen wird. Hier zeigt sich, dass es keine eindeutige Definition von Kultur gibt. Nun erfolgt die Darstellung und methodische Bewertung von diversen Studien, die anhand von Ultimatum- Spielen kulturelle Einflüsse auf wirtschaftliche Entscheidungssituationen untersucht haben. Durch das Zusammentragen aller Ergebnisse kann anschließend die Forschungsfrage beantwortet werden. Zuletzt werden zentrale Befunde zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen in die soziale Umwelt- Welche Rolle spielt hierbei die Kultur?
- Theorie zur Einbettung wirtschaftlichen Handelns
- Annäherung an den Kulturbegriff
- Darstellung und Bewertung empirischer Ergebnisse zur Erforschung kultureller Einflüsse
- Kulturelle Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss der Kultur auf die Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen in die soziale Umwelt. Sie fokussiert auf die Theorie der Einbettung nach Granovetter und erörtert, wie diese die Rolle kultureller Faktoren in wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen beleuchtet.
- Theorie der Einbettung nach Granovetter
- Kulturelle Dimensionen wirtschaftlichen Handelns
- Empirische Studien zu kulturellen Einflüssen auf wirtschaftliche Entscheidungen
- Bewertung verschiedener methodischer Ansätze
- Zusammenfassung zentraler Befunde
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und erläutert die Bedeutung der Einbettung wirtschaftlichen Handelns in die soziale Umwelt. Sie führt den Leser in die Thematik ein und definiert die Forschungsfrage.
- Die Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen in die soziale Umwelt- Welche Rolle spielt hierbei die Kultur?: Dieses Kapitel beleuchtet die Theorie der Einbettung nach Granovetter und setzt sich mit den Konzepten der Über- und Untersozialisierung auseinander. Es beleuchtet die Bedeutung des sozialen Kontextes für wirtschaftliche Entscheidungen und skizziert die Rolle der Kultur in diesem Zusammenhang.
- Theorie zur Einbettung wirtschaftlichen Handelns: Dieser Abschnitt erläutert Granovetters Konzept der Einbettung und argumentiert, warum wirtschaftliches Handeln nicht als reines Produkt rationaler Entscheidungen betrachtet werden sollte. Es wird die Kritik an den traditionellen Ansätzen der Über- und Untersozialisierung diskutiert.
- Annäherung an den Kulturbegriff: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs "Kultur" und zeigt die Vielfalt der kulturellen Einflüsse auf wirtschaftliche Entscheidungen. Es wird auf die Herausforderung eingegangen, einen eindeutigen Kulturbegriff zu definieren.
- Darstellung und Bewertung empirischer Ergebnisse zur Erforschung kultureller Einflüsse: Dieser Abschnitt beleuchtet verschiedene empirische Studien, die kulturelle Einflüsse auf wirtschaftliche Entscheidungen untersucht haben. Er analysiert die Methoden und die Ergebnisse dieser Studien.
- Kulturelle Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen: Dieser Abschnitt fasst die wichtigsten Befunde der Hausarbeit zusammen und zeigt auf, wie Kultur die Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen in die soziale Umwelt beeinflusst.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Schlüsselbegriffe Einbettung, Kultur, wirtschaftliches Handeln, soziale Umwelt, empirische Forschung, Netzwerkanalyse, Granovetter, Polanyi, homo oeconomicus, Ultimatum-Spiele. Der Fokus liegt darauf, die Bedeutung der kulturellen Einflüsse auf wirtschaftliche Entscheidungen in einem sozialen Kontext zu erforschen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Die Einbettung wirtschaftlicher Entscheidungen in die soziale Umwelt. Welche Rolle spielt hierbei die Kultur?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456100