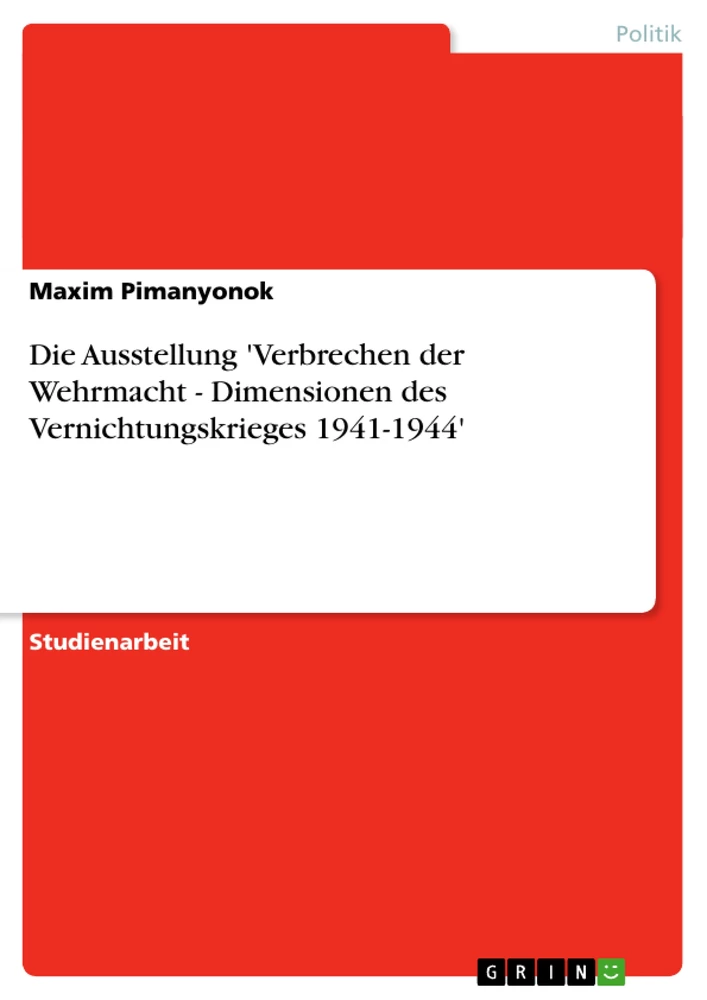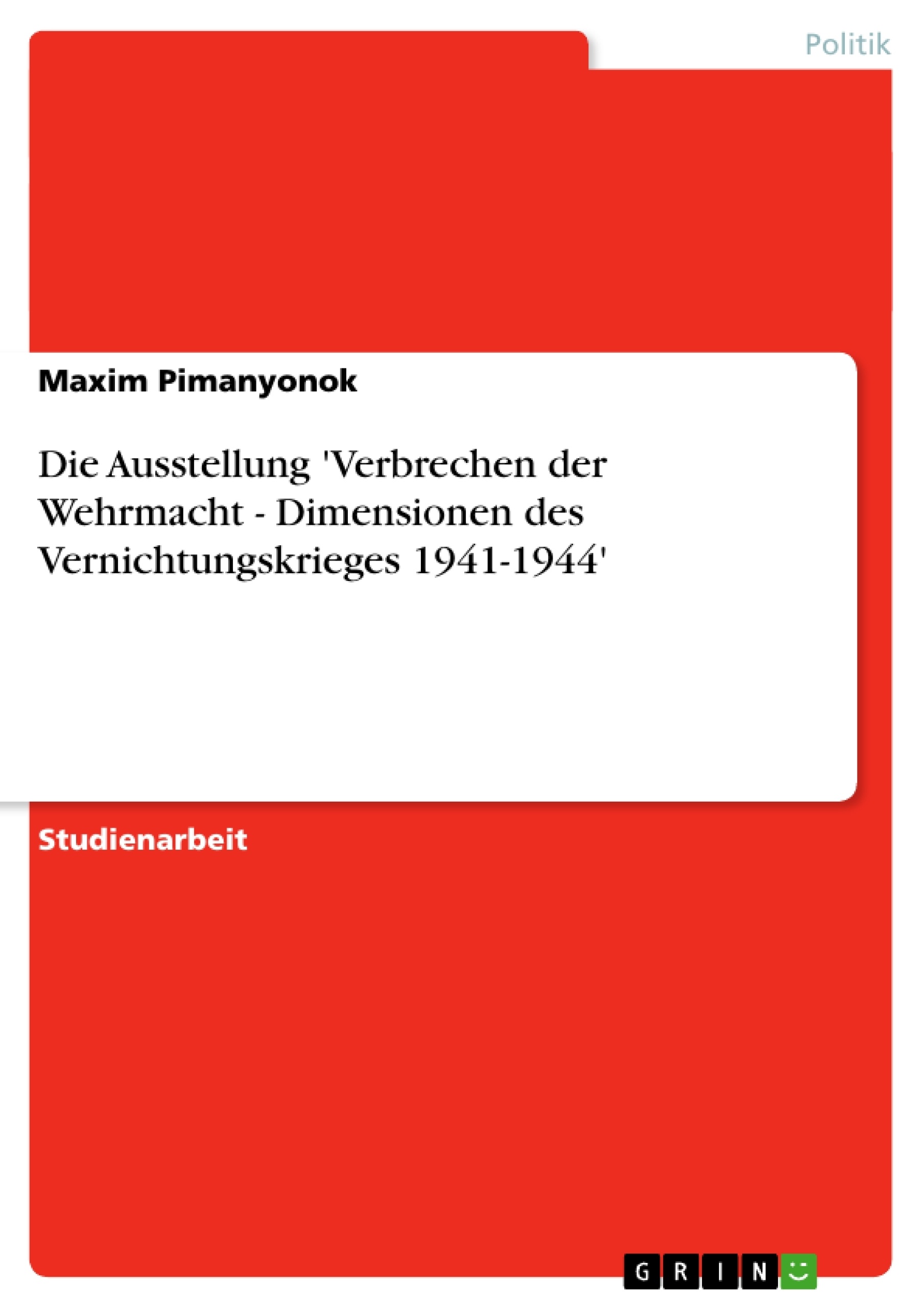Die vom Hamburger Institut für Sozialforschung im Rahmen des Forschungsprojekts „Angesichts unseres Jahrhunderts. Gewalt und Destruktivität im Zivilisationsprozess“ konzipierte Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944“ wurde von 1995 bis 1999 in 34 Städten der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs gezeigt und von ca. 900.000 Menschen besucht. Die so genannte „Wehrmachtsausstellung“ wurde zum Gegenstand einer breiten öffentlichen, außerordentlich intensiv wie kontrovers geführten Auseinandersetzung mit den Verbrechen des national-sozialistischen Regimes während des zweiten Weltkriegs und der historischen Rolle der Wehrmacht in diesem Zusammenhang, einer Auseinandersetzung, die nicht nur im öffentlich-politischen Raum, sondern auch in Familien und Freundeskreisen geführt wurde. Die Ausstellung wurde in der Öffentlichkeit als Tabubruch hinsichtlich des weit verbreiteten Bildes von der „anständigen“ und „unpolitischen“ Wehrmacht, den „unschuldigen“ Wehrmachtssoldaten, wahrgenommen. Ein für viele gültiger und wichtiger vergangenheitspolitischer Grundkonsens wurde damit von den Ausstellungsautoren angegriffen und in Frage gestellt (Pollak 2002:56).
Nachdem den Ausstellungsmachern von Kritikern einige gravierende Fehler bei der Zuordnung und Deutung von Fotos nachgewiesen worden waren, wurde sie im November vom Leiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Jan Philipp Reemtsma, geschlossen. Die von Reemtsma mit der Überprüfung auf Fehler und Mängel beauftragte unabhängige Historikerkommission veröffentlichte Anfang November 2000 einen weitgehend entlastenden Bericht, der den Aussagen der Ausstellung wissenschaftliche Korrektheit attestierte und nur einige wenige Fotos bzw. deren Bildunterschriften beanstandete.
Trotz dieses entlastenden Berichtes wurde vom Hamburger Institut für Sozialforschung eine völlig neue Ausstellung mit dem Titel „Verbrechen der Wehrmacht – Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944“ konzipiert, die Ende November 2001 in Berlin eröffnet wurde.
In der vorliegenden Arbeit wird kurz der Bericht der Historikerkommission präsentiert. Anschließend werden die beiden Wehrmachtsausstellungen nach Themen, kommunikativen Konzepten und der Präsentation der Bilder verglichen. Zum Schluss wird auf wesentliche Aspekte der Kritik an der neuen Ausstellung vom ehemaligen Ausstellungsleiter Hannes Heer eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER BERICHT DER HISTORIKERKOMMISSION UND DIE NEUKONZEPTION DER AUSSTELLUNG
- DIE BEIDEN AUSSTELLUNGEN IM VERGLEICH
- DIE THEMEN
- DIE KOMMUNIKATIVEN KONZEPTE
- DIE,,BILDFRAGE“
- ,,KONTROVERSEN ÜBER EINE AUSSTELLUNG“
- KRITIK AN DER NEUEN WEHRMACHTSAUSSTELLUNG
- SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944" und ihre Vorgeschichte. Sie beleuchtet die Kritik an der ursprünglichen Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944" und den Bericht der Historikerkommission, der diese Kritik untersuchte. Darüber hinaus werden die beiden Ausstellungen hinsichtlich ihrer Themen, kommunikativen Konzepte und der Präsentation von Bildern verglichen.
- Die Rolle der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
- Die kontroverse Debatte um die „anständige" Wehrmacht
- Die Bedeutung von Bildern und Bildinterpretationen in der Geschichtsforschung
- Die ethischen und wissenschaftlichen Herausforderungen bei der Ausstellung von Kriegsverbrechen
- Der Einfluss von Kritik und öffentlicher Meinung auf historische Forschung und Ausstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944“ und ihre Bedeutung für die öffentliche Diskussion über die Verbrechen des Nationalsozialismus vor. Sie schildert die Kontroversen, die durch die Ausstellung ausgelöst wurden, und die Reaktion des Hamburger Instituts für Sozialforschung.
Kapitel 2 beleuchtet den Bericht der Historikerkommission, die die ursprüngliche Ausstellung auf Fehler und Mängel untersuchte. Es werden die Mitglieder der Kommission und ihre Ergebnisse vorgestellt, die die grundlegende These der Ausstellung bestätigten, aber auch einige Ungenauigkeiten in der Bildauswahl und -interpretation aufdeckten.
Kapitel 3 setzt sich mit dem Vergleich der beiden Ausstellungen auseinander. Es werden die Themen, die kommunikativen Konzepte und die Präsentation der Bilder in den beiden Versionen der Ausstellung analysiert.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Kritik an der neuen Wehrmachtsausstellung. Es werden die Argumente der Kritiker, insbesondere des ehemaligen Ausstellungsleiters Hannes Heer, beleuchtet.
Schlüsselwörter
Wehrmachtsausstellung, Verbrechen der Wehrmacht, Vernichtungskrieg, Zweiter Weltkrieg, Historikerkommission, Bildanalyse, Geschichtsforschung, öffentliche Debatte, Tabubruch, Kontroversen.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern der "Wehrmachtsausstellung"?
Die Ausstellung thematisierte die Verbrechen der Wehrmacht im Vernichtungskrieg 1941-1944 und griff das Bild der "anständigen" Wehrmacht massiv an.
Warum wurde die erste Ausstellung im Jahr 1999 geschlossen?
Sie wurde geschlossen, nachdem Kritiker Fehler bei der Zuordnung und Deutung einiger Fotos nachgewiesen hatten.
Zu welchem Ergebnis kam die Historikerkommission?
Die Kommission bestätigte die wissenschaftliche Korrektheit der Gesamtaussage, beanstandete jedoch die Bildunterschriften einiger weniger Fotos.
Wie unterschieden sich die beiden Ausstellungen?
Die zweite Ausstellung (ab 2001) wurde völlig neu konzipiert, mit veränderten Themenschwerpunkten und einem neuen kommunikativen Konzept.
Welche vergangenheitspolitische Bedeutung hatte die Debatte?
Die Diskussion führte zu einem Tabubruch in der deutschen Gesellschaft und zwang viele Familien zur Auseinandersetzung mit der Rolle ihrer Vorfahren im Krieg.
Wer war Jan Philipp Reemtsma in diesem Kontext?
Er war der Leiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung, welches die Ausstellungen konzipierte und verantwortete.
- Citation du texte
- Maxim Pimanyonok (Auteur), 2004, Die Ausstellung 'Verbrechen der Wehrmacht - Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45613